Der erste Popstar der DDR
Er war der Superstar der DDR - aber auch ein Querkopf: Jochen Voit erzählt erstmals die ganze Geschichte des Schauspielers und Interpreten Ernst Busch. Zwar erschien schon 1987 – damals in der DDR - eine opulente "Biographie in Texten, Bildern und Dokumenten". Doch sie verschwieg viele Details aus Buschs Leben.
Unter der Überschrift "Gesungene Zeitgeschichte" feierte die "Tägliche Rundschau" am 11. Juni 1946 die bevorstehende Rückkehr des Sängers Ernst Busch auf die Berliner Bühne. Busch war 1945 nach seiner Befreiung aus dem Zuchthaus Brandenburg durch sowjetische Truppen nach Berlin zurückgekehrt und zunächst nur als Schauspieler im Hebbel-Theater aufgetreten.
Sein Gesicht war halbseitig gelähmt. Als politischer Häftling im Moabiter Gefängnis war er bei einem Luftangriff auf Berlin schwer verletzt worden. Die Gefangenen durften nicht in den Luftschutzkeller und blieben während der Bombardements in ihren Zellen eingesperrt. Als Busch im Moabiter Krankentrakt wieder zu Bewusstsein kam, glaubte er, nie wieder singen zu können. Mit seinem Comeback als Sänger begann 1946 sein Aufstieg zum Superstar der DDR.
Jochen Voit erzählt erstmals die ganze Geschichte des großen Schauspielers und Interpreten Ernst Busch. Die 1987 in der DDR erschienene opulente "Biografie in Texten, Bildern und Dokumenten" hatte viele Details aus Buschs Leben verschwiegen, die nicht in das heroische SED-Weltbild passten. Der Weg des Kieler Arbeiterjungen zum Stalin-, Lenin- und Nationalpreisträger der DDR verlief nämlich keineswegs so geradlinig, wie es die DDR-Biografie glauben machte.
Busch, der, wenn es ihm angebracht schien, ein ziemlicher Querkopf sein konnte, war in den 50er-Jahren mehrfach mit der SED aneinandergeraten. Die Zensur kannte auch für den von Busch gegründeten Musikverlag "Lied der Zeit" kein Pardon. Man warf ihm "Proletkult", ja sogar "Formalismus" und "Kosmopolitismus" vor, was so ziemlich die schlimmsten Abweichungen von der sozialistischen Kunstpolitik jener Zeit waren.
Wegen der Verbreitung von "anglo-amerikanischer Tanzmusik" hatte sich Walter Ulbricht persönlich in einem Brief an Busch gewandt und für die "Ausschaltung" solcher Produktionen ausgesprochen.
"Die Staatliche Kommission für Kunstangelegenheiten rügt an Busch weiterhin ‘rechtsopportunistische Tendenzen’, zumal wenn er Lieder singt ‘mit der Absicht, den USA-Imperialismus zu karikieren’: Der Song ‘Ami go home!’ zum Beispiel enthalte ‘ganze Strecken heißester Jazzmusik’. Diese Feststellung ist besonders bemerkenswert, weil es sich hier um eine der beiden Busch-Platten handelt, die es in der Nachkriegszeit zu echter Popularität bringen. Das patriotische Lied ist 1951 während der Weltfestspiele in Berlin massenhaft verbreitet und zum Hit geworden."
Bertolt Brecht intervenierte zugunsten von Ernst Busch und seines musikalischen Bearbeiters Hanns Eisler beim FDJ-Vorsitzenden Erich Honecker im Zusammenhang mit dem erfolgreichen "Ami-go-home"-Lied:
"Wo es erwähnt wird in der Presse, wird meistens, auch im ‘Neuen Deutschland’, weder der Name Eisler noch der Name Busch erwähnt. Und es handelt sich da doch um eine kleine Feder in der Kappe der DDR! Wie soll Busch außer einer Tatsache auch noch ein Begriff der FDJ werden? Können Sie helfen?"
Erich Honecker, der wie Busch während der Nazizeit im Zuchthaus Brandenburg gesessen hatte, konnte oder wollte nicht helfen. Viele Jahre später, nachdem er es zum SED-Chef gebracht hatte, gerierte er sich als Buschs Freund. 1952 musste der sich einer peinlichen Befragung durch Parteikontrolleure unterziehen,
Wobei ihm die SED-Säuberer teilweise die gleichen Fragen stellen, die ihm ein paar Jahre zuvor die Gestapo gestellt hat: Mit wem er in Moskau 1936 Kontakt gehabt habe, in wessen Auftrag er 1937 nach Spanien gegangen sei und so weiter."
Mehrere enge Freunde von Busch wurden im Zuge der kommunistischen Säuberungswellen Ende der 30er-Jahre in Moskau ermordet. So Michael Kolzow, Korrespondent der Prawda im spanischen Bürgerkrieg und lange Jahre führendes Mitglied der "Internationalen Vereinigung Revolutionärer Schriftsteller", 1940 in Moskau erschossen; so Kolzows Lebensgefährtin Maria Osten, Journalistin und Schriftstellerin, zeitweise auch Ernst Buschs Geliebte, seit 1926 Mitglied der KPD. Sie wurde am 8. August 1942 im sowjetischen Exil wegen angeblicher Spionage hingerichtet.
Ernst Busch zerriss nach der Befragung durch die SED-Kontrolleure sein Parteibuch. Er erhielt es Jahre später vom Politbüromitglied Kurt Hager zurück, nachdem er seinen Frieden mit dem Regime geschlossen hatte. Im Alter nämlich arrangierte sich der große Schauspieler und Sänger, dem Ulbricht in geheimen Moskauer Dossiers 1937 anarchistische Neigungen nachgesagt hatte, mit der DDR. Biermanns Ausbürgerung begrüßte er öffentlich im ‘Neuen Deutschland’.
Im Juni 1980 nahmen Erich Honecker und andere SED-Größen an der Beerdigung von Busch teil. Vom Band erklang seine Stimme mit den Liedzeilen:
"Wenn das Eisen mich mäht,
Wenn mein Atem vergeht,
Sollt stumm unterm Rasen mich breiten."
Jochen Voit: Er rührte an den Schlaf der Welt. Ernst Busch – die Biografie
Aufbau Verlag, Berlin/2010
Sein Gesicht war halbseitig gelähmt. Als politischer Häftling im Moabiter Gefängnis war er bei einem Luftangriff auf Berlin schwer verletzt worden. Die Gefangenen durften nicht in den Luftschutzkeller und blieben während der Bombardements in ihren Zellen eingesperrt. Als Busch im Moabiter Krankentrakt wieder zu Bewusstsein kam, glaubte er, nie wieder singen zu können. Mit seinem Comeback als Sänger begann 1946 sein Aufstieg zum Superstar der DDR.
Jochen Voit erzählt erstmals die ganze Geschichte des großen Schauspielers und Interpreten Ernst Busch. Die 1987 in der DDR erschienene opulente "Biografie in Texten, Bildern und Dokumenten" hatte viele Details aus Buschs Leben verschwiegen, die nicht in das heroische SED-Weltbild passten. Der Weg des Kieler Arbeiterjungen zum Stalin-, Lenin- und Nationalpreisträger der DDR verlief nämlich keineswegs so geradlinig, wie es die DDR-Biografie glauben machte.
Busch, der, wenn es ihm angebracht schien, ein ziemlicher Querkopf sein konnte, war in den 50er-Jahren mehrfach mit der SED aneinandergeraten. Die Zensur kannte auch für den von Busch gegründeten Musikverlag "Lied der Zeit" kein Pardon. Man warf ihm "Proletkult", ja sogar "Formalismus" und "Kosmopolitismus" vor, was so ziemlich die schlimmsten Abweichungen von der sozialistischen Kunstpolitik jener Zeit waren.
Wegen der Verbreitung von "anglo-amerikanischer Tanzmusik" hatte sich Walter Ulbricht persönlich in einem Brief an Busch gewandt und für die "Ausschaltung" solcher Produktionen ausgesprochen.
"Die Staatliche Kommission für Kunstangelegenheiten rügt an Busch weiterhin ‘rechtsopportunistische Tendenzen’, zumal wenn er Lieder singt ‘mit der Absicht, den USA-Imperialismus zu karikieren’: Der Song ‘Ami go home!’ zum Beispiel enthalte ‘ganze Strecken heißester Jazzmusik’. Diese Feststellung ist besonders bemerkenswert, weil es sich hier um eine der beiden Busch-Platten handelt, die es in der Nachkriegszeit zu echter Popularität bringen. Das patriotische Lied ist 1951 während der Weltfestspiele in Berlin massenhaft verbreitet und zum Hit geworden."
Bertolt Brecht intervenierte zugunsten von Ernst Busch und seines musikalischen Bearbeiters Hanns Eisler beim FDJ-Vorsitzenden Erich Honecker im Zusammenhang mit dem erfolgreichen "Ami-go-home"-Lied:
"Wo es erwähnt wird in der Presse, wird meistens, auch im ‘Neuen Deutschland’, weder der Name Eisler noch der Name Busch erwähnt. Und es handelt sich da doch um eine kleine Feder in der Kappe der DDR! Wie soll Busch außer einer Tatsache auch noch ein Begriff der FDJ werden? Können Sie helfen?"
Erich Honecker, der wie Busch während der Nazizeit im Zuchthaus Brandenburg gesessen hatte, konnte oder wollte nicht helfen. Viele Jahre später, nachdem er es zum SED-Chef gebracht hatte, gerierte er sich als Buschs Freund. 1952 musste der sich einer peinlichen Befragung durch Parteikontrolleure unterziehen,
Wobei ihm die SED-Säuberer teilweise die gleichen Fragen stellen, die ihm ein paar Jahre zuvor die Gestapo gestellt hat: Mit wem er in Moskau 1936 Kontakt gehabt habe, in wessen Auftrag er 1937 nach Spanien gegangen sei und so weiter."
Mehrere enge Freunde von Busch wurden im Zuge der kommunistischen Säuberungswellen Ende der 30er-Jahre in Moskau ermordet. So Michael Kolzow, Korrespondent der Prawda im spanischen Bürgerkrieg und lange Jahre führendes Mitglied der "Internationalen Vereinigung Revolutionärer Schriftsteller", 1940 in Moskau erschossen; so Kolzows Lebensgefährtin Maria Osten, Journalistin und Schriftstellerin, zeitweise auch Ernst Buschs Geliebte, seit 1926 Mitglied der KPD. Sie wurde am 8. August 1942 im sowjetischen Exil wegen angeblicher Spionage hingerichtet.
Ernst Busch zerriss nach der Befragung durch die SED-Kontrolleure sein Parteibuch. Er erhielt es Jahre später vom Politbüromitglied Kurt Hager zurück, nachdem er seinen Frieden mit dem Regime geschlossen hatte. Im Alter nämlich arrangierte sich der große Schauspieler und Sänger, dem Ulbricht in geheimen Moskauer Dossiers 1937 anarchistische Neigungen nachgesagt hatte, mit der DDR. Biermanns Ausbürgerung begrüßte er öffentlich im ‘Neuen Deutschland’.
Im Juni 1980 nahmen Erich Honecker und andere SED-Größen an der Beerdigung von Busch teil. Vom Band erklang seine Stimme mit den Liedzeilen:
"Wenn das Eisen mich mäht,
Wenn mein Atem vergeht,
Sollt stumm unterm Rasen mich breiten."
Jochen Voit: Er rührte an den Schlaf der Welt. Ernst Busch – die Biografie
Aufbau Verlag, Berlin/2010
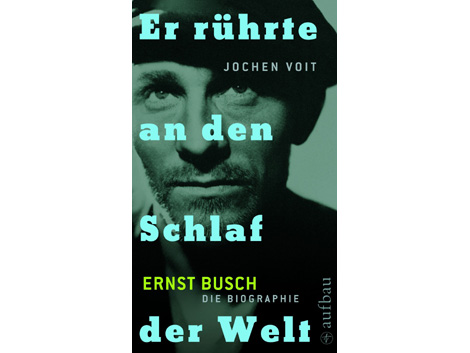
Cover: "Er rührte an den Schlaf der Welt. Ernst Busch – die Biografie" von Jochen Voit© Aufbau Verlag, Berlin
