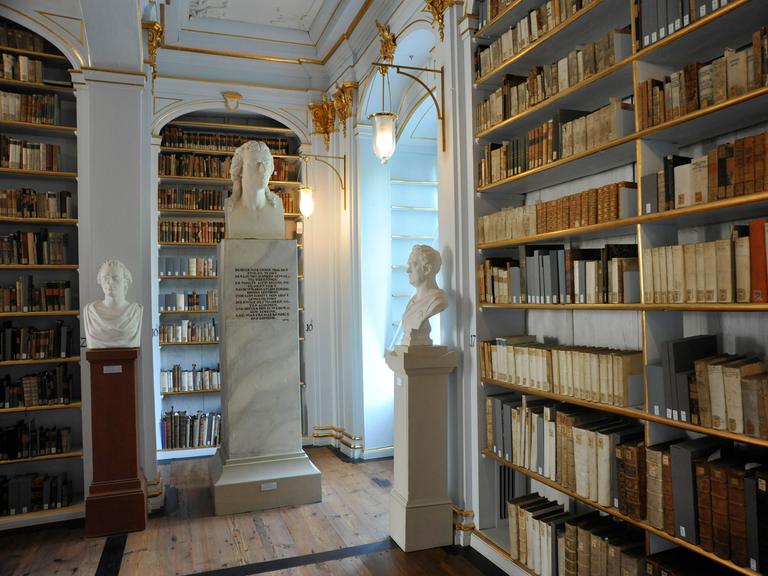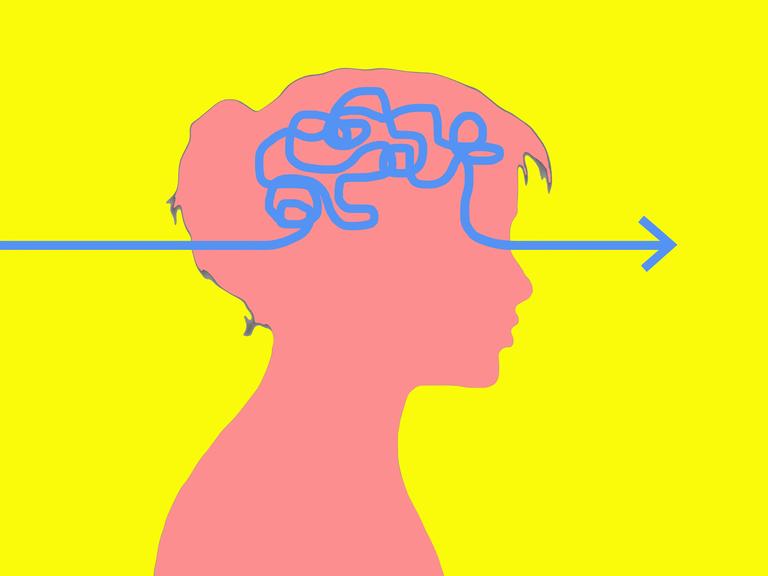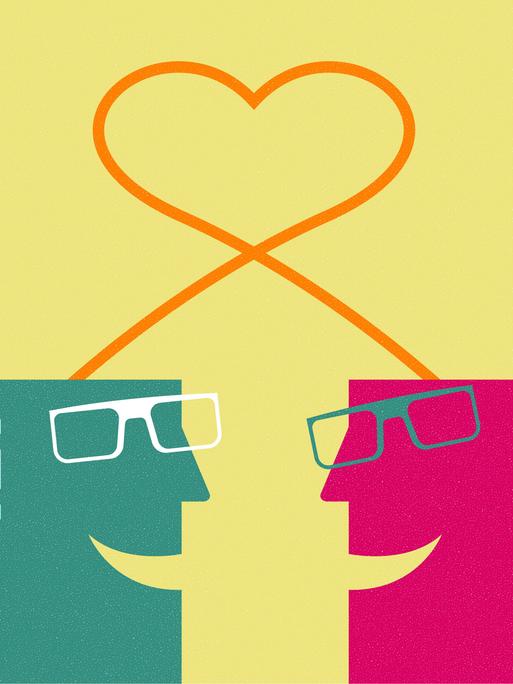Kommentar

Demokratie lebt vom Streit um das bessere Argument. Aber Streit braucht Regeln – sonst endet er in Zerstörung, meint Jessica Hamed © picture alliance / Zoonar / scusi
Sozialer Frieden braucht eine respektvolle Streitkultur
04:48 Minuten

Von Corona bis Migration – der Hang zu Streit und Spaltung in Deutschland scheint ungebrochen. Dagegen hilft nur eines: weg von der Empörungskultur, hin zu respektvollen und ehrlichen Debatten.
Corona, Krieg, Migration – um nur drei Themen zu nennen, die die deutsche Gesellschaft seit Jahren spalten. Der „Empörialismus“, vor dem Michael Schmidt-Salomon seit Jahren warnt, hat Hochkonjunktur.
Besserung? Nicht in Sicht. Die Freude an der Empörung, am destruktiven Streit, am Hass ist zu groß. Social Media wirkt hier wie ein Verstärker, keine Frage.
„Hate Speech“ sollte aber kein Fall für die Strafjustiz sein, sondern für die Gesellschaft. Die strafrechtliche Verfolgung von Meinungen – auch wenn sie hasserfüllt sind – schadet mehr, als sie nützt. Es mag den einen oder die andere zum Schweigen bringen, aber nicht von ihren Ressentiments abbringen. Jede unverhältnismäßige Reaktion des Rechtsstaats, etwa die Hausdurchsuchung wegen der Bezeichnung eines Bundesministers als „Schwachkopf“ oder die Verurteilung wegen eines Memes, in dem eine Bundesministerin ein verfälschtes Schild mit der Aufschrift „Ich hasse die Meinungsfreiheit“ hält, kostet Vertrauen.
Den Dialog suchen, anstatt auszugrenzen
Nutznießer eines solchen Vertrauensverlustes sind populistische und extremistische Parteien und Bewegungen. Der Staat und seine Institutionen werden zum Feind, genauso wie die – vermeintliche – Mehrheitsgesellschaft. Obwohl diese Dynamik offensichtlich ist, wird die Eskalationsspirale unter dem Stichwort „wehrhafte Demokratie“ weitergedreht. So, dass die wehrhafte Demokratie ihrerseits zur Bedrohung der Demokratie wird. Statt reflexhaft Andersdenkende auszugrenzen, wie es in erheblichem Ausmaß etwa bei Coronamaßnahmen-Kritikerinnen und -Kritikern der Fall gewesen ist, aber auch beim Thema Migration, sollte der Dialog gesucht werden.
Haltung zeigen bedeutet nicht, andere Menschen – schon gar nicht aus einer Machtposition heraus, etwa als führende Politikerin oder reichweitenstarker Journalist – zu verächtlichen oder zu beschimpfen. Haltung zeigen heißt, zur eigenen Meinung zu stehen und bei sich zu bleiben. Dafür braucht es keinen sozialen Pranger. Ein Beispiel: Antifaschismus drückt sich in eigenen Positionen und Handlungen aus, nicht durch das Beschimpfen anderer als Faschisten, um sich selbst moralisch zu erhöhen.
In der Sache streiten, die Personen achten
Das betrifft auch den sprichwörtlichen Elefanten im Raum: den Umgang mit der AfD und ihren Wählerinnen und Wählern. Auf Herabwürdigung zu setzen, wie es Teile der etablierten Politik tun, ist weder zielführend noch im demokratischen Diskurs akzeptabel. Eine resiliente Demokratie muss auch hier Gesprächsangebote machen, ohne ihre Prinzipien preiszugeben – klare Abgrenzung in der Sache, bei gleichzeitiger Achtung der Person.
Abgesehen davon, dass das ein Gebot des menschlichen Miteinanders ist, ist ein solches Vorgehen auch unerlässlich, um den sozialen Frieden wiederherzustellen. Weg vom „Alternativ-Radikalismus“, wie Hans Albert schon vor Jahrzehnten die Dominanz von Extrempositionen in der Öffentlichkeit kritisierte, hin zu einer rationalen Streit- und Gesprächskultur.
Wie lässt sich das erreichen? Durch Gespräch! Im Alltag, auf Podien, in den sozialen Medien.
Eine Anregung, wie ein wohlwollender Diskurs gelingen kann, liefert die Gesprächstherapie nach Carl Rogers. Ihre Grundsätze lauten:
Eine Anregung, wie ein wohlwollender Diskurs gelingen kann, liefert die Gesprächstherapie nach Carl Rogers. Ihre Grundsätze lauten:
Erstens: Empathie! Die Fähigkeit, die Welt mit den Augen des anderen zu sehen.
Zweitens: Wertschätzung! Auch die abweichende und unbequeme Meinung respektieren.
Drittens: Echtheit! Keine Floskeln, sondern ehrliche Worte.
Demokratie lebt vom Streit um das bessere Argument
Nicht Harmonie ist das Ziel. Demokratie lebt vom Streit um das bessere Argument. Aber Streit braucht Regeln – sonst endet er in Zerstörung, statt in Fortschritt.
Die Republik auf der Couch: Die Couch steht für die Bereitschaft zur Reflexion – über Ängste, Fehler und Widersprüche zu sprechen, anstatt sie zu verdrängen. Sie steht für die Suche nach Wahrhaftigkeit in einem geschützten Raum.
Mehr Gespräch wagen, heißt zuzuhören, auch wenn andere schreien; sachlich bleiben, wo Polemik lauert; den Dialog fortführen, wo Abbruch droht. Nur so wird sich die erschöpfte Republik wieder von der Couch erheben und sich den multiplen Herausforderungen dieser Zeit stellen können. Denn Demokratie muss geübt, verteidigt und gelebt werden – jeden Tag.