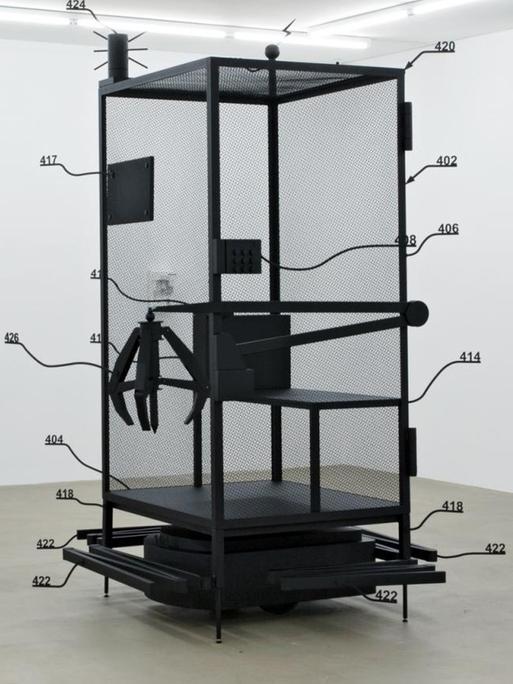Dienstmädchen ohne Rechte
21:56 Minuten

Im Libanon arbeiten über 250.000 ausländische Dienstmädchen. Hinter geschlossenen Türen leben sie unter sklavenartigen Bedingungen. Zwar wird dieser Zustand kritisiert, das "Kafala-System" ist aber fester Bestandteil der libanesischen Gesellschaft.
"Zola! Zola!" Aghsan Chabaan gibt ihrem Dienstmädchen Zola Anweisungen für den Tag. Böden wischen, Schränke putzen. Zola nickt still, füllt einen Eimer mit Wasser und wischt den langen steinernen Flur.
Aghsan sitzt breitbeinig im Wohnzimmer ihres kleinen Hauses. Sie lebt schon lange in Nabatiyyeh, im schiitisch geprägten Süden des Libanon. An der Wand in dem schmucklosen Wohnzimmer hängen Bilder ihres verstorbenen Mannes. Sie hat eine Zigarette in der Hand, ascht manchmal in den Mülleimer neben sich, manchmal daneben auf den Steinboden. Immer wieder schaut sie gelangweilt auf ihr Smartphone. Warum sie sich für ein Dienstmädchen aus Äthiopien entschieden hat?
"Die Äthiopier halten viel aus, sie sind stark", sagt sie. "Wenn man sie in sein Haus holt muss man ihnen beibringen, wie man den Haushalt macht. Weil sie nichts darüber wissen, wenn sie hier ankommen. Sie sind dreckig, haben Flöhe, sie wissen nicht, wie man duscht und essen mit ihren Händen. Also muss man ihnen viele Details beibringen über einen langen Zeitraum."
Zola schiebt die Couch zur Seite, wischt den Wohnzimmerboden. Sie trägt ein etwas zu großes blaues T-Shirt mit dem Werbeaufdruck eines Reifenherstellers. Ihr Blick ist hellwach, ihre Haltung aufrecht. Immer mal wieder wirft ihr Aghsan einen kontrollierenden Blick hinüber. Sie selbst arbeitet nicht, ihre beiden Söhne unterstützen sie finanziell und zahlen auch das Dienstmädchen.
Ohne Recht auf eigene Meinung
Vor einem Jahr hat Aghsan die 18-jährige Zola eingestellt. Ihr vorheriges Dienstmädchen hatte sie zurückgeschickt. Nun steht ihr Zola 24 Stunden am Tag zur Verfügung. Jeden Tag. Wir wollen Zola interviewen, aber Aghsan will nicht nur daneben sitzen.
Charlotte Bruneau: "Wir fragen auf Englisch und, wenn sie etwas nicht versteht, …"
Aghsan: "Dann helfe ich. Zola, du kannst zum Beispiel sagen: ‚Du bist hierhingekommen, dir geht es gut hier, Mama ist gut zu mir, sowas halt.‘"
Stephanie Rohde: "Was ist der Unterschied zu deinem früheren Leben, trägst du zum Beispiel die gleichen Klamotten?"
Aghsan: "Mama hat mir gute Klamotten gegeben hier, sag das so."
Zola: "Ok."
Aghsan: "Dann helfe ich. Zola, du kannst zum Beispiel sagen: ‚Du bist hierhingekommen, dir geht es gut hier, Mama ist gut zu mir, sowas halt.‘"
Stephanie Rohde: "Was ist der Unterschied zu deinem früheren Leben, trägst du zum Beispiel die gleichen Klamotten?"
Aghsan: "Mama hat mir gute Klamotten gegeben hier, sag das so."
Zola: "Ok."
Wir schlagen vor, dass Zola die Fragen auf ihrer Muttersprache Amharisch beantwortet. Sie erzählt, dass sie hier ein gutes Leben führt. Aghsan wird unruhig, will wissen, was Zola gerade ins Mikrofon gesagt hat.

Vor einem Jahr hat Aghsan die 18-jährige Zola eingestellt.© Charlotte Bruneau
Am Nachmittag nimmt uns Aghsan mit zu ihrer Agentur, einer von rund 500 Agenturen im Libanon, die Dienstmädchen gegen eine Kommission vermitteln. Aghsan musste früher öfter hierherkommen, erzählt sie, weil sie so viele Probleme mit ihrem letzten Dienstmädchen hatte.
Eine Art Menschenhandel
Die junge Agentin mit knallrotem Lippenstift führt uns in ihr Büro und sucht nach dem Katalog mit den Frauen, die sie hier vermittelt.
"Wir handeln hier mit Menschen, so kann man es ausdrücken", sagt sie. "Wenn du ein Mädchen bekommst, weißt du nichts über sie. Jedes Mädchen ist anders. Wenn unsere Kunden ein Mädchen wollen, zeige ich ihnen zuerst viele Fotos. Und ich erzähle ihnen etwas über die Mädchen, diese mag Kinder, jene Gartenarbeit."
Die Agentin kann den Katalog nicht finden, legt stattdessen Kopien von Reisepässen auf den Tisch. Die Arbeitsmigrantinnen sind kaum älter als 18.
"Ich finde es besser, wenn sie keine Kinder hat", sagt Aghsan. "Dann richtet sie sich eher bei dir ein. Diejenigen mit Kindern fangen nach einer Zeit an zu weinen, sie wollen sie dann besuchen. Die denken, sie können hierherkommen und dann einfach wieder gehen, wenn sie wollen. Aber so läuft das hier nicht."
Weit unter dem libanesischen Mindestlohn
Deshalb hat sich auch Aghsan für die kinderlose Zola entschieden – und weil Dienstmädchen aus Äthiopien relativ günstig sind: 200 Dollar im Monat. Frauen aus den Philippinen und Sri Lanka verdienen 300 Dollar im Monat. Sie sind am teuersten. Auch wenn ihre Gehälter immer noch weit unter dem libanesischen Mindestlohn von 450 Dollar liegen.
Die Agentin verweist darauf, dass die Arbeitgeberinnen neben dem Lohn auch Nahrung und Kleidung für die Frauen kaufen und ihre Aufenthaltserlaubnis bezahlen. Allein für die Einreise müsse man bis zu 3000 Dollar investieren– natürlich erwarte die Kundin dann auch, dass die Dienstmädchen dementsprechend lange blieben.
"Das Wichtigste ist, dass du ihren Reisepass, ihre Aufenthaltspapiere und die Arbeitserlaubnis versteckst", sagt die Agentin. "Du musst verhindern, dass sie das Haus verlässt, solange der Vertrag läuft. In den ersten sechs Monaten solltest du sie niemals allein im Haus lassen. Wenn du raus gehst, schließ sie ein. Sie sollte mit niemandem sprechen, auch nicht mit anderen Dienstmädchen. Die könnten sie nämlich dazu verleiten, wegzulaufen, oder um einen freien Tag zu bitten, oder darum, telefonieren zu dürfen."
Arbeitsvertrag bleibt Auslegungssache
Was das Dienstmädchen tun oder nicht tun darf, entscheidet die Arbeitgeberin. Idealerweise wird das auch vertraglich festgehalten. Die Agentin zeigt ein Beispiel, wie so etwas aussehen kann.
"Sie arbeitet von 8 bis … ach, in diesem Vertrag haben sie das gar nicht genau angegeben", sagt sie. "Aber dafür steht hier, dass der Arbeitgeber dem Mädchen erlauben muss, mit ihrer Familie zu telefonieren und dafür zahlen muss. Normalerweise darf das Mädchen einmal pro Woche oder alle zwei Wochen anrufen. Aber in diesem Vertrag hier steht einmal im Monat."
Der Vertrag zwischen Arbeitgeberin und Arbeitnehmerin ist wichtig, stimmt Aghsan zu. Aber entscheidend sei die eigene Autorität im Haus – und wie man sie durchsetze.
"Jede Frau geht damit anders um", sagt Aghsan. "Ich mag es nicht, sie zu schlagen. Aber wenn meine Freundinnen es mögen, dann ist es ihr Problem. Ich mische mich da nicht ein. Vielleicht hat das Mädchen es verdient. Und einigen von ihnen macht es nichts aus, geschlagen zu werden. Sie sagen, egal, schlag mich. Jedes Haus hat sein eigenes System. Als mein ehemaliges Dienstmädchen etwas Schlimmes getan hat, habe ich sie einfach in die Agentur gebracht. Sie hat sich danebenbenommen, und die haben sie geschlagen. Ich habe nur darum gebeten, sie nicht vor meinen Augen zu schlagen, also haben sie sie in ein anderes Zimmer gebracht und dort geschlagen. Danach habe ich sie nicht zurückgenommen, ich wollte sie nicht mehr. Lass mich in Ruhe!"
Die Agentin sagt, davon wisse sie nichts.
Berichte von alltäglicher Gewalt
Mehrere Dienstmädchen berichten uns, dass Gewalt vor allem im Haushalt alltäglich ist, so auch Tsigereda.
"Normalerweise bleibt die Hausherrin immer zu Hause mit ihren Helferinnen", sagt sie. "Sie kann sie jederzeit schlagen, wenn sie einen kleinen Fehler entdeckt. Manche geben sie ihren Helferinnen nicht genug zu essen."
Tsigereda trägt eine weite Jeans, weiße Sneaker und ein lockeres T-Shirt, dazu ein Basecap. Ihre Schultern wirken kräftig. Sie sitzt in einem Klassenzimmer im Migrant Community Center in Beirut. Am Abend können Dienstmädchen hier Englisch oder Arabisch lernen, wenn ihre Arbeitgeber sie denn rausgelassen.
Tsigereda spricht distanziert über ihr früheres Leben als Dienstmädchen: "Sie lassen dich nicht die Kleidung tragen, die du tragen möchtest. Vielleicht, weil sie befürchten, du könntest damit ihren Ehemann anmachen. Sie muss aussehen wie eine Sklavin. Wir leben im Jahr 2019, aber das ist wie im Mittelalter."
Besen statt Studium
Vor sechs Jahren ist sie aus Äthiopien nach Beirut gekommen – man hatte ihr ein Studium hier versprochen. Stattdessen wurde ihr ein Besen in die Hand gedrückt. Mehr als drei Jahre lang hat Tsigereda das über sich ergehen lassen, dann ist sie weggerannt und lebt nun illegal in Beirut, wie so viele, die sich hier im Zentrum engagieren.
Im Büro nebenan arbeitet Rahaf Dandash. Die libanesische Aktivistin kämpft seit Jahren dafür, Gewalt gegen Dienstmädchen aufzuklären. Pro Woche stirbt ein Dienstmädchen, warum, untersucht die Polizei meistens nicht, sagt sie.
"Die Tatsache, dass das System Missbrauch begünstigt und die Taten nicht ahndet und dass die Polizei sich darum nicht kümmert und teilweise selbst Dienstmädchen missbraucht, ist sehr problematisch, weil wir auf allen Ebenen gleichzeitig arbeiten müssen", sagt Rahaf Dandash.
Die Aktivistinnen versuchen, das Thema ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu bringen. Im Eingangsbereich des Migrant Community Centers zeigt uns das ehemalige Dienstmädchen Tsigereda Fotos von den Protesten.
"Das hier sind Fotos, wo wir gegen das Kafala-System demonstriert haben", sagt sie. "auch hier, jedes Jahr, 2016, 17, 18 und das ist dieses Jahr."
2015 sind die Aktivistinnen zum ersten Mal auf die Straße gegangen, um für ihr Recht zu demonstrieren, sich zu organisieren. Bis heute gibt es im Libanon keine Gewerkschaft für ausländische Haushaltshilfen.
Sonderrechte für Ausländer
In einem unscheinbaren Bürogebäude treffen wir Hicham Al Bourji, bis vor kurzem war er der Sprecher des libanesischen Verbands der Agenturen für ausländische Haushaltskräfte. Rund 300 der 580 Agenturen sind darin organisiert. Al Bourji sitzt zurückgelehnt in seinem schwarzen Bürostuhl, sein Hemd spannt über dem Bauch.
"In 25 Jahren hatte ich nie einen Selbstmordfall", sagt er. "Vielleicht mal einen Schlag, einen Stoß, aber dann lassen wir die Arbeiterinnen nicht mehr zurück in das Haus, sie bekommen ihre Rechte."
Was er nicht sagt: Ausländische Haushaltshilfen fallen nicht unter das nationale Arbeitsrecht. Daher genießen die Dienstmädchen auch keinen Arbeitsschutz. Was im Haus passiert, ist Privatangelegenheit.
Dass jede Woche ein Dienstmädchen im Job zu Tode kommt erklärt Al Bourji so: "Äthiopier, ihre Kultur, Sie müssen sich nur ihre Kultur anschauen. Sich selbst umzubringen bedeutet dort gar nichts. Sie haben keine Geduld, sie sind sehr wütende Menschen."
Mit dem System oder den Arbeitsbedingungen habe das nichts zu tun. Das hören wir während der Recherche öfter. Für die Arbeitsmigrantinnen ist der Rassismus alltäglich.
Vor dem Haupteingang der evangelischen Kirche warten Libanesen, Kenianerinnen und Philippinas auf den Gottesdienst – beziehungsweise die Gottesdienste.
Alma hat Tränen in den Augen
"Hier findet der Gottesdienst für Briten, Libanesen, Europäer statt", sagt Alma. "Unten haben wir unseren Pastor aus den USA. Für uns, also die Philippinas und Kenianerinnen. Also, wollen wir runter gehen?"
Alma kommt seit vielen Jahren jeden Sonntag zum Gottesdienst in den Mehrzweckraum im Keller. Die einzigen Weißen sind Pastor Luis und seine Familie aus den USA. Während seiner Predigt weinen einige Frauen still, auch Alma hat Tränen in den Augen. Luis erinnert die Dienstmädchen daran, wie wichtig Dienen im Christentum ist.
"Jesus hat sich hingekniet und die Füße seiner Jünger gewaschen", sagt Father Luis. "Das ist Demut. Das ist ein wahrer Diener und ein wahrer König. Ein dienender Führer und ein dienender König. Wenn wir dienen, dann tun wir das nicht für den Applaus, wir tun es für unsere Familien und Jesus."
Alma mag die Predigten des evangelikanischen Pastors. Nach dem Gottesdienst gehen einige jüngere Philippinas noch zum Karaoke. Alma hat noch nie davon gehört. Sie lebt schon seit Anfang der 90er-Jahre hier, aber kennt sich kaum aus in Beirut.
Wie viele Arbeitsmigrantinnen hat sie die Philippinen verlassen, um ihre Kinder finanziell zu unterstützen, die bei den Großeltern aufgewachsen sind. Anstelle ihrer eigenen Kinder hat sie die Kinder ihrer libanesischen Arbeitsgeber aufgezogen, da beide tagsüber gearbeitet haben.
Teil der Familie, aber auch nicht
"Ich bin die Mutter der Kinder", sagt Alma. "Wenn sie in der Schule einen Familienstammbaum malen sollten, malten sie ein Bild mit sechs. Warum sechs Menschen, fragte der Lehrer. - Das hier ist Alma, unsere Nanny, unsere Zweitmutter. Das berührt mich sehr."
Dafür habe sie aber auch immer wieder den Neid ihrer Arbeitgeberin zu spüren bekommen, erzählt Alma. Ihr Verhältnis zur Familie wurde von der Arbeitgeberin nie geklärt.
"Sie sagte mir, dass ich Teil der Familie bin", erzählt Alma. "Aber dann hat sie mich einmal gesehen, als ich gerade im Esszimmer geputzt habe und mich hingesetzt habe, weil ich eine wichtige Nachricht von meiner Tochter bekommen habe. Meine Madame sagte daraufhin, ich solle nicht dort sitzen, es sei ihr Haus, ich solle es nicht unordentlich machen, ich hätte kein Recht hier zu sitzen. Ich antwortete: Madame, ich respektiere Sie, bitte respektieren Sie mich auch, obwohl ich ihre Dienerin bin. Sie sagte: Nein: Du bist nicht meine Dienerin. Du gehörst zur Familie. - Nein, habe ich gesagt, sie behandeln mich nicht als Familienmitglied – nur als Dienerin, als Sklavin."
Alma hat oft kein Essen bekommen
Die Beziehung zwischen libanesischen Arbeitgeberinnen und ihren Dienstmädchen ist kompliziert. Viele Frauen scheuen offene Konflikte – denn das Dienstmädchen könnte sich dann an den Kindern rächen. Stattdessen versuchen sie, die Dienstmädchen emotional zu manipulieren oder zu bestrafen. Alma beispielsweise hat oft kein Essen bekommen.
Wir sind angekommen in der Karaokebar. Hinter einem kleinen Geschäft in einer Art Markthalle steigen Alma und ein paar jüngere Philippinas eine Treppe hoch. Der enge Raum im Zwischengeschoss wird für ein paar Stunden zu einer Art Heimat philippinischer Arbeitsmigrantinnen. Es ist schwül, es wird getanzt, eine kleine rundliche Frau kocht Fischgerichte mit Reis auf einer mobilen Herdplatte.
Alma schaut auf den Boden, während sie "I am on the Top of the World" singt. Neben ihr auf dem pinkfarbenen Plastiktisch stehen gelbe Plastikblumen.
Alma hat es so lange im Libanon ausgehalten, weil ihr die Kinder der Familie, in der sie arbeitet, so ans Herz gewachsen sind. Ihre eigenen Kinder auf den Philippinen wiederrum werfen ihr vor, nicht für sie dagewesen zu sein.
Alma sagt, sie habe ihr Leben geopfert, damit ihre Kinder ein besseres Leben hätten als sie selbst. Sie hätten nun immerhin ein Stück Land, ein Haus und könnten auf die Universität gehen. Wenn sie eines Tages zurückgeht, so hofft sie, hat sie selbst auch ein besseres Leben als davor.
Kritik am Kafala-System ohne Konsequenzen
Das sogenannte Kafala-System ist im Libanon inzwischen immer mehr in die Kritik geraten.
Najwa begrüßt uns in ihrer Wohnung in einem sunnitisch geprägten Stadtteil von Beirut. Sie serviert Tee auf einem silbernen Tablett. Über der Couch prangt ein Teppichgemälde der Kaaba in Mekka. Ihr Sohn Mustafa forscht an der Amerikanischen Universität in Beirut.

Als Arbeitgeberin trage sie die Verantwortung für ihr Dienstmädchen, sagt Najwa.© Charlotte Bruneau
"Ich habe meiner Mutter gesagt, das Dienstmädchen sollte einen oder zwei Tage in der Woche frei haben, damit sie rausgehen kann, wann sie will und wohin sie will", sagt er. "Die Idee war ja, dass wir jemanden haben, der für uns arbeitet und kein Sklave ist."
Najwa gehört zur Mittelklasse im Libanon, hat lange als Lehrerin gearbeitet – und war auf ein Dienstmädchen angewiesen.
"Wir haben viel darüber diskutiert, weil ich tatsächlich nicht wollte, dass sie raus geht, als sie niemanden hier kannte", sagt sie. "Ich hatte Angst um sie, weil es Menschen gibt, die nichts Gutes im Schilde führen. Einige organisieren sich, um die Mädchen zu kidnappen und als Prostituierte zu verkaufen. Also war ich dagegen, sie rauszulassen, weil ich die Verantwortung für sie trage."
Mustafa schüttelt den Kopf.
"Haushaltshilfen werden an den gleichen Erwartungen gemessen wie Muslime", sagt er, "selbst wenn die Kinder im selben Haus diesen Erwartungen nicht entsprechen müssen. Meine Schwester beispielsweise kann die Wohnung verlassen, wann sie will und einen Freund haben. Aber die Dienstmädchen dürfen das Haus an den meisten Tagen nicht verlassen."
"Man muss sie beschützen!"
Najwa verweist darauf, dass sie im Kafala-System als Arbeitgeberin verantwortlich ist für das Dienstmädchen. "Das ist ein ausländisches Mädchen", sagt sie, "was hierhinkommt und nichts weiß und niemanden kennt. Man muss sie beschützen!"
Mustafa: "Mutter, sie ist eine Erwachsene! Sie ist eine Angestellte, keine Sklavin!"
Najwa: "Aber sie kennt niemanden hier, das ist das Problem!"
Mustafa: "Na dann lernt sie halt jemanden kennen! Tinder!"
Najwa: "Schluss jetzt, dann wird sie die falschen Leute treffen. Bei meiner Tochter weiß ich, wen sie datet."
Mustafa: "Na dann frag sie! Wir haben hier unsere Differenzen…"
Najwa: "Aber sie kennt niemanden hier, das ist das Problem!"
Mustafa: "Na dann lernt sie halt jemanden kennen! Tinder!"
Najwa: "Schluss jetzt, dann wird sie die falschen Leute treffen. Bei meiner Tochter weiß ich, wen sie datet."
Mustafa: "Na dann frag sie! Wir haben hier unsere Differenzen…"
So wie Mustafa und seine Mutter diskutieren inzwischen auch andere mit ihren Eltern über die Dienstmädchen in ihren Familien.
Die Studentin Samantha aus dem Migrant Community Center zum Beispiel. Seitdem sie Arbeitsmigrantinnen ehrenamtlich Arabisch beibringt denkt sie anders über das Kafala-System als früher.
"Ich denke nicht, dass es so sehr um den Umgang geht, sondern mehr die Mentalität", sagt sie "Wie konnte ich unser Dienstmädchen so lange nicht als Menschen sehen! Ich habe sie nie beschimpft, aber das habe ich nur getan, weil man eben niemanden beschimpft. Aber das heißt nicht, dass ich sie automatisch als Menschen gesehen habe."
Samantha hat ihre Einstellung geändert. Aber das Leben der Dienstmädchen zu verbessern müsse man mehr tun. Andere wirtschaftliche Anreize setzen zum Beispiel, meint Roula Hamati von der Menschenrechtsorganisation INSAN – Allerdings sei das sehr schwierig.
Suche nach Alternativen zum Kafala-System
"Wenn du ein Dienstmädchen anstellst und angemessene Arbeitsbedingungen schaffst, was auch begrenzte Arbeitszeit und einen Lohn bedeutet, dann ist das für viele libanesische Familien nicht mehr bezahlbar", sagt Roula Hamati. "Deshalb hat der Staat auch keinen ernsthaften Anreiz, diesen Sektor zu regulieren, weil, was für eine Alternative zu Dienstmädchen könnte der Staat den libanesischen Frauen anbieten, die arbeiten wollen?"
Auch Samantha ist skeptisch, dass sich schnell etwas ändert – aber sie appelliert an alle ihre Freunde, die Eltern auf die Problematik des Kafala-System hinzuweisen.
"Wenn du aufwächst mit einem Vater, der deine Mutter schlägt, dann denkst du, dass das normal ist", sagt sie. "Man normalisiert alles. Wir haben eben diese Arbeiterinnen in unseren Häusern normalisiert. Sie werden unsichtbar, sie waren nie wichtig, warum sollten wir jetzt aufwachen? Ich denke, sogar wenn wir das Kafala-System abschaffen, wird es ein paar Jahrzehnte dauern, sich daran zu gewöhnen."