Das Diktat der Mütter
Deutschland hat die weltweit niedrigste Geburtenrate - weil das Ideal der "guten Mutter" herrscht. Elisabeth Badinter fordert, dass Familienpolitik stärker auf Frauenwünsche abgestellt wird und eine grundlegende feministische Reform der Arbeitswelt.
Französinnen sind anders, völlig anders als deutsche Frauen. Französinnen haben seit Jahrhunderten ihre Kinder bei Ammen abgegeben – dies war ein Zeichen der Vornehmheit. Heute machen sie sich durch Fläschchennahrung früh unabhängig, gehen bald nach der Geburt wieder zur Arbeit und finden das Stillen unästhetisch und unweiblich. Dank der kostenlosen Kindergärten, der flexiblen Familienkonstellationen und ihrer Weltmeisterschaft im Verhüten bekommen die Französinnen EU-weit die meisten Kinder, obwohl sie die höchste Erwerbstätigenrate haben.
Deutschland hat die weltweit niedrigste Geburtenrate, obwohl, präziser gesagt: Weil hier das Ideal der "guten Mutter" herrscht. Das beinhaltet, dass Frauen möglichst 6 bis 24 Monate stillen. Die deutsche Mutter fühlt sich nicht mehr nur für das leibliche und seelische Wohl, sondern auch für das emotionale, geistige und intellektuelle ihres Kindes zuständig. Je weniger Kinder, desto größer der Erwartungsdruck. Denn bleibt eine deutsche Mutter wegen dieses Kindes und nicht vorhandener Kindergartenplätze zu Hause, opfert sie sich also auf, mutiert ihre Mutterschaft zu ihrem Lebenssinn. Verknüpft mit massiven Schuldgefühlen in alle Richtungen: Wehe dem Ehemann und wehe dem unperfekten Kind, welches diesen mütterlichen Anforderungen nicht entspricht!
"Die deutsche Mutter steht für ein mythisches Bild der sich aufopfernden, aber zugleich allmächtigen Mutter ... Die Kehrseite ist jedoch, dass sie sich als Gefangene einer Rolle wiederfanden, die sie quasi unter Hausarrest stellte ... Wie so oft, erfuhren die Töchter keine Solidarität von ihren Müttern ... (nur) die moralische Verpflichtung zu einer Mutterrolle, ... die die Quintessenz ihrer Existenz darstellte."
Die Autorin kommt aus dem feministischen Lager der Simone de Beauvoir, die einem Kulturalismus anhing, das heißt für die Befreiung von Zwängen der Natur kämpfte. Seit den 1970er Jahren kritisiert Badinter eine Rückkehr zur Natur in den Diskursen zur Ökologie, Verhaltenswissenschaft und in einer 180-Grad-Wendung des Feminismus.
Gute Mütter sind seitdem wieder stillende Mütter nach einer Hausgeburt ohne medikamentöse Erleichterungen und mit Mehrfachwindeln, die ihr Kind jahrelang im Elternbett schlafen lassen. Manche Ehe wird damit zwar zerstört, aber dem Kind wird gehuldigt. Ein neues Paradox: Die meisten europäischen Frauen haben sich von der Herrschaft der Männer befreit, um sich freiwillig der Herrschaft ihrer Kinder unterzuordnen!
Badinter kritisiert …
"… die Position, die die weibliche Fürsorge der männlichen Ethik der Gerechtigkeit gegenüberstellt. Letztere beruft sich auf das universelle Prinzip der Vorschriften und Rechte ... die Moral der Fürsorge ist vor allem partikularistisch ... Die Mutterschaft allein könne einen Gegenpol zur liberalen männlichen Welt mit ihrem Individualismus, ihrem Egoismus und ihrer Grausamkeit bilden."
Da fragt man sich gemeinsam mit der Autorin, ob die 30 Prozent der deutschen Frauen, die keine Kinder haben, dann der Welt der Grausamkeiten zugeordnet werden müssen?
Die jungen Frauen heute kritisieren als Töchter der feministischen Frauengeneration naturgemäß ihre Mütter. Sie werfen ihnen zu viel Arbeit, zu große tägliche Hast vor und wollen alles anders machen. Das heißt, viele von ihnen lassen sich zwar für 80.000 Euro aus Steuergeldern ein Studium finanzieren, um dann doch zu Hause zu bleiben: Politisch und besonders feministisch uninteressiert, aus Angst vor dem harten Kampf des Arbeitsmarktes und um ihre Kinder zu perfektionieren. Oftmals geraten sie nach Scheidungen völlig ins berufliche Abseits.
Die vielfach verunglimpften Feministinnen der letzten Jahrzehnte haben erreicht, dass Frauen sehr viel mehr Lebensentwürfe verwirklichen können als Männer. Diese haben meist nur die Option Vollzeit zu arbeiten, woran auch die Familienpolitik in den viel gerühmten skandinavischen Ländern wenig änderte. Unterstützt wird dies durch die sogenannten "Still-Ayatollahs":
"'Diese haben ein ausgesprochen traditionelles Verständnis der Vaterrolle ... der Vater muss die Mutter unterstützen und dazu ermutigen, das Baby voll zu stillen'. Doch die neuen, nährenden Väter 'die zur Emanzipation ihrer Frauen beitragen durch die Austauschbarkeit der Rollen konnten den Verfechtern des Stillens und des Mutterinstinktes nicht gefallen.'"
Elisabeth Badinter fordert, dass Familienpolitik stärker auf Frauenwünsche abgestellt wird: Es fehlt eine grundlegende feministische Reform besonders der Arbeitswelt unter Einbeziehung aller Männer und zugunsten aller Varianten. Denn 30 Prozent der Kinderlosen verwirklichen bereits identische Lebensentwürfe.
Die Französinnen zeigen es uns: Vor allem berufstätige, erfolgreiche und zufriedene Frauen wollen viele Kinder. Es sind Frauen, die sich nicht nur über die Mutterschaft definieren, welche ja nur einen Bruchteil eines 85 Jahre währenden Lebens ausmacht.
Elisabeth Badinter: Der Konflikt. Die Frau und die Mutter
C.H. Beck, München 2010
Deutschland hat die weltweit niedrigste Geburtenrate, obwohl, präziser gesagt: Weil hier das Ideal der "guten Mutter" herrscht. Das beinhaltet, dass Frauen möglichst 6 bis 24 Monate stillen. Die deutsche Mutter fühlt sich nicht mehr nur für das leibliche und seelische Wohl, sondern auch für das emotionale, geistige und intellektuelle ihres Kindes zuständig. Je weniger Kinder, desto größer der Erwartungsdruck. Denn bleibt eine deutsche Mutter wegen dieses Kindes und nicht vorhandener Kindergartenplätze zu Hause, opfert sie sich also auf, mutiert ihre Mutterschaft zu ihrem Lebenssinn. Verknüpft mit massiven Schuldgefühlen in alle Richtungen: Wehe dem Ehemann und wehe dem unperfekten Kind, welches diesen mütterlichen Anforderungen nicht entspricht!
"Die deutsche Mutter steht für ein mythisches Bild der sich aufopfernden, aber zugleich allmächtigen Mutter ... Die Kehrseite ist jedoch, dass sie sich als Gefangene einer Rolle wiederfanden, die sie quasi unter Hausarrest stellte ... Wie so oft, erfuhren die Töchter keine Solidarität von ihren Müttern ... (nur) die moralische Verpflichtung zu einer Mutterrolle, ... die die Quintessenz ihrer Existenz darstellte."
Die Autorin kommt aus dem feministischen Lager der Simone de Beauvoir, die einem Kulturalismus anhing, das heißt für die Befreiung von Zwängen der Natur kämpfte. Seit den 1970er Jahren kritisiert Badinter eine Rückkehr zur Natur in den Diskursen zur Ökologie, Verhaltenswissenschaft und in einer 180-Grad-Wendung des Feminismus.
Gute Mütter sind seitdem wieder stillende Mütter nach einer Hausgeburt ohne medikamentöse Erleichterungen und mit Mehrfachwindeln, die ihr Kind jahrelang im Elternbett schlafen lassen. Manche Ehe wird damit zwar zerstört, aber dem Kind wird gehuldigt. Ein neues Paradox: Die meisten europäischen Frauen haben sich von der Herrschaft der Männer befreit, um sich freiwillig der Herrschaft ihrer Kinder unterzuordnen!
Badinter kritisiert …
"… die Position, die die weibliche Fürsorge der männlichen Ethik der Gerechtigkeit gegenüberstellt. Letztere beruft sich auf das universelle Prinzip der Vorschriften und Rechte ... die Moral der Fürsorge ist vor allem partikularistisch ... Die Mutterschaft allein könne einen Gegenpol zur liberalen männlichen Welt mit ihrem Individualismus, ihrem Egoismus und ihrer Grausamkeit bilden."
Da fragt man sich gemeinsam mit der Autorin, ob die 30 Prozent der deutschen Frauen, die keine Kinder haben, dann der Welt der Grausamkeiten zugeordnet werden müssen?
Die jungen Frauen heute kritisieren als Töchter der feministischen Frauengeneration naturgemäß ihre Mütter. Sie werfen ihnen zu viel Arbeit, zu große tägliche Hast vor und wollen alles anders machen. Das heißt, viele von ihnen lassen sich zwar für 80.000 Euro aus Steuergeldern ein Studium finanzieren, um dann doch zu Hause zu bleiben: Politisch und besonders feministisch uninteressiert, aus Angst vor dem harten Kampf des Arbeitsmarktes und um ihre Kinder zu perfektionieren. Oftmals geraten sie nach Scheidungen völlig ins berufliche Abseits.
Die vielfach verunglimpften Feministinnen der letzten Jahrzehnte haben erreicht, dass Frauen sehr viel mehr Lebensentwürfe verwirklichen können als Männer. Diese haben meist nur die Option Vollzeit zu arbeiten, woran auch die Familienpolitik in den viel gerühmten skandinavischen Ländern wenig änderte. Unterstützt wird dies durch die sogenannten "Still-Ayatollahs":
"'Diese haben ein ausgesprochen traditionelles Verständnis der Vaterrolle ... der Vater muss die Mutter unterstützen und dazu ermutigen, das Baby voll zu stillen'. Doch die neuen, nährenden Väter 'die zur Emanzipation ihrer Frauen beitragen durch die Austauschbarkeit der Rollen konnten den Verfechtern des Stillens und des Mutterinstinktes nicht gefallen.'"
Elisabeth Badinter fordert, dass Familienpolitik stärker auf Frauenwünsche abgestellt wird: Es fehlt eine grundlegende feministische Reform besonders der Arbeitswelt unter Einbeziehung aller Männer und zugunsten aller Varianten. Denn 30 Prozent der Kinderlosen verwirklichen bereits identische Lebensentwürfe.
Die Französinnen zeigen es uns: Vor allem berufstätige, erfolgreiche und zufriedene Frauen wollen viele Kinder. Es sind Frauen, die sich nicht nur über die Mutterschaft definieren, welche ja nur einen Bruchteil eines 85 Jahre währenden Lebens ausmacht.
Elisabeth Badinter: Der Konflikt. Die Frau und die Mutter
C.H. Beck, München 2010
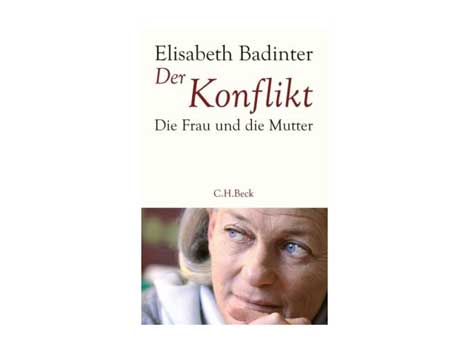
Cover "Der Konflikt. Die Frau und die Mutter" von Elisabeth Badinter© C.H. Beck
