Bilanz der Einheit
Michael Jürgs zieht unter dem Titel "Wie geht’s Deutschland?" eine Bilanz der Einheit. Die ersten Sätze des Buches irritieren allerdings:
"Die richtig guten Geschichte fangen mit dem klassischen Satz an, ’es war einmal’. Unvollendete Geschichten enden mit der Aussage, ’und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute."
Diese beiden sprichwörtlichen Sätze bilden nicht den genretypischen Anfang von Geschichten, sondern von Märchen - einer ganz besonderen Form von erfundenen Geschichten in unterhaltender, belehrender oder abschreckender Absicht. Märchen in diesem Sinne bietet Jürgs nicht. Was er auf rund 350 Seiten präsentiert, sind Augenzeugenberichte, Zeitzeugenaussagen und vor allem glaubwürdige Anekdoten über Menschen, die an herausragender Stelle im Osten und im Westen mitbeteiligt waren bei dem Ereignis, das manche "Wende", manche "Revolution" nennen. Jürgs betont:
"Das ist kein typisches Geschichtsbuch, sondern ein Buch voller Geschichten über Menschen, die das scheinbar unzerstörbar fest gemauerte System der SED in einer friedlichen Revolution besiegten."
Jürgs Geschichte der Zeit kurz vor und nach dem 9. November 1989 basiert nicht auf Akten, sondern auf Gesprächen mit Zeitzeugen und Berichten über seine Reisen in den Osten. Diese subjektive Perspektive macht den Charme des Buches aus, birgt aber auch Gefahren.
Sein Buch überzeugt insbesondere dort, wo Geschichten aus dem heutigen Alltag erzählt werden. Oft hört man nur von Klagen. Jürgs erzählt anderen Geschichten. Zum Beispiel die über den Besitzer eines Heizungs- und Sanitärbetriebs im Osten. Bis 1989 war der Unternehmer Offizier der Nationalen Volksarmee. Dann ergriff er seine Chance und baute seinen eigenen Betrieb auf. Während des Bundestagswahlkampfs versammelte der Chef "seine" 120 Mitarbeiter und erklärte diesen, was man in allen Armeen "die Lage" nennt:
"Das ist mein Freund, der ist in der CDU. Es geht mich nichts an, was ihr wählt, aber Eure Erststimme für den Direktkandidaten gebt ihr ihm. Klar?"
Niemand murrte, niemand stellte Fragen, obwohl der Chef dazu aufforderte. Die Mitarbeiter hatten eine feste Arbeit und keine Angst vor der Zukunft. Sie hatten sich arrangiert mit der deutschen Einheit und mit dem Kapitalismus. Natürlich weiß Jürgs, dass die Stimmung nicht überall so gut, die Zufriedenheit so allgemein und die Lage so unkompliziert ist. Jürgs enthält sich denn auch jeder Verallgemeinerung dieser Erfahrung.
Unzufriedenheit herrscht nicht nur im Osten. Auch im Westen klagt man über die Kosten der Einheit – man schätzt sie auf 1000 bis 1300 Milliarden Euro. In Dortmund, wo die Arbeitslosenquote 15 Prozent beträgt, erfährt Jürgs, dass die Stadt ohne die Solidarbeiträge für den Aufbau Ost nicht 900, sondern nur 500 Millionen Schulden hätte. Und Hannelore Kraft, die SPD-Chefin in Nordrhein-Westfalen sagt offen heraus:
"Bei uns gibt es Städte im Ruhrgebiet, die nicht mehr wissen, wie sie ihre Kindergärten unterhalten sollen. Trotzdem sind sie verpflichtet, weitere Schulden zu machen, um Geld in die Boom-Regionen im Osten zu überweisen."
Sie fordert deshalb einen Aufbau-West nach östlichem Vorbild. In seinen Gesprächen im Osten - mit Rainer Eppelmann, Richard Schröder, Wolfgang Thierse, Lothar de Maizière, Gregor Gysi und vielen anderen – erkennt Jürgs jedoch, dass es nicht nur um Geld, Arbeitsplätze und vermeintliche Nostalgie bzw. Ostalgie geht, sondern um tiefgehende Kränkungen, das Gefühl der Nichtanerkennung der Lebensleistung der Menschen unter dem 40-jährigen SED-Regime. Der Psychiater und Psychoanalytiker Hans-Joachim Maaz erklärte dazu:
"In der Entwicklungspsychologie ist eine der wichtigsten Lebenserfahrungen, es selbst zu etwas gebracht zu haben und nicht von der Gnade anderer abhängig zu sein. Ihr habt unsere Biografie nicht ernst genommen und gewürdigt erst recht nicht."
In diesem Zitat erscheint eine Redefigur, der Jürgs bei fast allen prominenten Gesprächspartnern im Osten begegnet: ebenso schnell wie selbstverständlich unterscheiden die Befragten zwischen "wir" und "ihr" und machen damit den Graben dingfest, der nach wie vor besteht.
Besonders eindrücklich verdeutlicht das der erste und letzte frei gewählte Ministerpräsident der DDR – Lothar de Maizière. Seine "Allianz für Deutschland" erreichte bei den Wahlen am 18. März 1990 40,8 der Stimmen. Sein Kabinett verabschiedete zwischen März und Oktober 759 Kabinettsvorlagen. De Maiziere arbeitete buchstäblich Tag und Nacht für 3500 Mark Monatsgehalt. Er nahm - als schlanker Mann von 64 Kilo - über zehn Kilo ab. Das behäbige, mit allen Wassern gewaschene "System Kohl" nahm den kleinen Mann und seine Regierung nicht ernst und ließ ihn bei jeder Gelegenheit spüren,
"dass wir nur geduldet waren, bis die Westdeutschen alles übernehmen konnten."
Das ist wörtlich zu verstehen und hinterließ nicht nur bei Prominenten tiefe Spuren, sondern auch bei den ostdeutschen Bürgern. Noch schneller als die ostdeutsche Wirtschaft und die ostdeutschen Universitäten wurde der "Runde Tisch" abgewickelt. Insbesondere die dort vertretenen Bürgerrechtler und Pfarrer wollten keine schnelle Verschmelzung der beiden Teilstaaten von oben, sondern eine neue, gesamtdeutsche, demokratische Verfassung von unten. Hinter dem "Runden Tisch" spielten - so Jürgs -
"die eigentlichen Profis aus Bonn zu dieser Zeit auf der Weltbühne ein anderes Spiel. Das Spiel der Einheit."
Das Problematische an Jürgs anekdotischem Reisebericht und an seiner Zeugenbefragung ist, dass Vieles Widersprüchlich bleibt und Vieles oft wiederholt wird. So gibt es für die Zahl der "inoffiziellen Mitarbeiter" der Stasi drei verschiedene Angaben zwischen 110.000 und 190.000 Mitarbeitern. Ermüdend in ihrer Wiederholung sind Stasi-Geschichten und Vergleiche zwischen der Nazi-Diktatur und dem DDR-Regime bzw. der NPD und der PDS/Die Linke. Auf der einen Seite betont Jürgs an vielen Stellen zu Recht:
"Die eine Diktatur steht für Auschwitz, die andere für die Mauer."
Andererseits kommt er nicht nur auf Schritt und Tritt affirmativ auf den Vergleich zurück, sondern neigt obendrein zur Dämonisierung der Stasi-Herrschaft, die sicher viele Existenzen ruinierte und das Land mit einem niederträchtigen Spitzelsystem terrorisierte. Aber sie erwies sich 1989 als völlig ohnmächtig gegenüber den Protesten und den Demonstrationen und gerade nicht - wie Jürgs meint - als "furchtbar ähnlich" mit der Gestapo. Der Freiburger Historiker Ulrich Herbert hat die Differenz jüngst auf den Punkt gebracht:
"Die eine Diktatur produzierte Leichenberge, die andere Aktenberge."
Michael Jürgs: Wie geht’s Deutschland?
C. Bertelsmann Verlag, München 2008
Diese beiden sprichwörtlichen Sätze bilden nicht den genretypischen Anfang von Geschichten, sondern von Märchen - einer ganz besonderen Form von erfundenen Geschichten in unterhaltender, belehrender oder abschreckender Absicht. Märchen in diesem Sinne bietet Jürgs nicht. Was er auf rund 350 Seiten präsentiert, sind Augenzeugenberichte, Zeitzeugenaussagen und vor allem glaubwürdige Anekdoten über Menschen, die an herausragender Stelle im Osten und im Westen mitbeteiligt waren bei dem Ereignis, das manche "Wende", manche "Revolution" nennen. Jürgs betont:
"Das ist kein typisches Geschichtsbuch, sondern ein Buch voller Geschichten über Menschen, die das scheinbar unzerstörbar fest gemauerte System der SED in einer friedlichen Revolution besiegten."
Jürgs Geschichte der Zeit kurz vor und nach dem 9. November 1989 basiert nicht auf Akten, sondern auf Gesprächen mit Zeitzeugen und Berichten über seine Reisen in den Osten. Diese subjektive Perspektive macht den Charme des Buches aus, birgt aber auch Gefahren.
Sein Buch überzeugt insbesondere dort, wo Geschichten aus dem heutigen Alltag erzählt werden. Oft hört man nur von Klagen. Jürgs erzählt anderen Geschichten. Zum Beispiel die über den Besitzer eines Heizungs- und Sanitärbetriebs im Osten. Bis 1989 war der Unternehmer Offizier der Nationalen Volksarmee. Dann ergriff er seine Chance und baute seinen eigenen Betrieb auf. Während des Bundestagswahlkampfs versammelte der Chef "seine" 120 Mitarbeiter und erklärte diesen, was man in allen Armeen "die Lage" nennt:
"Das ist mein Freund, der ist in der CDU. Es geht mich nichts an, was ihr wählt, aber Eure Erststimme für den Direktkandidaten gebt ihr ihm. Klar?"
Niemand murrte, niemand stellte Fragen, obwohl der Chef dazu aufforderte. Die Mitarbeiter hatten eine feste Arbeit und keine Angst vor der Zukunft. Sie hatten sich arrangiert mit der deutschen Einheit und mit dem Kapitalismus. Natürlich weiß Jürgs, dass die Stimmung nicht überall so gut, die Zufriedenheit so allgemein und die Lage so unkompliziert ist. Jürgs enthält sich denn auch jeder Verallgemeinerung dieser Erfahrung.
Unzufriedenheit herrscht nicht nur im Osten. Auch im Westen klagt man über die Kosten der Einheit – man schätzt sie auf 1000 bis 1300 Milliarden Euro. In Dortmund, wo die Arbeitslosenquote 15 Prozent beträgt, erfährt Jürgs, dass die Stadt ohne die Solidarbeiträge für den Aufbau Ost nicht 900, sondern nur 500 Millionen Schulden hätte. Und Hannelore Kraft, die SPD-Chefin in Nordrhein-Westfalen sagt offen heraus:
"Bei uns gibt es Städte im Ruhrgebiet, die nicht mehr wissen, wie sie ihre Kindergärten unterhalten sollen. Trotzdem sind sie verpflichtet, weitere Schulden zu machen, um Geld in die Boom-Regionen im Osten zu überweisen."
Sie fordert deshalb einen Aufbau-West nach östlichem Vorbild. In seinen Gesprächen im Osten - mit Rainer Eppelmann, Richard Schröder, Wolfgang Thierse, Lothar de Maizière, Gregor Gysi und vielen anderen – erkennt Jürgs jedoch, dass es nicht nur um Geld, Arbeitsplätze und vermeintliche Nostalgie bzw. Ostalgie geht, sondern um tiefgehende Kränkungen, das Gefühl der Nichtanerkennung der Lebensleistung der Menschen unter dem 40-jährigen SED-Regime. Der Psychiater und Psychoanalytiker Hans-Joachim Maaz erklärte dazu:
"In der Entwicklungspsychologie ist eine der wichtigsten Lebenserfahrungen, es selbst zu etwas gebracht zu haben und nicht von der Gnade anderer abhängig zu sein. Ihr habt unsere Biografie nicht ernst genommen und gewürdigt erst recht nicht."
In diesem Zitat erscheint eine Redefigur, der Jürgs bei fast allen prominenten Gesprächspartnern im Osten begegnet: ebenso schnell wie selbstverständlich unterscheiden die Befragten zwischen "wir" und "ihr" und machen damit den Graben dingfest, der nach wie vor besteht.
Besonders eindrücklich verdeutlicht das der erste und letzte frei gewählte Ministerpräsident der DDR – Lothar de Maizière. Seine "Allianz für Deutschland" erreichte bei den Wahlen am 18. März 1990 40,8 der Stimmen. Sein Kabinett verabschiedete zwischen März und Oktober 759 Kabinettsvorlagen. De Maiziere arbeitete buchstäblich Tag und Nacht für 3500 Mark Monatsgehalt. Er nahm - als schlanker Mann von 64 Kilo - über zehn Kilo ab. Das behäbige, mit allen Wassern gewaschene "System Kohl" nahm den kleinen Mann und seine Regierung nicht ernst und ließ ihn bei jeder Gelegenheit spüren,
"dass wir nur geduldet waren, bis die Westdeutschen alles übernehmen konnten."
Das ist wörtlich zu verstehen und hinterließ nicht nur bei Prominenten tiefe Spuren, sondern auch bei den ostdeutschen Bürgern. Noch schneller als die ostdeutsche Wirtschaft und die ostdeutschen Universitäten wurde der "Runde Tisch" abgewickelt. Insbesondere die dort vertretenen Bürgerrechtler und Pfarrer wollten keine schnelle Verschmelzung der beiden Teilstaaten von oben, sondern eine neue, gesamtdeutsche, demokratische Verfassung von unten. Hinter dem "Runden Tisch" spielten - so Jürgs -
"die eigentlichen Profis aus Bonn zu dieser Zeit auf der Weltbühne ein anderes Spiel. Das Spiel der Einheit."
Das Problematische an Jürgs anekdotischem Reisebericht und an seiner Zeugenbefragung ist, dass Vieles Widersprüchlich bleibt und Vieles oft wiederholt wird. So gibt es für die Zahl der "inoffiziellen Mitarbeiter" der Stasi drei verschiedene Angaben zwischen 110.000 und 190.000 Mitarbeitern. Ermüdend in ihrer Wiederholung sind Stasi-Geschichten und Vergleiche zwischen der Nazi-Diktatur und dem DDR-Regime bzw. der NPD und der PDS/Die Linke. Auf der einen Seite betont Jürgs an vielen Stellen zu Recht:
"Die eine Diktatur steht für Auschwitz, die andere für die Mauer."
Andererseits kommt er nicht nur auf Schritt und Tritt affirmativ auf den Vergleich zurück, sondern neigt obendrein zur Dämonisierung der Stasi-Herrschaft, die sicher viele Existenzen ruinierte und das Land mit einem niederträchtigen Spitzelsystem terrorisierte. Aber sie erwies sich 1989 als völlig ohnmächtig gegenüber den Protesten und den Demonstrationen und gerade nicht - wie Jürgs meint - als "furchtbar ähnlich" mit der Gestapo. Der Freiburger Historiker Ulrich Herbert hat die Differenz jüngst auf den Punkt gebracht:
"Die eine Diktatur produzierte Leichenberge, die andere Aktenberge."
Michael Jürgs: Wie geht’s Deutschland?
C. Bertelsmann Verlag, München 2008
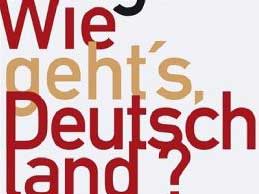
Cover: "Michael Jürgs: Wie geht’s Deutschland?"© C. Bertelsmann Verlag
