Bericht aus einem zerrissenen Land
Die türkischstämmige Schriftstellerin und Soziologin Necla Kelek dürfte mit ihrem neuen Buch "Bittersüße Heimat - Bericht aus dem Innern der Türkei" überraschen. Sie weicht diesmal nicht so sehr vom Thema ab, sondern vom Schauplatz. Es geht nicht um das erstaunliche Fortleben der Sitten und Gebräuche ihrer Herkunftskultur in Deutschland und die nicht minder erstaunliche Hilflosigkeit der deutschen Gesellschaft und ihrer Behörden gegenüber orientalischer Einwanderung. Frau Keleks Feststellung oder vielleicht sogar Hilferuf: "Eure Toleranz bringt uns um!" wird Migrationsgeschichte schreiben.
Frau Kelek erwies sich als scharfe Beobachterin und Analytikerin eines unhaltbaren Zustandes und zeigt zugleich, welchen gewaltigen Integrations- und Anpassungsprozess sie selbst zurückgelegt hat und welche Folgen eine in der eigenen Seele vollzogene Kulturrevolution ausgelöst haben müssen. Ihre tscherkessische Abstammung mag als erste Bruchstelle vielleicht den Ablösungsprozess vom "Türkentum" etwas erleichtert haben. Umso mehr ist man gespannt, wenn Frau Kelek sich auf eine Reise in die Heimat begibt und nun einen Blick auf sie wirft, mit Augen und einem Scharfsinn, die sich dieser Heimat entfremdet haben:
"Wer geht, hat den Ort, der einmal Heimat war, für immer verloren. Bevor ich mich wirklich mit dem Land meiner Herkunft auseinandersetzen konnte, musste ich klären, wohin ich gehöre. Bin ich nun eine Türkin mit einem deutschen Pass oder eine ‚türkischstämmige’ Deutsche? …Und woher nehme ich das Recht, als eine die gegangen ist, über die Türkei zu sprechen?"
In gelungener Weise verflicht Necla Kelek Erlebnisberichte, die auch auf Türkei-Kenner anregend wirken, mit den politischen Umwälzungen oder besser gesagt: den Konvulsionen des Modernisierungsprozesses. Bis in die kleinsten Winkel des riesigen Landes machen sie sich bemerkbar und verstören auch überall. Der größte politische Widerspruch besteht darin, dass die säkularen nationalstaatlichen Kräfte, die "Kemalisten", von weitreichender Demokratie ihre Herrschaft und damit das Werk Atatürks bedroht sehen. Während die sich regende Demokratie von unten, die Massen der Landbewohner, einen Islam in die Mitte der Gesellschaft tragen, wo er seit 1923 nichts mehr zu suchen hatte. Ein von Kelek geschilderter General verkörpert die eine Seite, er trägt noch eine Portion Charisma des Staatsgründers und verbreitet widerspruchslosen Respekt (38 ff.). Auf der anderen Seite macht sich ein "Amt für Religion" breit:
"eine milliardenschwere ‚Missionsbehörde’, die das Land wie eine Krake in den Griff nimmt. "Unsere Religion ist ohne Fehler", sagt Ministerpräsident Erdogan, aber bis heute müssen sich Christen hinter Mauern verbergen, um ihren Glauben leben zu können. Da wirbt die türkische Wirtschaft auf einem Plakat mit ‚starken Frauen’…, aber Tausende bleiben, ohne dass der Gesetzgeber eingreift, der archaischen Gewalt der Männer ausgeliefert…Weit ist dieses Land noch vom dem entfernt, was das aufgeklärte Europa ausmacht."
Beim Thema "Die Republik und die Frauen" (S. 72 ff.) ist Frau Kelek in ihrem Element. Hier liefert sie ihr Glanzstück an soziologischer Wahrnehmung: selbst diesem Land entstammend, dann in der deutschen Industriekultur ihm entwachsen, sieht sie auf die Verhältnisse im Herkunftsland und lässt den Leser an den Umbrüchen, auf denen ihre Wahrnehmung beruht, teilnehmen:
"Muslimische Gesellschaften begreifen sich als unauflösliche … Schicksalsgemeinschaft. Die entscheidende Frage, nicht nur für die Integration, sondern auch für die eigene Identität lautet deshalb, ob der Einzelne es schafft, sich von dem gegebenen ‚Wir’ zu befreien, als ‚Ich’ seine eigene Stimme zu finden."
Erschütternd sind die schlichten Zahlen über Analphabetentum, vor allem unter Frauen, die hohen Anteile von Mädchen, die jedem Schulbesuch fernbleiben und keinen Beruf haben. Jedes dritte Mädchen unter 18 wird verheiratet:
"Erst mühsam lernen die säkularen türkischen Frauen, dass sie sich ihre Rechte selbst erstreiten müssen …1987 protestierten 3000 von ihnen, als ein Richter sich weigerte, eine schwangere Frau von ihrem schlagenden Ehemann zu scheiden. Seine Begründung: ‚Der Rücken der Frau soll nicht ohne (Schlag-)Stock, der Bauch nicht ohne Kind verbleiben.’ Frauenorganisationen …versuchen dagegen vorzugehen."
Eine schmerzvolle Lektüre ist der abschließende Teil mit dem Titel "Der Weg nach Europa ist lang". In Deutschland wurde die Skepsis gegenüber einem EU-Beitritt der Türkei auf die Kurzformel gebracht: zu groß, zu arm, zu fremd. Frau Kelek wollte und konnte solchen Vorstellungen nicht widersprechen. Sie zeigt nicht nur Defizite auf, die mit der Zeit behoben sein würden. Das Land steht vor schweren Richtungsentscheidungen, deren Ausgang ungewiss ist. Diese Passagen seien jenen empfohlen, die den vollen EU-Beitritt des Landes für eine außenpolitische Notwendigkeit halten, - die Türkei als modernes Bollwerk gegen einen mittelalterlichen Islam einplanen wollen oder von einer einwandernden Verjüngungskur für die alternde deutsche Gesellschaft träumen. Die Türkei ist ein zerrissenes Land zwischen Laizismus und islamischer Leitkultur, die aus kosmetischen Gründen Demokratie spielt.
Dieser Bericht aus dem Innern der Türkei ist zugleich eine anschauliche und jedem Leser gewinnbringende Reise ins Innere von Necla Kelek geworden, wo der Übergang von einer Kultur zur anderen einen Punkt ohne Wiederkehr erreicht und überschritten hat.
Necla Kelek: Bittersüße Heimat - Bericht aus dem Innern der Türkei
Verlag Kiepenheuer und Witsch, Köln 2008
"Wer geht, hat den Ort, der einmal Heimat war, für immer verloren. Bevor ich mich wirklich mit dem Land meiner Herkunft auseinandersetzen konnte, musste ich klären, wohin ich gehöre. Bin ich nun eine Türkin mit einem deutschen Pass oder eine ‚türkischstämmige’ Deutsche? …Und woher nehme ich das Recht, als eine die gegangen ist, über die Türkei zu sprechen?"
In gelungener Weise verflicht Necla Kelek Erlebnisberichte, die auch auf Türkei-Kenner anregend wirken, mit den politischen Umwälzungen oder besser gesagt: den Konvulsionen des Modernisierungsprozesses. Bis in die kleinsten Winkel des riesigen Landes machen sie sich bemerkbar und verstören auch überall. Der größte politische Widerspruch besteht darin, dass die säkularen nationalstaatlichen Kräfte, die "Kemalisten", von weitreichender Demokratie ihre Herrschaft und damit das Werk Atatürks bedroht sehen. Während die sich regende Demokratie von unten, die Massen der Landbewohner, einen Islam in die Mitte der Gesellschaft tragen, wo er seit 1923 nichts mehr zu suchen hatte. Ein von Kelek geschilderter General verkörpert die eine Seite, er trägt noch eine Portion Charisma des Staatsgründers und verbreitet widerspruchslosen Respekt (38 ff.). Auf der anderen Seite macht sich ein "Amt für Religion" breit:
"eine milliardenschwere ‚Missionsbehörde’, die das Land wie eine Krake in den Griff nimmt. "Unsere Religion ist ohne Fehler", sagt Ministerpräsident Erdogan, aber bis heute müssen sich Christen hinter Mauern verbergen, um ihren Glauben leben zu können. Da wirbt die türkische Wirtschaft auf einem Plakat mit ‚starken Frauen’…, aber Tausende bleiben, ohne dass der Gesetzgeber eingreift, der archaischen Gewalt der Männer ausgeliefert…Weit ist dieses Land noch vom dem entfernt, was das aufgeklärte Europa ausmacht."
Beim Thema "Die Republik und die Frauen" (S. 72 ff.) ist Frau Kelek in ihrem Element. Hier liefert sie ihr Glanzstück an soziologischer Wahrnehmung: selbst diesem Land entstammend, dann in der deutschen Industriekultur ihm entwachsen, sieht sie auf die Verhältnisse im Herkunftsland und lässt den Leser an den Umbrüchen, auf denen ihre Wahrnehmung beruht, teilnehmen:
"Muslimische Gesellschaften begreifen sich als unauflösliche … Schicksalsgemeinschaft. Die entscheidende Frage, nicht nur für die Integration, sondern auch für die eigene Identität lautet deshalb, ob der Einzelne es schafft, sich von dem gegebenen ‚Wir’ zu befreien, als ‚Ich’ seine eigene Stimme zu finden."
Erschütternd sind die schlichten Zahlen über Analphabetentum, vor allem unter Frauen, die hohen Anteile von Mädchen, die jedem Schulbesuch fernbleiben und keinen Beruf haben. Jedes dritte Mädchen unter 18 wird verheiratet:
"Erst mühsam lernen die säkularen türkischen Frauen, dass sie sich ihre Rechte selbst erstreiten müssen …1987 protestierten 3000 von ihnen, als ein Richter sich weigerte, eine schwangere Frau von ihrem schlagenden Ehemann zu scheiden. Seine Begründung: ‚Der Rücken der Frau soll nicht ohne (Schlag-)Stock, der Bauch nicht ohne Kind verbleiben.’ Frauenorganisationen …versuchen dagegen vorzugehen."
Eine schmerzvolle Lektüre ist der abschließende Teil mit dem Titel "Der Weg nach Europa ist lang". In Deutschland wurde die Skepsis gegenüber einem EU-Beitritt der Türkei auf die Kurzformel gebracht: zu groß, zu arm, zu fremd. Frau Kelek wollte und konnte solchen Vorstellungen nicht widersprechen. Sie zeigt nicht nur Defizite auf, die mit der Zeit behoben sein würden. Das Land steht vor schweren Richtungsentscheidungen, deren Ausgang ungewiss ist. Diese Passagen seien jenen empfohlen, die den vollen EU-Beitritt des Landes für eine außenpolitische Notwendigkeit halten, - die Türkei als modernes Bollwerk gegen einen mittelalterlichen Islam einplanen wollen oder von einer einwandernden Verjüngungskur für die alternde deutsche Gesellschaft träumen. Die Türkei ist ein zerrissenes Land zwischen Laizismus und islamischer Leitkultur, die aus kosmetischen Gründen Demokratie spielt.
Dieser Bericht aus dem Innern der Türkei ist zugleich eine anschauliche und jedem Leser gewinnbringende Reise ins Innere von Necla Kelek geworden, wo der Übergang von einer Kultur zur anderen einen Punkt ohne Wiederkehr erreicht und überschritten hat.
Necla Kelek: Bittersüße Heimat - Bericht aus dem Innern der Türkei
Verlag Kiepenheuer und Witsch, Köln 2008
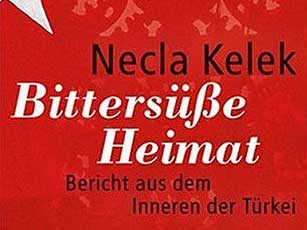
Necla Kelek: Bittersüße Heimat© Kiepenheuer und Witsch
