Belehrende Unterhaltung
Alexander Demandt verzichtet in der gut 400 Seiten starken Kulturgeschichte auf volkspädagogische Ertüchtigung in dieser oder jener Absicht und erzählt Geschichte und Geschichten um ihrer selbst willen. Sein Buch ist ein Muster an belehrender Unterhaltung und unterhaltsamer Belehrung.
Berlin steht voller Denkmäler. Sie konzentrieren sich freilich auf eine relativ kurze Epoche der mehr als 2000-jährigen deutschen Geschichte, auf die Zeit der beiden deutschen Partei- und Militärdiktaturen, der braunen von 1933 bis 1945, und der roten von 1945 bis 1989. Denk- oder Mahnmale, die an die Zeit des Dritten Reichs erinnern, finden sich an jeder zweiten Straßenecke, die von der Roten Armee errichteten Siegeszeichen an jeder dritten; was vorher war, verliert sich schnell im Dunkel der Geschichte. An wen die Siegessäule auf dem Großen Stern erinnern soll, wer da gesiegt hat über wen und wann, wissen auch deutsche Bundeskanzler nicht auf Anhieb zu sagen. Sofern sie vor dem ominösen Jahre 33 spielt, wird die Geschichte als Vorgeschichte behandelt, mit der sich näher zu beschäftigen kaum lohnt.
Die Deutschen haben sich daran gewöhnt, die Vergangenheit aus dem Blickwinkel der Gegenwart zu beurteilen, nicht umgekehrt die Gegenwart aus der Perspektive der Vergangenheit. Und beurteilen heißt hier wie meistens nicht viel anderes als verurteilen. Das Gewesene und Gewordene wird vor den Richtstuhl der Moderne gezerrt; und wehe, wenn es da nicht bestehen kann! Dann wird aus Vorläufigem Rückständiges, Eigenheiten werden zu Sonderwegen, Befangenheíten zu Dummheiten und Unwissenheit zum verräterischen Zeichen einer bösen Absicht. Odo Marquardt hat dies Verfahren die Tribunalisierung der Geschichte genannt: Sie wird nicht eigentlich erzählt, erforscht oder gedeutet, ihr wird nur noch der Prozess gemacht.
.
Von all dem ist in der gar nicht so kleinen, weil immerhin gut 400 Seiten starken Kulturgeschichte, die der Berliner Althistoriker Alexander Demandt vorgelegt hat, glücklicherweise nicht viel zu bemerken. Sie verzichtet auf volkspädagogische Ertüchtigung in dieser oder jener Absicht und erzählt Geschichte und Geschichten im ihrer selbst willen. Ihr Gegenstand, die Kultur, zu der die Deutschen mehr und Besseres beigetragen haben dürften als zu den anderen Bereichen des Geschehens, kommt ihm dabei entgegen. Schließlich pflegt die Kultur von der Parteien Hass und Gunst nicht - oder nicht ganz so stark - verzerrt zu werden wie die politische Geschichte - um hier vom Militär und dem, was es geleistet oder verbrochen hat, zu schweigen. Demandt schreibt:
"Die großen Werke der Kultur transzendieren die Systeme, so konträr diese auch sein mögen. Während kein politischer Entscheidungsträger unumstritten ist, wurden Gutenberg und Luther, Schiller und Goethe, Bach und Beethoven von Fürsten und Kommunisten, von Nationalsozialisten und Demokraten, inzwischen auch von Katholiken und Protestanten in gleichem Masse gewürdigt. Der Grund dafür ist ihre von allen Zeitumständen freie Wertschätzung im Volk, das sich zwar denkbar unterschiedliche Staatsformen gefallen ließ, an den Größen seiner Kultur jedoch festhielt"."
Demandt greift weit aus und weit zurück: chronologisch bis in die Zeit, als die Germanen unter Hermann dem Cherusker der römischen Eroberungslust Grenzen zogen, thematisch dadurch, dass er den alten, bis zum Überdruss strapazierten Gegensatz von Kultur und Zivilisation auf sich beruhen lässt und Sport und Spiele, Technik und Wissenschaft, Feste und Feiern in seine Darstellung mit einbezieht. Auch dem Wald und den Bäumen, dieser uralten, angeblich typisch deutschen Obsession, ist ein eigenes Kapitel gewidmet. Da erfährt man dann,
""dass Goethe zu seinem letzten Geburtstag am 28. August 1832 nicht nur den Kickelhahn besuchte (wo das Gedicht "Über allen Gipfeln ist Ruh" entstanden war), sondern auch Abschied nahm von einer alten Freundin, der dicken Eiche an der Strasse von Martinroda nach Ilmenau. Er kannte und schätzte sie fast sechzig Jahre lang. Der Baum stürzte und ist mehrfach nachgepflanzt worden. Der Ort liegt heute wüst, die letzten Spuren fielen jüngst einer Autobahn-Auffahrt zum Opfer"."
In diesem knappen und faktenreichen, aber keineswegs trockenen oder farblosen Stil ist das ganze Buch geschrieben. Der Autor hält mit seinem reichen Wissen nicht zurück und illustriert seine Ausführungen mit einer Fülle von Daten und Beobachtungen, Anekdoten und zeitgenössischen Berichten, darunter immer wieder lehrreichen Beispielen aus der Etymologie, die eine Art Paradedisziplin des Autors zu sein scheint. Als Horaz in seinem Lehrgedicht über die Dichtkunst seinen Mitschriftstellern empfahl, in ihren Werken das Angenehme mit dem Nützlichen zu verbinden, dachte er gewiss nicht an das moderne Sachbuch. Demandt ist aber gerade hier dasselbe geglückt: Sein Buch ist ein Muster an belehrender Unterhaltung und unterhaltsamer Belehrung.
Einer seiner Favoriten ist übrigens, neben den grossen Namen der Weimarer Klassik, Wilhelm Busch. Er schaut dem Autor über die Schulter, wenn der sich über die Unfähigkeit der Deutschen auslässt, ähnlich wie alle anderen Völker einen nationalen Feiertag zu etablieren. Am Ende dieser Ausführungen kommt Demandt auf jenes Ereignis zu sprechen, bei dem die Deutschen, begleitet von viel Blasmusik und noch mehr Bier, das tun, wozu Engländer und Franzosen Panzer auffahren und Militärmusik spielen lassen: sich ihrer Identität versichern. Bei Demandt klingt das so:
""Da nun aber doch einmal gefeiert werden muss, gibt es in Deutschland das größte Volksfest der Erde, das Münchner Oktoberfest mit all seinen Ablegern. Es hat zwar auch einen historisch-politischen Ursprung: das Pferderennen bei der Hochzeit des Bayernkönigs Ludwigs I. mit Therese von Sachsen im Jahre 1810, doch das ist längst vergessen. Heute feiert man, um zu feiern… Deutsch sein heißt eine Sache um ihrer selbst willen tun."
Das klingst fast so, als hätten die Deutschen aus ihrer langen, und vielfach unglückseligen Geschichte doch etwas gelernt: die Dinge nämlich nicht so ernst zu nehmen, nicht immerzu und überall aufs Ganze zu gehen, ironische Distanz zur Welt und zur Geschichte zu halten und damit sich und anderen das Leben etwas leichter zu machen.
Alexander Demandt: Über die Deutschen
Propyläen Verlag, Berlin 2007
Die Deutschen haben sich daran gewöhnt, die Vergangenheit aus dem Blickwinkel der Gegenwart zu beurteilen, nicht umgekehrt die Gegenwart aus der Perspektive der Vergangenheit. Und beurteilen heißt hier wie meistens nicht viel anderes als verurteilen. Das Gewesene und Gewordene wird vor den Richtstuhl der Moderne gezerrt; und wehe, wenn es da nicht bestehen kann! Dann wird aus Vorläufigem Rückständiges, Eigenheiten werden zu Sonderwegen, Befangenheíten zu Dummheiten und Unwissenheit zum verräterischen Zeichen einer bösen Absicht. Odo Marquardt hat dies Verfahren die Tribunalisierung der Geschichte genannt: Sie wird nicht eigentlich erzählt, erforscht oder gedeutet, ihr wird nur noch der Prozess gemacht.
.
Von all dem ist in der gar nicht so kleinen, weil immerhin gut 400 Seiten starken Kulturgeschichte, die der Berliner Althistoriker Alexander Demandt vorgelegt hat, glücklicherweise nicht viel zu bemerken. Sie verzichtet auf volkspädagogische Ertüchtigung in dieser oder jener Absicht und erzählt Geschichte und Geschichten im ihrer selbst willen. Ihr Gegenstand, die Kultur, zu der die Deutschen mehr und Besseres beigetragen haben dürften als zu den anderen Bereichen des Geschehens, kommt ihm dabei entgegen. Schließlich pflegt die Kultur von der Parteien Hass und Gunst nicht - oder nicht ganz so stark - verzerrt zu werden wie die politische Geschichte - um hier vom Militär und dem, was es geleistet oder verbrochen hat, zu schweigen. Demandt schreibt:
"Die großen Werke der Kultur transzendieren die Systeme, so konträr diese auch sein mögen. Während kein politischer Entscheidungsträger unumstritten ist, wurden Gutenberg und Luther, Schiller und Goethe, Bach und Beethoven von Fürsten und Kommunisten, von Nationalsozialisten und Demokraten, inzwischen auch von Katholiken und Protestanten in gleichem Masse gewürdigt. Der Grund dafür ist ihre von allen Zeitumständen freie Wertschätzung im Volk, das sich zwar denkbar unterschiedliche Staatsformen gefallen ließ, an den Größen seiner Kultur jedoch festhielt"."
Demandt greift weit aus und weit zurück: chronologisch bis in die Zeit, als die Germanen unter Hermann dem Cherusker der römischen Eroberungslust Grenzen zogen, thematisch dadurch, dass er den alten, bis zum Überdruss strapazierten Gegensatz von Kultur und Zivilisation auf sich beruhen lässt und Sport und Spiele, Technik und Wissenschaft, Feste und Feiern in seine Darstellung mit einbezieht. Auch dem Wald und den Bäumen, dieser uralten, angeblich typisch deutschen Obsession, ist ein eigenes Kapitel gewidmet. Da erfährt man dann,
""dass Goethe zu seinem letzten Geburtstag am 28. August 1832 nicht nur den Kickelhahn besuchte (wo das Gedicht "Über allen Gipfeln ist Ruh" entstanden war), sondern auch Abschied nahm von einer alten Freundin, der dicken Eiche an der Strasse von Martinroda nach Ilmenau. Er kannte und schätzte sie fast sechzig Jahre lang. Der Baum stürzte und ist mehrfach nachgepflanzt worden. Der Ort liegt heute wüst, die letzten Spuren fielen jüngst einer Autobahn-Auffahrt zum Opfer"."
In diesem knappen und faktenreichen, aber keineswegs trockenen oder farblosen Stil ist das ganze Buch geschrieben. Der Autor hält mit seinem reichen Wissen nicht zurück und illustriert seine Ausführungen mit einer Fülle von Daten und Beobachtungen, Anekdoten und zeitgenössischen Berichten, darunter immer wieder lehrreichen Beispielen aus der Etymologie, die eine Art Paradedisziplin des Autors zu sein scheint. Als Horaz in seinem Lehrgedicht über die Dichtkunst seinen Mitschriftstellern empfahl, in ihren Werken das Angenehme mit dem Nützlichen zu verbinden, dachte er gewiss nicht an das moderne Sachbuch. Demandt ist aber gerade hier dasselbe geglückt: Sein Buch ist ein Muster an belehrender Unterhaltung und unterhaltsamer Belehrung.
Einer seiner Favoriten ist übrigens, neben den grossen Namen der Weimarer Klassik, Wilhelm Busch. Er schaut dem Autor über die Schulter, wenn der sich über die Unfähigkeit der Deutschen auslässt, ähnlich wie alle anderen Völker einen nationalen Feiertag zu etablieren. Am Ende dieser Ausführungen kommt Demandt auf jenes Ereignis zu sprechen, bei dem die Deutschen, begleitet von viel Blasmusik und noch mehr Bier, das tun, wozu Engländer und Franzosen Panzer auffahren und Militärmusik spielen lassen: sich ihrer Identität versichern. Bei Demandt klingt das so:
""Da nun aber doch einmal gefeiert werden muss, gibt es in Deutschland das größte Volksfest der Erde, das Münchner Oktoberfest mit all seinen Ablegern. Es hat zwar auch einen historisch-politischen Ursprung: das Pferderennen bei der Hochzeit des Bayernkönigs Ludwigs I. mit Therese von Sachsen im Jahre 1810, doch das ist längst vergessen. Heute feiert man, um zu feiern… Deutsch sein heißt eine Sache um ihrer selbst willen tun."
Das klingst fast so, als hätten die Deutschen aus ihrer langen, und vielfach unglückseligen Geschichte doch etwas gelernt: die Dinge nämlich nicht so ernst zu nehmen, nicht immerzu und überall aufs Ganze zu gehen, ironische Distanz zur Welt und zur Geschichte zu halten und damit sich und anderen das Leben etwas leichter zu machen.
Alexander Demandt: Über die Deutschen
Propyläen Verlag, Berlin 2007
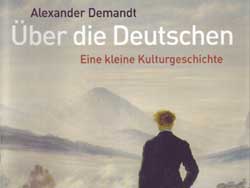
Alexander Demandt: Über die Deutschen (Coverausschnitt)© Propyläen
