Bedrohte Freiheitsliebe
Nach Ansicht der Publizistin Ulrike Ackermann ist die Liebe zur Freiheit bedroht. Die Menschen suchen aus Furcht Zuflucht beim starken Staat. Mit ihrem Buch "Eros der Freiheit" will Ackermann nun die Lust an der Freiheit wieder wecken.
Man muss die Liebe zur Freiheit in der Bevölkerung pflegen, wenn sie Bestand haben soll, und sobald sie zu versiegen droht, muss man alles daran setzen, sie wieder zum Sprudeln zu bringen. Das ist die Aufgabe der politischen Intellektuellen, und deswegen hat die Frankfurter Publizistin Ulrike Ackermann ein Buch geschrieben, in dem sie erklären will, warum es sich lohnt, die Freiheit zu lieben.
Vor allem zwei Feinde hat in ihren Augen die Freiheitsliebe, die sie pathetisch als "Eros der Freiheit" bezeichnet: die Angst und das schlechte Gewissen. Immer wieder verleiten uns Angst und Furcht dazu, in die Arme eines starken und machtvollen Staates zu flüchten. Wir suchen Schutz vor allem, was wir für gefährlich und riskant halten, und diesen Schutz finden wir, so Ulrike Ackermanns Befürchtung, weder auf dem Markt noch in der Zivilgesellschaft. Also werfen wir uns dem Staat in die Arme, von denen wir annehmen, dass sie stark genug sind, um uns zu schützen. Das hat sich einmal mehr im jüngsten Finanzcrash gezeigt, als selbst die, die dem Staat sonst gleichgültig gegenüberstehen oder in Abwehrhaltung gehen, wenn er ihnen zu nahe kommt, bei ihm Schutz und Hilfe gesucht haben. Da steht der politische Intellektuelle, der sich die Verteidigung der Freiheit gegen staatliche Reglementierung auf die Fahne geschrieben hat, düpiert da. So geht es auch Ulrike Ackermann:
"Die Moderne hat zwar die Krisenanfälligkeit der Menschen reduziert und ein höheres Maß an gesellschaftlicher Stabilität produziert. Das bedeutet jedoch nicht die Abschaffung neuer Risiken und Bedrohungen, die wieder neue Krisen heraufbeschwören können. Denn der Mensch bleibt unperfekt und wird seine Probleme deshalb nicht immer perfekt lösen können und auch weiterhin mit seiner Angst vor der Freiheit und vor dem Unbekannten zu kämpfen haben. Aber womöglich kann er noch einen besseren Spürsinn für die Unfreiheit und eine größere Lust auf seine persönliche Freiheit entwickeln, die gar in eine Liebe zu ihr mündet. Denn auch in der besten Demokratie muss er damit rechnen, dass sie eingeschränkt und beschnitten werden kann."
Das ist zwar alles so weit richtig, nur fällt es schwer, sich vorzustellen, wie mit diesen und anderen Formulierungen die Freiheitsliebe der Menschen geweckt werden soll. Ausdrücklich geht es Frau Ackermann ja nicht um die Vernunft, sondern um den Eros der Freiheit. Der aber ist durch eine Argumentation nach dem Kalkulationsmodell des kleineren Übels nicht zu wecken. Obendrein hat sich Ackermann für ihr Freiheitsplädoyer die falschen Zeugen ausgesucht: Weder Friedrich von Hayek noch Karl Popper und auch nicht Isaiah Berlin gehören zu den Autoren, die über den Reiz der Freiheit, ihren jenseits aller vernünftigen Abwägung liegenden erotischen Kick nachgedacht, geschweige denn dazu beigetragen haben. Das kann man ihnen nicht zum Vorwurf machen: Sie wandten sich an Leser und Zuhörer, die sich zwischen den betörenden Suggestionen von Kommunismus und Nationalsozialismus auf der einen und der prosaischen Welt des demokratischen Rechtsstaats auf der anderen Seite zu entscheiden hatten, und dabei ging es darum, dass sie ihren langfristigen Interessen folgten und nicht kurzfristigen Betörungen erlagen. Das aber ist Ulrike Ackermanns eigener Analyse zufolge nicht der Typ heutiger Freiheitsbedrohung. Und vor allem muss man sich, wenn man über den "Eros der Freiheit" schreiben will, auch auf deren Attraktionen einlassen und kann sich nicht unter Verweis auf Restrisiken und die Imperfektibilität des Menschen aus der Affäre ziehen.
Dabei hat Ulrike Ackermann bei ihrem langen Durchgang durch die Geschichte des politischen Denkens, der in der griechischen Antike beginnt und bis in unsere Gegenwart führt, durchaus jene Konstellationen ausfindig gemacht, in denen nicht die Vernunft, sondern die Lust an der Freiheit im Zentrum des Interesses stand. Die nachkantische Philosophie eines Fichte und Schelling, dazu das wilde Denken – und im Übrigen auch wilde Leben – der Romantiker wird von ihr zu Recht als eine Phase ausgemacht, in der nicht Kalkülrationalität, sondern Pathos, also Lust und Leid, dominierten, wenn es um die Freiheit ging. Diese war nach dem langen Vorlauf der Aufklärung während der Französischen Revolution in die Krise geraten. Robespierre und seine Anhänger gingen davon aus, dass ein bloßes Interesse an der Freiheit für deren dauerhafte Sicherung nicht ausreiche. Sie griffen, um die Freiheit in den Herzen der Menschen zu verankern, zu Gewalt und Schrecken – und scheiterten damit. Darauf reagierten die deutschen Intellektuellen und Schriftsteller und entwarfen ein unvernünftiges, aber gewaltfreies Programm der Freiheitssicherung durch Freiheitsliebe.
Ulrike Ackermann berichtet kurz von diesen Debatten, aber sie tut das so lieb- und lustlos, dass man ihnen weder ausführlicher nachgehen will noch die Probleme und Fragen erfasst, die ihnen zu Grunde lagen: Die übliche Kritik an Rousseau und Robespierre, der vorsichtig distanzierte Umgang mit den Frühromantikern und schließlich die erschöpfte Rückkehr in die Arme Kants und die Vernünftigkeit seiner Argumentation. Das ist grundsätzlich in Ordnung, und Kants Philosophie ist immer ein sicherer Hafen nach den Stürmen intellektueller Abenteurer. Nur wenn man ein Buch über den "Eros der Freiheit" schreibt, sind längere Liegezeiten in diesem Hafen untunlich.
Stärker ist Ulrike Ackermann, wenn sie gegen Freiheitsverzicht aus Angst oder schlechtem Gewissen zu Felde zieht. Ihre Diagnose lautet, wir hätten uns das Schuldkonto der globalen Expansion Europas zu sehr zu Herzen genommen und seien deswegen heute nur zaghafte Verteidiger der individuellen Freiheitsrechte, wenn sie durch Tradition und Religion bedroht würden. Hier zieht Ulrike Ackermann gegen Islamismus, einen alles verstehenden Multikulturalismus und vor allem linksintellektuelle Hasenfüßigkeit zu Felde. Hier werden alte Rechnungen beglichen, hier ist Kampfeslust, hier brennt das Feuer der Empörung.
"Die Alte Welt fühlt sich wohler im Schuldbewusstsein als in der Übernahme von Verantwortung. Es ist aber höchste Zeit, sich der Triumphe und Errungenschaften der europäischen Geschichte zu erinnern und ein lebendiges Bewusstsein darüber zu entwickeln, anstatt nur die Sünden der westlichen Zivilisation auf dem Weg in die Freiheit zu brandmarken und einen Abgesang auf die Aufklärung anzustimmen. Diesem Kulturpessimismus kann man nur mit einer neuen Selbstvergewisserung begegnen, die sich der Abgründe unserer Zivilisation gewahr ist und zugleich die Errungenschaften der westlichen Freiheitstraditionen feiern kann."
Wenn Ulrike Ackermann nicht dem ewig ängstlichen Bürger und seiner notorischen Fluchtneigung zum Staat, sondern dem Frankfurter linksalternativen Milieu zu Leibe rückt, gewinnt ihre Argumentation an Fahrt. Man spürt, dass die Verfasserin weiß, wovon sie spricht und wo sie treffen muss, damit es weh tut. Die Ironie dessen ist freilich, dass sie hier auf in die Jahre gekommene Freiheitserotiker trifft, die in der Auseinandersetzung mit den risikoaversen Bürgern eigentlich ihre Verbündete sein müssten. So bleibt am Schluss nur die Feststellung, dass Ulrike Ackermann zwar viele Gefechte geführt, aber so gut wie keine Siege errungen hat. Und wo sie erfolgreich war, hat sie ihre potenziellen Verbündeten dezimiert. Der Eros der Freiheit steht am Schluss recht einsam da; man ahnt, dass man mehr für ihn übrig haben sollte, weiß aber nicht warum. Das ist nach 162 Druckseiten zu wenig.
Ulrike Ackermann: Eros der Freiheit - Plädoyer für eine radikale Aufklärung
Klett-Cotta Verlag, Stuttgart 2008
Vor allem zwei Feinde hat in ihren Augen die Freiheitsliebe, die sie pathetisch als "Eros der Freiheit" bezeichnet: die Angst und das schlechte Gewissen. Immer wieder verleiten uns Angst und Furcht dazu, in die Arme eines starken und machtvollen Staates zu flüchten. Wir suchen Schutz vor allem, was wir für gefährlich und riskant halten, und diesen Schutz finden wir, so Ulrike Ackermanns Befürchtung, weder auf dem Markt noch in der Zivilgesellschaft. Also werfen wir uns dem Staat in die Arme, von denen wir annehmen, dass sie stark genug sind, um uns zu schützen. Das hat sich einmal mehr im jüngsten Finanzcrash gezeigt, als selbst die, die dem Staat sonst gleichgültig gegenüberstehen oder in Abwehrhaltung gehen, wenn er ihnen zu nahe kommt, bei ihm Schutz und Hilfe gesucht haben. Da steht der politische Intellektuelle, der sich die Verteidigung der Freiheit gegen staatliche Reglementierung auf die Fahne geschrieben hat, düpiert da. So geht es auch Ulrike Ackermann:
"Die Moderne hat zwar die Krisenanfälligkeit der Menschen reduziert und ein höheres Maß an gesellschaftlicher Stabilität produziert. Das bedeutet jedoch nicht die Abschaffung neuer Risiken und Bedrohungen, die wieder neue Krisen heraufbeschwören können. Denn der Mensch bleibt unperfekt und wird seine Probleme deshalb nicht immer perfekt lösen können und auch weiterhin mit seiner Angst vor der Freiheit und vor dem Unbekannten zu kämpfen haben. Aber womöglich kann er noch einen besseren Spürsinn für die Unfreiheit und eine größere Lust auf seine persönliche Freiheit entwickeln, die gar in eine Liebe zu ihr mündet. Denn auch in der besten Demokratie muss er damit rechnen, dass sie eingeschränkt und beschnitten werden kann."
Das ist zwar alles so weit richtig, nur fällt es schwer, sich vorzustellen, wie mit diesen und anderen Formulierungen die Freiheitsliebe der Menschen geweckt werden soll. Ausdrücklich geht es Frau Ackermann ja nicht um die Vernunft, sondern um den Eros der Freiheit. Der aber ist durch eine Argumentation nach dem Kalkulationsmodell des kleineren Übels nicht zu wecken. Obendrein hat sich Ackermann für ihr Freiheitsplädoyer die falschen Zeugen ausgesucht: Weder Friedrich von Hayek noch Karl Popper und auch nicht Isaiah Berlin gehören zu den Autoren, die über den Reiz der Freiheit, ihren jenseits aller vernünftigen Abwägung liegenden erotischen Kick nachgedacht, geschweige denn dazu beigetragen haben. Das kann man ihnen nicht zum Vorwurf machen: Sie wandten sich an Leser und Zuhörer, die sich zwischen den betörenden Suggestionen von Kommunismus und Nationalsozialismus auf der einen und der prosaischen Welt des demokratischen Rechtsstaats auf der anderen Seite zu entscheiden hatten, und dabei ging es darum, dass sie ihren langfristigen Interessen folgten und nicht kurzfristigen Betörungen erlagen. Das aber ist Ulrike Ackermanns eigener Analyse zufolge nicht der Typ heutiger Freiheitsbedrohung. Und vor allem muss man sich, wenn man über den "Eros der Freiheit" schreiben will, auch auf deren Attraktionen einlassen und kann sich nicht unter Verweis auf Restrisiken und die Imperfektibilität des Menschen aus der Affäre ziehen.
Dabei hat Ulrike Ackermann bei ihrem langen Durchgang durch die Geschichte des politischen Denkens, der in der griechischen Antike beginnt und bis in unsere Gegenwart führt, durchaus jene Konstellationen ausfindig gemacht, in denen nicht die Vernunft, sondern die Lust an der Freiheit im Zentrum des Interesses stand. Die nachkantische Philosophie eines Fichte und Schelling, dazu das wilde Denken – und im Übrigen auch wilde Leben – der Romantiker wird von ihr zu Recht als eine Phase ausgemacht, in der nicht Kalkülrationalität, sondern Pathos, also Lust und Leid, dominierten, wenn es um die Freiheit ging. Diese war nach dem langen Vorlauf der Aufklärung während der Französischen Revolution in die Krise geraten. Robespierre und seine Anhänger gingen davon aus, dass ein bloßes Interesse an der Freiheit für deren dauerhafte Sicherung nicht ausreiche. Sie griffen, um die Freiheit in den Herzen der Menschen zu verankern, zu Gewalt und Schrecken – und scheiterten damit. Darauf reagierten die deutschen Intellektuellen und Schriftsteller und entwarfen ein unvernünftiges, aber gewaltfreies Programm der Freiheitssicherung durch Freiheitsliebe.
Ulrike Ackermann berichtet kurz von diesen Debatten, aber sie tut das so lieb- und lustlos, dass man ihnen weder ausführlicher nachgehen will noch die Probleme und Fragen erfasst, die ihnen zu Grunde lagen: Die übliche Kritik an Rousseau und Robespierre, der vorsichtig distanzierte Umgang mit den Frühromantikern und schließlich die erschöpfte Rückkehr in die Arme Kants und die Vernünftigkeit seiner Argumentation. Das ist grundsätzlich in Ordnung, und Kants Philosophie ist immer ein sicherer Hafen nach den Stürmen intellektueller Abenteurer. Nur wenn man ein Buch über den "Eros der Freiheit" schreibt, sind längere Liegezeiten in diesem Hafen untunlich.
Stärker ist Ulrike Ackermann, wenn sie gegen Freiheitsverzicht aus Angst oder schlechtem Gewissen zu Felde zieht. Ihre Diagnose lautet, wir hätten uns das Schuldkonto der globalen Expansion Europas zu sehr zu Herzen genommen und seien deswegen heute nur zaghafte Verteidiger der individuellen Freiheitsrechte, wenn sie durch Tradition und Religion bedroht würden. Hier zieht Ulrike Ackermann gegen Islamismus, einen alles verstehenden Multikulturalismus und vor allem linksintellektuelle Hasenfüßigkeit zu Felde. Hier werden alte Rechnungen beglichen, hier ist Kampfeslust, hier brennt das Feuer der Empörung.
"Die Alte Welt fühlt sich wohler im Schuldbewusstsein als in der Übernahme von Verantwortung. Es ist aber höchste Zeit, sich der Triumphe und Errungenschaften der europäischen Geschichte zu erinnern und ein lebendiges Bewusstsein darüber zu entwickeln, anstatt nur die Sünden der westlichen Zivilisation auf dem Weg in die Freiheit zu brandmarken und einen Abgesang auf die Aufklärung anzustimmen. Diesem Kulturpessimismus kann man nur mit einer neuen Selbstvergewisserung begegnen, die sich der Abgründe unserer Zivilisation gewahr ist und zugleich die Errungenschaften der westlichen Freiheitstraditionen feiern kann."
Wenn Ulrike Ackermann nicht dem ewig ängstlichen Bürger und seiner notorischen Fluchtneigung zum Staat, sondern dem Frankfurter linksalternativen Milieu zu Leibe rückt, gewinnt ihre Argumentation an Fahrt. Man spürt, dass die Verfasserin weiß, wovon sie spricht und wo sie treffen muss, damit es weh tut. Die Ironie dessen ist freilich, dass sie hier auf in die Jahre gekommene Freiheitserotiker trifft, die in der Auseinandersetzung mit den risikoaversen Bürgern eigentlich ihre Verbündete sein müssten. So bleibt am Schluss nur die Feststellung, dass Ulrike Ackermann zwar viele Gefechte geführt, aber so gut wie keine Siege errungen hat. Und wo sie erfolgreich war, hat sie ihre potenziellen Verbündeten dezimiert. Der Eros der Freiheit steht am Schluss recht einsam da; man ahnt, dass man mehr für ihn übrig haben sollte, weiß aber nicht warum. Das ist nach 162 Druckseiten zu wenig.
Ulrike Ackermann: Eros der Freiheit - Plädoyer für eine radikale Aufklärung
Klett-Cotta Verlag, Stuttgart 2008
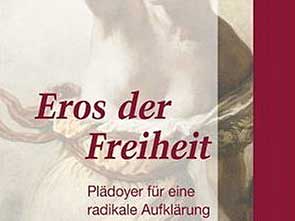
Ulrike Ackermann: Eros der Freiheit© Klett-Cotta Verlag
