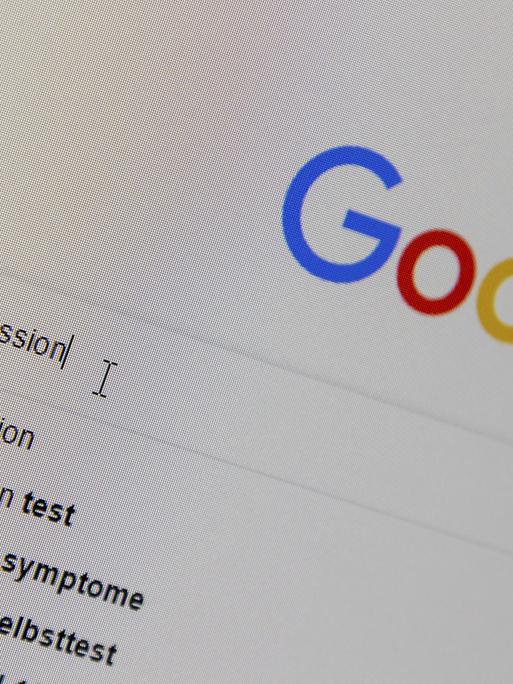Autismus bei Erwachsenen

Menschen im Autismus-Spektrum fühlen sich oft alleingelassen. Jahrelange Wartelisten und mangelndes Fachwissen verzögern eine Diagnose. © Getty Images / Klaus Vedfelt
Wenn die Diagnose erst nach Jahrzehnten kommt

Obwohl sich die Hauptsymptome von Autismus schon in frühem Alter zeigen, kann es bis zur Diagnose viele Jahre dauern. Ein Leidensweg für Betroffene, oft begleitet von Depressionen oder Angststörungen. Warum bekommen die Menschen nicht früher Klarheit?
Viele autistische Menschen wissen nicht, was mit ihnen los ist – oft jahrzehntelang. Für sie kann jeder Tag herausfordernd sein, wenn es keine Erklärung für das Gefühl gibt, anders zu sein. Manche verstecken ihre Probleme, um öffentlich zu „funktionieren“. Der Dauerstress begünstigt Depressionen und Angststörungen. Erst im Erwachsenenalter kommt manchmal der Verdacht auf: Könnte das schon immer Autismus gewesen sein? Doch der Weg zur Klarheit ist steinig. Warum wird Autismus oft so spät diagnostiziert? Was bedeutet die Diagnose und was hilft autistischen Menschen im Alltag?
Überblick
Was ist Autismus?
Autismus ist laut dem Klassifikationssystem der Weltgesundheitsorganisation ICD-11 eine neurologische Entwicklungsstörung. Interessenverbände kritisieren das Defizitäre an dieser Definition und bevorzugen den Begriff "neurologische Entwicklungsvariante".
Betroffene nehmen ihre Umwelt oft anders wahr: intensiver, ungefilterter, manchmal auch als überfordernd. Manche reagieren empfindlich auf Geräusche, Licht oder Berührungen. Wie genau sich das äußert, ist sehr unterschiedlich. Autismus ist ein Spektrum. Deshalb wird in der aktuellen Forschung von Autismus-Spektrum-Störung gesprochen.
Das erste Hauptsymptom besteht darin, dass Menschen im Autismus-Spektrum Kommunikation besonders schwerfällt. Sie müssen sich erst "erarbeiten", was üblicherweise in der sozialen Interaktion spontan und intuitiv ausgetauscht wird. Wie zum Beispiel Blicke oder interpretationsbedürftige Aussagen. Was ist eine angemessene Reaktion, was nicht? Dieses "Erarbeiten" ist oft mühsam. Der Neurologe und Psychiater Kai Vogeley von der Uniklinik Köln vergleicht es mit dem Errechnen einer Gleichung in der Mathematik.
Das zweite Hauptsymptom sind sogenannte repetitive, stereotype Verhaltensweisen. Betroffene haben das starke Bedürfnis nach einer geordneten, reizarmen, überraschungsfreien Welt. Eine Möglichkeit, mit Überreizung umzugehen, ist für viele das „Stimming“: wiederkehrende Bewegungen wie Wippen oder das Schlagen der Hände. Das sorgt für eine Art Ausgleich.
Autismus ist angeboren, zeigt sich oft schon früh und bleibt ein Leben lang. Er wird durch spezielle Genmutationen hervorgerufen. „Autismus ist die Erkrankung in der gesamten Medizin, die am stärksten vererbt wird“, sagt Kai Vogeley.
Wie viele Autisten gibt es und wie groß ist das Problem?
Statistisch gesehen ist in Deutschland ungefähr jeder Hundertste ein Mensch im Autismus-Spektrum. Das ist eine Verzehnfachung der Fälle im Vergleich zur Jahrtausendwende. Nach Ansicht der Psychotherapeutin Petia Gewohn liegt die enorme Zunahme zum einen an mehr Forschung und zum anderen daran, dass es mehr Wissen in der Gesellschaft gibt.
Auf Plattformen wie TikTok oder Instagram berichten Betroffene von ihrem Alltag mit Autismus. User erzählen aber auch, woran man die Krankheit angeblich erkennt – ganz ohne offizielle Diagnose.
Dass die Diagnose mittlerweile zu häufig „Autismus“ laute, sieht der Psychiater Ludger Tebartz van Elst von der Uniklinik Freiburg als Problem an. In der Sprechstunde der Klinik bekommt mindestens die Hälfte der Menschen keine solche Diagnose. Bei ihnen sei die Enttäuschung nachvollziehbar groß, so van Elst. Denn die „Hoffnung auf Akzeptanz des eigenen Andersseins“ breche in dem Moment zusammen.
Warum wird Autismus oft so spät diagnostiziert?
Erfahrene Kinder- und Jugendpsychiater können dem Kölner Psychiater Kai Vogeley zufolge bei Kindern am Ende des zweiten Lebensjahres eine „belastbare Diagnose“ stellen. Ein Anhaltspunkt ist demnach das „Blickverhalten“, das sich bereits mit neun Monaten entwickle.
Später gleicht die Autismus-Diagnose einem Puzzlespiel. Wie verlief die kindliche Entwicklung? Gab es Besonderheiten im sozialen Verhalten? Obwohl sich Anzeichen oft früh zeigen, erkennen auch Eltern oder Lehrkräfte sie nicht immer. Und Betroffene wie auch ihre Angehörigen erinnern sich nur lückenhaft an früher.
Auch wenn das Wissen über Autismus wächst, ist es offenbar bei vielen Ärzten und Therapeuten immer noch lückenhaft. Schaut das Fachpersonal nicht gezielt danach, werden oft zunächst andere Diagnosen gestellt. Ein Problem für die Diagnostik: Rund 75 bis 80 Prozent der autistischen Erwachsenen haben zusätzlich eine psychiatrische Diagnose, am häufigsten Angststörungen, ADHS, Schizophrenie und Depression.
Letztere vor allem, weil sich Betroffene über Jahre hinweg angepasst und Bedürfnisse und Überforderungen versteckt haben, um im sozialen Alltag nicht aufzufallen. Man spricht dabei von „Masking“ oder auch „Camouflage“. Gerade bei jungen Frauen sei das ein großes Thema, sagt Manuela Paul, die das Autismuszentrum der Oberlin Lebenswelten Potsdam leitet.
Bis zu fünf Jahre Wartezeit für eine Diagnostikstelle
Paul macht aber noch auf ein anderes gravierendes Problem aufmerksam: Als Erwachsener im Land Brandenburg oder in Berlin eine Diagnostikstelle zu finden, ist demnach eine Zumutung: „Wir reden aktuell von Wartezeiten von bis zu fünf Jahren, um da überhaupt einen Platz zu bekommen.“
An der Kölner Uniklinik sind es ungefähr zwei Jahre. Deutschlandweit fehlt es an spezialisierten Angeboten, die wenigen Ambulanzen sind überlaufen.
Autismus kann offiziell nur von Fachärztinnen und -ärzten für Psychiatrie oder Neurologie – oder in spezialisierten Autismuszentren – diagnostiziert werden. Auch Fachkräfte für psychologische Psychotherapie könnten theoretisch die Diagnose stellen. Doch vielen fehlt das notwendige Fachwissen. Hinzu kommen nach Angaben der Psychotherapeutin Petia Gewohn bürokratische Hürden oder fehlende Abrechnungsmöglichkeiten.
Hilft die Diagnose den Betroffenen?
Die Diagnose bringt Betroffenen vor allem Klarheit. Sie ist ein Schritt, die eigenen Bedürfnisse zu verstehen und zu akzeptieren. Christine Preißmann etwa, die heute selbst als Psychotherapeutin arbeitet, wurde mit 27 Jahren diagnostiziert. „Das war eine große Erleichterung, weil es dann eben endlich einen Ausdruck dafür gab, für all die Auffälligkeiten.“ In ihrem Fall hieß das: für ihre Schwierigkeiten im Kontakt mit anderen, für ihre speziellen Interessen und ihre Probleme mit unerwarteten Veränderungen.
Auch die schwedische Journalistin und Buchautorin Clara Törnvall („Die Autistinnen“) betont, wie erleichtert sie war. Sie sei durch die Diagnose von einer misslungenen Neurotypikerin zu einer normalen Autistin geworden – eine Befreiung: „Die Diagnose ist das Beste, was meinem Selbstwertgefühl je widerfahren ist.“
Nicht zuletzt ermöglicht diese Klarheit weitere Schritte, die das Leben leichter machen können: sich mit anderen autistischen Menschen auszutauschen und gezielt nach Studien, aber auch Hilfen zu suchen.
Wie kann das Leben von Betroffenen einfacher gestaltet werden?
Menschen im Autismus-Spektrum können versuchen – auch mithilfe einer Therapie – im Vorfeld Pläne für bestimmte Situationen zu machen. Christine Preißmann, die selbst als Psychotherapeutin unterschiedlichste Patienten behandelt, hat diese Strategie entwickelt: „Ich plane manchmal, wenn es mir gelingt, schon Veränderungen gezielt mit ein, sodass sie nicht mehr so ganz unerwartet kommen und deswegen nicht mehr so viel Stress bereiten“, sagt sie. Zum Beispiel bei Zugfahrten.
Aus eigener Erfahrung weiß Preißmann, wie Betroffene von Psychotherapie profitieren können: durch eine Person, die helfen kann, „Ungeschicklichkeit“ im Sozialkontakt zu überwinden, die Erläuterungen gibt und Vorschläge macht. Allerdings hatte Preißmann früher auch das „Glück“, die richtige Therapeutin zu finden.
Der Kölner Psychiater Kai Vogeley verweist darüber hinaus auf Selbsthilfegruppen und vor allem auf den Bundesverband Autismus Deutschland. Dieser habe landesweit Autismus-Therapiezentren aufgebaut, die eine „unglaublich wertvolle und wichtige Arbeit“ leisten.
Manuela Paul vom Autismuszentrum Potsdam rät Betroffenen dazu, mit der Diagnose offen umzugehen, gerade im Arbeitsumfeld. Das könne dazu beitragen, Mobbing und Konflikten vorzubeugen. Mit einem „offenen Herzen“ sollten wiederum auch Menschen zum Beispiel an eine autistische Kollegin herantreten, so Paul. Fragen wie „Wie ist es denn bei dir?“ oder „Was brauchst du?“ seien hilfreich. „Es geht im Prinzip um Verbindlichkeiten und um konkrete Absprachen, die man miteinander trifft“, betont die Expertin.
Nicht zuletzt steht Menschen im Autismus-Spektrum je nach individueller Situation staatliche Unterstützung zu, wie zum Beispiel ein Pflegegrad. Leicht ist aber auch das nicht: Manche Betroffene müssen für eine Anerkennung der Behinderung erst kämpfen und den Rechtsweg gehen.
bth