Außergewöhnliche Architektur
Der Jemen kommt in den Medien vor allem wegen des Hervorbringens von Terroristen vor. Dass das ärmste arabische Land jedoch mehr ist als das, zeigt ein Buch von Tom Leiermann - und dabei vor allem die Architektur von Shibam.
"Innerhalb von Schibam drängen sich vier- bis achtgeschossige Turmbauten in die Höhe, so dicht, dass die Stadt von fern wie ein einziges Gebäude aussieht. Und so hoch, dass selbst die schlanken Minarette der Moscheen zwischen all den irdenen Türmen zwergenhaft aussehen, ja von außen gar nicht zu sehen sind. Gärten oder Höfe gibt es nicht in dieser Stadt, nur winzige Lichtschächte."
Tom Leiermann kam 2003 nach Schibam - in die konservativste Stadt des Jemen, gelegen in der konservativsten Provinz, im südöstlichen Hadramaut. Der junge Architekt aus Essen sollte dazu beitragen, den Verfall der Turmhäuser von Schibam zu stoppen.
Bis zu acht Stockwerke sind diese Altstadthäuser hoch, gebaut allein aus getrocknetem Lehm und Holz. Das "Manhattan der Wüste", wie Schibam gern genannt wird, gehört seit 1984 zum Weltkulturerbe. Doch durch eine Mischung aus Armut und Desinteresse waren viele dieser Lehmhäuser im Laufe der letzten Jahrzehnte verfallen.
In seinem Buch über Schibam geht Leiermann naturgemäß intensiv auf die Architektur der Stadt ein, zieht Vergleiche mit der Architektur anderer arabischer Länder heran, es gibt Skizzen und Lagepläne. Für den Laien mag das manchmal etwas zu sehr ins Detail gehen.
Ausgeglichen wird das jedoch durch die zahlreichen Farbfotos von Schibam und Umgebung - wobei den Fotos der örtliche Sittenkodex anzumerken ist: Sie bilden Männer allen Alters und Kinder beiderlei Geschlechts ab - erwachsene Frauen sind darauf nicht zu sehen, denn Frauen kommen in der Schibamer Öffentlichkeit allenfalls vollverschleiert vor.
"Möbel kennt der hadramische Haushalt so gut wie gar nicht. Einen Stuhl kennt man allenfalls als Untersatz für den Fernseher. Ansonsten gibt es lediglich zwei wichtige Möbel: das Ehebett, meist nur eine Matratze, und einen Schrank, der mit symmetrischen Plastikblumensträußen und mit einer mittigen Uhr verziert sein soll; beides bildet zusammen mit Kleidern und Goldschmuck die Aussteuer, deren Beibringung ebenso wie das Brautgeld Teil der Verhandlung zwischen den heiratenden Familien ist. Der hadramische Wohnraum ist also definitiv leer. Kommt Besuch, so werden meist Kissen zum Anlehnen erst hereingebracht, ansonsten sind Teppiche die einzige Ausstattung der Räume. Das Prinzip des multifunktionalen Wohnraums ist hier zur Vollendung gebracht."
Trotz der Detailliebe des Architekten gelingt es Tom Leiermann, in seinem Text die Stadt und ihre Struktur lebendig werden zu lassen. Zu zeigen, welche Auswirkungen bestimmte Bauformen oder Materialien auf das Leben der Einwohner haben.
Dass die Schibamschen Lehmhäuser unbedingt vor Wasser geschützt werden müssen, wenn sie nicht wie durchweichte Sandburgen in sich zusammenfallen sollen, wirkt sich zum Beispiel auch auf den Gebrauch der Toiletten in den Häusern aus. In Schibam werden die menschlichen Ausscheidungen gleich auf der Toilette nach Konsistenz getrennt, wie Leiermann einer deutschen Besuchergruppe in Schibam erklärt.
Leiermann: "Das Feste kommt in den Trockenschacht, und das Flüssige kommt hierhin. Und dann gibt’s immer noch son kleines Bassin gemauert, da wurden früher Lehmklümpchen vom Hochwasserflussbett vor der Stadt, aus diesem Lehm Klumpen gesammelt. Wenn man früher kein Papier oder auch kein Wasser hatte – die Frauen mussten das ja aus dem Brunnen holen, das Wasser war ja immer knapp, da hat man diese Erdklümpchen benutzt. Wie, das ist der Phantasie des geneigten Betrachters überlassen."
So dicht die Bebauung in der Altstadt, so dicht ist auch das Beziehungsgeflecht ihrer konservativen Bewohner. Ein für Außenstehende undurchschaubares Geflecht. Zuzügler gibt es in Schibam nicht. Mit einer Ausnahme: Tom Leiermann. Der nahm sich in Schibam eine Wohnung, trat zum Islam über, heiratete eine Einheimische und erlernte den lokalen arabischen Dialekt.
Mehr Integration geht nicht. Der Leser des Buches profitiert davon, denn Leiermann beschreibt nicht nur, wie Straßen und Häuser aussehen, sondern - mit gewissen Einschränkungen - auch, was sich darin abspielt. Zum Beispiel, was es bedeutet, dass Männer und Frauen faktisch in getrennten Welten leben.
Leiermann: "Man muss sagen, man besucht sich eigentlich nicht. Die Freunde, die trifft man auf der Straße, auf der Gasse, im Laden, abends findet die Kommunikation in der Altstadt sehr rege in den Straßen statt. Das Haus ist eben das Revier der Frauen, und die haben ihre Freundinnen und ihre Verwandtschaft."
Tom Leiermann fühlt sich mittlerweile in Deutschland fremd, wie er einräumt. Mit seinem Buch gibt er uns die Möglichkeit, den fernen Jemen als nicht mehr ganz so fremd zu empfinden.
Tom Leiermann: Shibam. Leben in Lehmtürmen
Ludwig Reichert Verlag Wiesbaden, 2009, 284 Seiten, 49 Euro
Tom Leiermann kam 2003 nach Schibam - in die konservativste Stadt des Jemen, gelegen in der konservativsten Provinz, im südöstlichen Hadramaut. Der junge Architekt aus Essen sollte dazu beitragen, den Verfall der Turmhäuser von Schibam zu stoppen.
Bis zu acht Stockwerke sind diese Altstadthäuser hoch, gebaut allein aus getrocknetem Lehm und Holz. Das "Manhattan der Wüste", wie Schibam gern genannt wird, gehört seit 1984 zum Weltkulturerbe. Doch durch eine Mischung aus Armut und Desinteresse waren viele dieser Lehmhäuser im Laufe der letzten Jahrzehnte verfallen.
In seinem Buch über Schibam geht Leiermann naturgemäß intensiv auf die Architektur der Stadt ein, zieht Vergleiche mit der Architektur anderer arabischer Länder heran, es gibt Skizzen und Lagepläne. Für den Laien mag das manchmal etwas zu sehr ins Detail gehen.
Ausgeglichen wird das jedoch durch die zahlreichen Farbfotos von Schibam und Umgebung - wobei den Fotos der örtliche Sittenkodex anzumerken ist: Sie bilden Männer allen Alters und Kinder beiderlei Geschlechts ab - erwachsene Frauen sind darauf nicht zu sehen, denn Frauen kommen in der Schibamer Öffentlichkeit allenfalls vollverschleiert vor.
"Möbel kennt der hadramische Haushalt so gut wie gar nicht. Einen Stuhl kennt man allenfalls als Untersatz für den Fernseher. Ansonsten gibt es lediglich zwei wichtige Möbel: das Ehebett, meist nur eine Matratze, und einen Schrank, der mit symmetrischen Plastikblumensträußen und mit einer mittigen Uhr verziert sein soll; beides bildet zusammen mit Kleidern und Goldschmuck die Aussteuer, deren Beibringung ebenso wie das Brautgeld Teil der Verhandlung zwischen den heiratenden Familien ist. Der hadramische Wohnraum ist also definitiv leer. Kommt Besuch, so werden meist Kissen zum Anlehnen erst hereingebracht, ansonsten sind Teppiche die einzige Ausstattung der Räume. Das Prinzip des multifunktionalen Wohnraums ist hier zur Vollendung gebracht."
Trotz der Detailliebe des Architekten gelingt es Tom Leiermann, in seinem Text die Stadt und ihre Struktur lebendig werden zu lassen. Zu zeigen, welche Auswirkungen bestimmte Bauformen oder Materialien auf das Leben der Einwohner haben.
Dass die Schibamschen Lehmhäuser unbedingt vor Wasser geschützt werden müssen, wenn sie nicht wie durchweichte Sandburgen in sich zusammenfallen sollen, wirkt sich zum Beispiel auch auf den Gebrauch der Toiletten in den Häusern aus. In Schibam werden die menschlichen Ausscheidungen gleich auf der Toilette nach Konsistenz getrennt, wie Leiermann einer deutschen Besuchergruppe in Schibam erklärt.
Leiermann: "Das Feste kommt in den Trockenschacht, und das Flüssige kommt hierhin. Und dann gibt’s immer noch son kleines Bassin gemauert, da wurden früher Lehmklümpchen vom Hochwasserflussbett vor der Stadt, aus diesem Lehm Klumpen gesammelt. Wenn man früher kein Papier oder auch kein Wasser hatte – die Frauen mussten das ja aus dem Brunnen holen, das Wasser war ja immer knapp, da hat man diese Erdklümpchen benutzt. Wie, das ist der Phantasie des geneigten Betrachters überlassen."
So dicht die Bebauung in der Altstadt, so dicht ist auch das Beziehungsgeflecht ihrer konservativen Bewohner. Ein für Außenstehende undurchschaubares Geflecht. Zuzügler gibt es in Schibam nicht. Mit einer Ausnahme: Tom Leiermann. Der nahm sich in Schibam eine Wohnung, trat zum Islam über, heiratete eine Einheimische und erlernte den lokalen arabischen Dialekt.
Mehr Integration geht nicht. Der Leser des Buches profitiert davon, denn Leiermann beschreibt nicht nur, wie Straßen und Häuser aussehen, sondern - mit gewissen Einschränkungen - auch, was sich darin abspielt. Zum Beispiel, was es bedeutet, dass Männer und Frauen faktisch in getrennten Welten leben.
Leiermann: "Man muss sagen, man besucht sich eigentlich nicht. Die Freunde, die trifft man auf der Straße, auf der Gasse, im Laden, abends findet die Kommunikation in der Altstadt sehr rege in den Straßen statt. Das Haus ist eben das Revier der Frauen, und die haben ihre Freundinnen und ihre Verwandtschaft."
Tom Leiermann fühlt sich mittlerweile in Deutschland fremd, wie er einräumt. Mit seinem Buch gibt er uns die Möglichkeit, den fernen Jemen als nicht mehr ganz so fremd zu empfinden.
Tom Leiermann: Shibam. Leben in Lehmtürmen
Ludwig Reichert Verlag Wiesbaden, 2009, 284 Seiten, 49 Euro
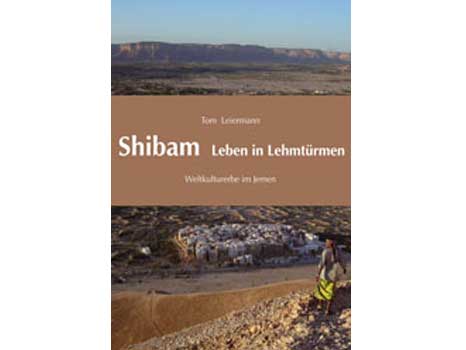
Cover: "Tom Leiermann: Shibam. Leben in Lehmtürmen"© Ludwig Reichert Verlag Wiesbaden
