Außen braun - innen blau
Wie nützlich Sport für Propagandazwecke war, merkte die NS-Führung spätestens bei den Olympischen Spielen von 1936. Das Regime versuchte daher, auch Fußballclubs für sich einzuspannen. Ob Herta BSC ein brauner Verein wurde, hat Daniel Körfer in seinem Buch "Hertha unter dem Hakenkreuz" untersucht.
Der Berliner Fußballverein Hertha BSC hat im abgelaufenen Spieljahr zwar nicht das erhoffte Ziel – die Teilnahme an der Champions League – erreicht, aber einen mutigen Schritt gewagt, der höchste Beachtung verdient. Die Vereinsführung hatte den an der Freien Universität Berlin lehrenden Zeithistoriker Daniel Koerfer mit der Aufarbeitung der Vereinsgeschichte während des Nationalsozialismus beauftragt und ihm völlige Forschungsfreiheit zugesagt. Er hat nun ein auf Recherchen in Akten und Zeitungen sowie Gesprächen mit Zeitzeugen basierendes Buch mit wunderbaren Fotos vorgelegt, das sich von der ersten bis zur letzten Seite spannend liest und eindrucksvoll demonstriert, wie lebendig Zeitgeschichte geschrieben werden kann.
Koerfer gelingt es, die politische Entwicklung im nationalsozialistischen Deutschland mit der Vereinsgeschichte zu verknüpfen und gleichzeitig Einzelschicksale zu erzählen, die die Lebenswirklichkeit im Dritten Reich anschaulich demonstrieren.
Der 1892 gegründete Verein erlebte kurz vor der nationalsozialistischen Machtergreifung seine erfolgsreichste Zeit und gewann 1930 und 1931 die deutsche Meisterschaft. Mitglieder und Anhänger des im Berliner Wedding ansässigen Fußballclubs waren zumeist Arbeiter mit Sympathien für die SPD oder KPD. Zentrale Figur vor, während und nach der Nazi-Zeit war der Sozialdemokrat Wilhelm Wernicke, der dafür sorgte, dass der Fußball im Vordergrund stand und die Politik, so weit es ging, außen vor blieb.
Die Führung der NSDAP, namentlich Adolf Hitler, hatte ursprünglich ein eher distanziertes Verhältnis zum Sport, merkte jedoch rasch, nicht zuletzt durch die Olympischen Spiele 1936, wie sich dieser politisch instrumentalisieren ließ.
"Die wenigen Eintragungen zu diesem Thema im Tagebuch des Propagandaministers verdeutlichen diesen ‚Erkenntnisprozess’ recht eindrucksvoll. Die erste Eintragung zum Fußball findet sich bei Goebbels erst unter dem Datum vom 21. November 1935: ‚Mittwoch: Stürmischer Flug nach Berlin. Unangenehm. Mit Magda Fußballspiel. 50.000 Zuschauer. Sehr spannend und unterhaltend. Ein Spiel fürs Volk.’"
Anders als etwa in England, dem Kernland des Fußballs, lassen die Nationalsozialisten – auch und gerade in den Kriegsjahren – den Spielbetrieb weiterlaufen, um fußballbegeisterten Massen willkommene Ablenkung zu verschaffen und vom Elend des Krieges abzulenken. Bis kurz vor der bedingungslosen Kapitulation wird im zerbombten Berlin Fußball gespielt.
Hertha BSC kann sich dem Zugriff der Nationalsozialisten auf den Sport ebenso wenig wie andere Vereine entziehen. Prominente Spieler werden in die NS-Propaganda einbezogen, die Vereinsführung und -satzung ausgewechselt. Allerdings weigern sich Funktionäre und Spieler, die antisemitische und rassistische Diktion der Machthaber zu übernehmen.
Der berühmteste Hertha-Spieler, Hanne Sobeck, tritt zwar in die Partei ein, nicht zuletzt, um nach seiner aktiven Zeit als Sportjournalist im Reichsrundfunk arbeiten zu können, gleichzeitig setzt er sich jedoch für jüdische Vereinsmitglieder oder Verfolgte des Regimes ein und lässt sich nicht einschüchtern.
"Bis heute sind von Sobeck keinerlei rassenantisemitische Artikel, auch keine die Mordtaten des Regimes verklärende Beiträge aufgetaucht. In den beiden Sportromanen, die er 1935 und 1938 veröffentlichte, finden sich keine der typischen nationalsozialistischen Worthülsen. Werte wie Disziplin, Pflichterfüllung, persönlicher Einsatz als Garanten für Erfolge im Leben wie auch auf dem Sportplatz sind nun einmal ebenso wenig genuin nationalsozialistisch wie der Gedanke, dass Sport, dass Wettkampf und Kameradschaft für das gesamte Leben nützen und erziehen können."
Trotz der Distanz vieler Funktionäre und Mitglieder gegenüber dem Nationalsozialismus gab es auch einige Vorgänge, die kein Ruhmesblatt für den Verein sind. So stellten sie sich nicht schützend vor ihren jüdischen Sportarzt Hermann Horwitz, der erst enteignet und dann verschleppt und ermordet wurde.
"Nein, niemand hat hier eingegriffen. Niemand hat hier ‚Halt’ gerufen. Im Gegenteil, ein Rädchen greift ins andere, und am Ende sind Millionen Menschen ausgeplündert, verschleppt, ermordet, wie Hermann Horwitz auch. Hitler war es nicht allein. Seine wichtigsten Helfer neben Himmler, Heydrich und den Schergen der SS waren zweifellos die vielen Tausend deutschen Bürokraten in den unterschiedlichsten beteiligten Ämtern und Behörden, von den Finanzämtern bis hin zur Reichsbahn. Und so, wie sie Hitler dienten, dienten sie später Honecker – und dienten sie Adenauer oder Brandt."
Was dem jüdischen Mannschaftsarzt geschah, musste auf ähnliche Weise der Jugendtrainer Siebeck – ein einfaches NS-Parteimitglied – nach dem Krieg durch das kommunistische Regime erleiden. Er wurde festgenommen, enteignet, in ein in Speziallager umbenanntes ehemaliges KZ verbracht, in die Sowjetunion verschleppt und wahrscheinlich umgebracht.
"Die beiden Fälle aus der Führungs- und Verwaltungsebene eines kleinen Berliner Sportvereins wie Hertha BSC … zeigen sehr anschaulich das, was Alexander Solschenizyn die ‚Knochenmühle’ genannt hat – der braune wie der rote Unrechtsstaat haben beide beharrlich und zäh mahlende Mühlen in Gang gesetzt, die unendlich viele menschliche Schicksale bestimmten, Leben zerrieben, zerstörten, vernichteten."
Besser erging es Spielern wie dem Mittelstürmer Heinz Tamm, dem seine Fußballkünste halfen, im sowjetischen Kriegsgefangenenlager zu überleben. Hier wurde ebenso wie in den KZs Fußball gespielt, suchten junge Männer die Ablenkung vom Elend des Lagerlebens.
Wie Fußball systemübergreifend verbindet, zeigt auch das Schicksal des niederländischen Zwangsarbeiters Abraham Appel, der in der Nazi-Zeit zum Star bei Hertha avancierte und nach der Rückkehr in sein Heimatland anfangs beschimpft wurde, aber später wieder in der niederländischen Nationalmannschaft spielen durfte. Er konstatierte Jahrzehnte später in einem Interview, Hertha sei kein Nazi-Club gewesen.
"Bei Hertha habe ich mit Jungs gespielt, die richtige Freunde für mich wurden. Es waren alles junge Männer, die den Krieg genauso schrecklich fanden wie ich. Menne Hahn, ein toller Fußballer in unserem Team, wurde ganz plötzlich an die Ostfront geschickt. Dort ist er dann gefallen. Diesen Jungen haben wir alle niemals wiedergesehen. Ich fand das entsetzlich. Später habe ich nie gedacht, dass ein Tod weniger schrecklich ist, weil er zufällig ein Deutscher ist. Nein, ich verspüre keinen Hass, solche Gefühle führen zu nichts. Außer zu neuer Not und neuem Elend."
Nach dem Krieg dauerte es einige Jahre, bis Hertha wieder im alten Stadion im Berliner Wedding spielen durfte. Den Besatzungsmächten galten alle Institutionen als NS-belastet. Hertha aber – so das Fazit von Koerfer – passte sich zwar den diktatorischen Rahmenbedingungen an, wurde äußerlich braun, blieb im Kern aber blau, getreu der Devise: So viel Anpassung wie nötig, so viel Distanz wie möglich.
Daniel Körfer: Hertha unter dem Hakenkreuz. Ein Berliner Fußballclub im Dritten Reich
Verlag Die Werkstatt, Göttingen
Koerfer gelingt es, die politische Entwicklung im nationalsozialistischen Deutschland mit der Vereinsgeschichte zu verknüpfen und gleichzeitig Einzelschicksale zu erzählen, die die Lebenswirklichkeit im Dritten Reich anschaulich demonstrieren.
Der 1892 gegründete Verein erlebte kurz vor der nationalsozialistischen Machtergreifung seine erfolgsreichste Zeit und gewann 1930 und 1931 die deutsche Meisterschaft. Mitglieder und Anhänger des im Berliner Wedding ansässigen Fußballclubs waren zumeist Arbeiter mit Sympathien für die SPD oder KPD. Zentrale Figur vor, während und nach der Nazi-Zeit war der Sozialdemokrat Wilhelm Wernicke, der dafür sorgte, dass der Fußball im Vordergrund stand und die Politik, so weit es ging, außen vor blieb.
Die Führung der NSDAP, namentlich Adolf Hitler, hatte ursprünglich ein eher distanziertes Verhältnis zum Sport, merkte jedoch rasch, nicht zuletzt durch die Olympischen Spiele 1936, wie sich dieser politisch instrumentalisieren ließ.
"Die wenigen Eintragungen zu diesem Thema im Tagebuch des Propagandaministers verdeutlichen diesen ‚Erkenntnisprozess’ recht eindrucksvoll. Die erste Eintragung zum Fußball findet sich bei Goebbels erst unter dem Datum vom 21. November 1935: ‚Mittwoch: Stürmischer Flug nach Berlin. Unangenehm. Mit Magda Fußballspiel. 50.000 Zuschauer. Sehr spannend und unterhaltend. Ein Spiel fürs Volk.’"
Anders als etwa in England, dem Kernland des Fußballs, lassen die Nationalsozialisten – auch und gerade in den Kriegsjahren – den Spielbetrieb weiterlaufen, um fußballbegeisterten Massen willkommene Ablenkung zu verschaffen und vom Elend des Krieges abzulenken. Bis kurz vor der bedingungslosen Kapitulation wird im zerbombten Berlin Fußball gespielt.
Hertha BSC kann sich dem Zugriff der Nationalsozialisten auf den Sport ebenso wenig wie andere Vereine entziehen. Prominente Spieler werden in die NS-Propaganda einbezogen, die Vereinsführung und -satzung ausgewechselt. Allerdings weigern sich Funktionäre und Spieler, die antisemitische und rassistische Diktion der Machthaber zu übernehmen.
Der berühmteste Hertha-Spieler, Hanne Sobeck, tritt zwar in die Partei ein, nicht zuletzt, um nach seiner aktiven Zeit als Sportjournalist im Reichsrundfunk arbeiten zu können, gleichzeitig setzt er sich jedoch für jüdische Vereinsmitglieder oder Verfolgte des Regimes ein und lässt sich nicht einschüchtern.
"Bis heute sind von Sobeck keinerlei rassenantisemitische Artikel, auch keine die Mordtaten des Regimes verklärende Beiträge aufgetaucht. In den beiden Sportromanen, die er 1935 und 1938 veröffentlichte, finden sich keine der typischen nationalsozialistischen Worthülsen. Werte wie Disziplin, Pflichterfüllung, persönlicher Einsatz als Garanten für Erfolge im Leben wie auch auf dem Sportplatz sind nun einmal ebenso wenig genuin nationalsozialistisch wie der Gedanke, dass Sport, dass Wettkampf und Kameradschaft für das gesamte Leben nützen und erziehen können."
Trotz der Distanz vieler Funktionäre und Mitglieder gegenüber dem Nationalsozialismus gab es auch einige Vorgänge, die kein Ruhmesblatt für den Verein sind. So stellten sie sich nicht schützend vor ihren jüdischen Sportarzt Hermann Horwitz, der erst enteignet und dann verschleppt und ermordet wurde.
"Nein, niemand hat hier eingegriffen. Niemand hat hier ‚Halt’ gerufen. Im Gegenteil, ein Rädchen greift ins andere, und am Ende sind Millionen Menschen ausgeplündert, verschleppt, ermordet, wie Hermann Horwitz auch. Hitler war es nicht allein. Seine wichtigsten Helfer neben Himmler, Heydrich und den Schergen der SS waren zweifellos die vielen Tausend deutschen Bürokraten in den unterschiedlichsten beteiligten Ämtern und Behörden, von den Finanzämtern bis hin zur Reichsbahn. Und so, wie sie Hitler dienten, dienten sie später Honecker – und dienten sie Adenauer oder Brandt."
Was dem jüdischen Mannschaftsarzt geschah, musste auf ähnliche Weise der Jugendtrainer Siebeck – ein einfaches NS-Parteimitglied – nach dem Krieg durch das kommunistische Regime erleiden. Er wurde festgenommen, enteignet, in ein in Speziallager umbenanntes ehemaliges KZ verbracht, in die Sowjetunion verschleppt und wahrscheinlich umgebracht.
"Die beiden Fälle aus der Führungs- und Verwaltungsebene eines kleinen Berliner Sportvereins wie Hertha BSC … zeigen sehr anschaulich das, was Alexander Solschenizyn die ‚Knochenmühle’ genannt hat – der braune wie der rote Unrechtsstaat haben beide beharrlich und zäh mahlende Mühlen in Gang gesetzt, die unendlich viele menschliche Schicksale bestimmten, Leben zerrieben, zerstörten, vernichteten."
Besser erging es Spielern wie dem Mittelstürmer Heinz Tamm, dem seine Fußballkünste halfen, im sowjetischen Kriegsgefangenenlager zu überleben. Hier wurde ebenso wie in den KZs Fußball gespielt, suchten junge Männer die Ablenkung vom Elend des Lagerlebens.
Wie Fußball systemübergreifend verbindet, zeigt auch das Schicksal des niederländischen Zwangsarbeiters Abraham Appel, der in der Nazi-Zeit zum Star bei Hertha avancierte und nach der Rückkehr in sein Heimatland anfangs beschimpft wurde, aber später wieder in der niederländischen Nationalmannschaft spielen durfte. Er konstatierte Jahrzehnte später in einem Interview, Hertha sei kein Nazi-Club gewesen.
"Bei Hertha habe ich mit Jungs gespielt, die richtige Freunde für mich wurden. Es waren alles junge Männer, die den Krieg genauso schrecklich fanden wie ich. Menne Hahn, ein toller Fußballer in unserem Team, wurde ganz plötzlich an die Ostfront geschickt. Dort ist er dann gefallen. Diesen Jungen haben wir alle niemals wiedergesehen. Ich fand das entsetzlich. Später habe ich nie gedacht, dass ein Tod weniger schrecklich ist, weil er zufällig ein Deutscher ist. Nein, ich verspüre keinen Hass, solche Gefühle führen zu nichts. Außer zu neuer Not und neuem Elend."
Nach dem Krieg dauerte es einige Jahre, bis Hertha wieder im alten Stadion im Berliner Wedding spielen durfte. Den Besatzungsmächten galten alle Institutionen als NS-belastet. Hertha aber – so das Fazit von Koerfer – passte sich zwar den diktatorischen Rahmenbedingungen an, wurde äußerlich braun, blieb im Kern aber blau, getreu der Devise: So viel Anpassung wie nötig, so viel Distanz wie möglich.
Daniel Körfer: Hertha unter dem Hakenkreuz. Ein Berliner Fußballclub im Dritten Reich
Verlag Die Werkstatt, Göttingen
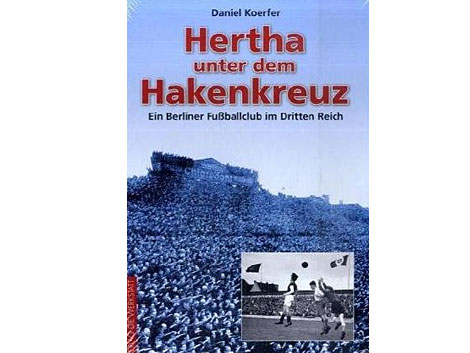
Daniel Körfer: Hertha unter dem Hakenkreuz© Verlag Die Werkstatt
