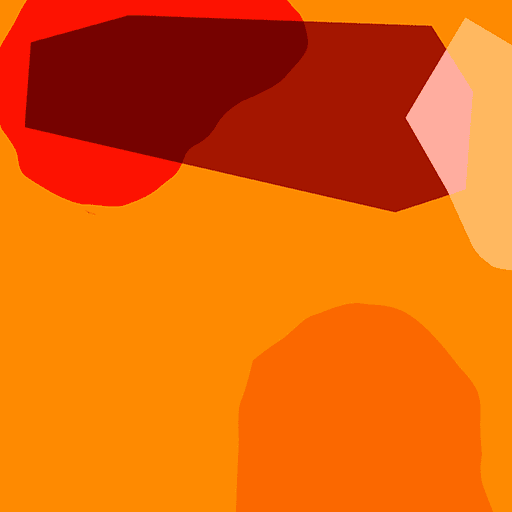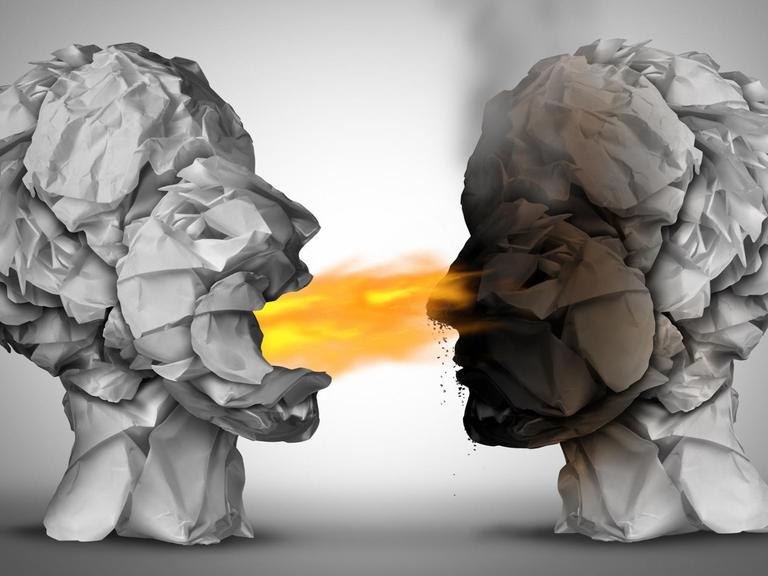Die Scheinheiligkeit von Erdoğan
04:21 Minuten

Steuern auf Alkoholika seien in der Türkei so rasant gestiegen, dass manche Menschen dazu übergingen, ihren Alkohol selbst zu produzieren, schreibt die "FAZ". Währenddessen mahne Erdoğan inmitten der Wirtschaftskrise aus seinem Luxuspalast Geduld an.
"In Deutschland könnten Sie mit einem monatlichen Mindestlohn 3158 Flaschen Bier kaufen, in der Türkei dagegen nur 186", schreibt Bülent Mumay in der FRANKFURTER ALLGEMEINEN ZEITUNG. In den letzten zehn Jahren seien in der Türkei die Steuern auf Alkoholika um fast 500 Prozent gestiegen. Deshalb produzieren einige Türken ihre alkoholischen Getränke einfach selbst.
70 Tote durch gepanschten Alkohol
Da aber die Erdoğan-Regierung verboten hat, den Hauptrohstoff dazu, das Ethanol, in Supermärkten oder im Internet zu verkaufen, haben einige auf gefährlichen Ersatz gesetzt:
"Sie mischten Reinigungsprodukte wie alkoholhaltige Desinfektionsmittel mit Alkoholaromen und verkauften sie als Raki. Das Unglück geschah. In den letzten zwei Wochen starben mindestens 70 Personen nach dem Genuss illegaler Alkoholika", schreibt Mumay und zitiert ein Mitglied der AKP-Jugendorganisation mit den Worten: "Laizisten, wollt ihr Recep Tayyip Erdoğan loswerden, trinkt nur reichlich gepanschten Alkohol!"
Erdoğan selbst habe mit Blick auf die Wirtschaftskrise der Türkei gesagt: "Wahrhaft fromm ist, wer bei Mangel geduldig ausharrt." Allerdings, so Mumay, halte sich Erdoğan nicht an seinen eigenen Rat: "In den Tagen, als Erdoğan zur Geduld aufrief, wurde bekannt, dass die Ausgaben des Palastes für einen einzigen Tag auf über eine Million Euro angestiegen sind."
Die Nabelschau westlicher Gesellschaften
"Auch das noch", heißt es nicht im FAZ-Artikel über die Türkei, sondern zu einem ganz anderen Thema in der SÜDDEUTSCHEN ZEITUNG. Staatsterror Chinas gegen die Uiguren, blutige Kämpfe in Jemen, der Krieg in Bergkarabach - Joachim Käppner zählt diese und andere Kriegs- und Krisenherde auf. Eigentlich müssten wir uns darüber empören, meint er.
"Aber wenig deutet darauf hin, dass die Kriegsopfer auf der Welt in der westlichen Öffentlichkeit künftig mehr erfahren als achselzuckendes Bedauern oder gar den erklärten Willen, sich nicht darum zu scheren", schreibt Käppner.
"Viel intensiver beschäftigen sich die westlichen Gesellschaften und ihre Medien mit dem eigenen Bauchnabel und der eigenen Befindlichkeit, mit sich selbst, mit Debatten um Korrektheit und Identität, die, so berechtigt sie subjektiv erscheinen mögen, den Menschen in den brennenden Bergen von Karabach vorkommen müssen wie die Luxussorgen einer Welt, die noch viel weiter fort erscheint als ein paar Tausend Kilometer."
Cancel Culture als Gefühl
Als wollte sie die These ihres Autors belegen, eröffnet dieselbe Zeitung, die SZ, das Feuilleton mit einem Artikel, in dem sie erklärt, wie "der Streit über die neue moralische Sensibilität zur kulturellen Revolution führt".
"Wahrscheinlich ist die Cancel Culture nicht zuletzt ein Gefühl. Dass man als schwarzes Schaf eben nicht mehr zur Herde gehören darf. Auch wenn man will", schreiben vier Autoren im neuen SPIEGEL. Sie spielen darauf an, dass sich der S. Fischer Verlag von seiner Autorin Monika Maron getrennt hat, weil sie ein Buch in einer Reihe der befreundeten Buchhändlerin Susanne Dagen veröffentlicht hat.
"Die bewegt sich im Dunstkreis des rechtsradikalen Verlegers Götz Kubitschek, der den Antaios Verlag betreibt und dessen 'Institut für Staatspolitik' vom Verfassungsschutz beobachtet wird", heißt es im SPIEGEL. Das ist schon seit knapp einer Woche bekannt. Interessant ist der Artikel aber vor allem deswegen, weil er schon den nächsten politisch motivierten Konflikt eines Verlags mit einem seiner Autoren prophezeit.
"Lava", der neue Roman von Uwe Tellkamp, einem Freund Susanne Dagens, sei schon für das nächste Jahr angekündigt gewesen, nun aber wolle der Suhrkamp Verlag keinen Termin mehr nennen. Begründung: "Man arbeite noch am Manuskript." Das kommentiert der SPIEGEL so: "Tatsächlich hat Tellkamp schon aus 'Lava' gelesen. Anwesende berichteten von wüsten Passagen und wilder Polemik gegen die Merkelrepublik. Suhrkamp wird seine Freude haben."