Aufrichtigkeit als ein Krisen-Retter
Wolfgang Engler hat mit "Lüge als Prinzip" eine unspektakuläre kultursoziologische Arbeit über die Aufklärungszeit mit populärem Antikapitalismus gemixt. Durch diese Mischung produziert er eine Botschaft, die schlichter und naiver nicht sein könnte: Nur Aufrichtigkeit kann unsere Gesellschaft aus der Krise retten.
Das Buch von Wolfgang Engler ist unbedingt lesenswert. Das Buch von Wolfgang Engler ist ein kleiner Etikettenschwindel. Wie passt das zusammen? Nun, Engler ist einer der wenigen intelligenten Linken, die wir noch haben, und - was noch seltener ist: er kann gut schreiben. Aber in seinem neuen Buch geht es weder um "Lüge als Prinzip" wie der Titel verspricht, noch um "Aufrichtigkeit im Kapitalismus" wie der Untertitel lautet. Der Aufbau-Verlag wollte offenbar eine schon ältere Studie Englers über die Geschichte der Aufrichtigkeit so herausbringen, dass sie in die Zeit der großen Krise passt.
Deshalb hat man eine unspektakuläre kultursoziologische Arbeit über die Aufklärungszeit mit populärem Antikapitalismus gemixt. Durch diese Mischung produziert Englers Buch eine Botschaft, die schlichter und naiver nicht sein könnte: Nur Aufrichtigkeit kann unsere Gesellschaft aus der Krise retten.
Was man als Wissenschaftler gegen Engler einwenden muss, sei hier nur am Rande erwähnt: dass er nämlich die Auseinandersetzung mit Lionel Trillings großem Essay über Sincerity and Authenticity scheut – und ich sage "scheut", um nicht vermuten zu müssen, dass er dieses Standardwerk gar nicht kennt. Logische Probleme seines Themas wie etwa das Problem, dass gerade die Bekundung und Inszenierung von Aufrichtigkeit Zweifel an der Aufrichtigkeit weckt, ignoriert Engler genau so souverän wie die Lizenz zum Lügen in der Politik.
Dass Politiker nicht aufrichtig sein können, wenn sie an der Macht bleiben wollen, weiß mittlerweile jedes Kind. So spricht man von Weißen Lügen, wenn Politiker – und leider auch Journalisten - bewusst die Unwahrheit sagen, um das so genannte Volk in die politisch korrekte Richtung zu schubsen. Und dass Statistik eine Technik ist, mit der Wahrheit zu lügen, lernt man heute schon im Gymnasium.
Aber kommen wir zum Kern des Buches. Es kreist in seinem sachlichen Teil um zwei Gedanken. Erstens, der Aufrichtigkeitsdiskurs der Aufklärung als Testlauf für die bürgerliche Gesellschaft, und, zweitens, die "wahre" Ökonomie als versäumte Alternative zum Marktradikalismus. Aufrichtigkeitsdiskurse der Aufklärungszeit funktionieren nach Wolfgang Engler ganz ähnlich wie Jürgen Habermas einmal die Funktion der literarischen Öffentlichkeit bestimmt hat - nämlich als unbewusstes Training für die politische Emanzipation des Bürgertums.
"Aufrichtigkeit, ihrem Wesen, ihrem Zweck entsprechend aufgefasst, ermöglichte Menschen, emotional sie selbst zu sein, und zeichnete jene, die die Möglichkeit ergriffen, als ‚wahre’ Menschen aus."
Um das Maß des "wahren Menschen" geht es auch in dem zweiten Schlüsselgedanken Englers: dem vergessenen Erbe der "wahren Ökonomie", die die Wirtschaft nicht der Logik des Marktes überlassen, sondern sozial lenken wollte – Fichte statt Adam Smith! Das klingt in manchen Ohren sicher aktuell, und Wolfgang Engler verkauft es auch geschickt als Keimzelle aller späteren Kritik des Marktliberalismus. Also zurück zu Fichtes geschlossenem Handelsstaat?
Wolfgang Englers prägende Lebenserfahrung ist die Lebenswelt der DDR. Sie ermöglicht es ihm, auf sehr glaubwürdige Weise Aufrichtigkeit als die große Herausforderung für einen anständigen Menschen zu beschreiben: als Mut zum aufrichtigen Sprechen trotz Spitzeln und Zensur, als Mut zum aufrechten Gang trotz Stasi. Indem Engler nun schlankweg SED-Staat und absolutistische Herrschaft analogisiert, hat er den Sprung von der Zeit der Aufklärung in die Gegenwart geschafft.
Die "Fernethik", über die sich der Soziologe Arnold Gehlen noch lustig gemacht hat, propagiert Wolfgang Engler in aller sozialromantischen Unschuld. Die Wirtschaft brauche einen "postreligiösen Auftrag"; die Menschen sollten ihre Wahrheit nicht im Eigensinn, sondern im Gemeinsinn suchen und einen "globalen Teamgeist" entwickeln.
"Es gab eine Zeit, da verstanden sich die Bürger als Glieder einer großen, grenzüberschreitenden, moralischen Versicherungsgemeinschaft. Sie fühlten sich, Bekannte wie Unbekannte, füreinander verantwortlich und verpflichtet, einander Beistand zu leisten. Ihren Bund zu besiegeln, entwickelten sie einen eigenen Code, Merk- und Erkennungszeichen, die nur der redliche Bürger wahrzunehmen und zu deuten verstand. In doppelter Frontstellung zum Klerus und zur Aristokratie einerseits, zum bindungslosen Bourgeois andererseits, konstituierten sich die Bürgerlichen als ‚Gemeinde der Aufrichtigen’."
So spricht der träumende Soziologe. Und man muss zugeben: Das ist einfach schön formuliert und geht ans Herz. Wolfgang Engler fordert nicht wie Gregor Gysi "Reichtum für alle", sondern "Echtheit für alle". Das setzt voraus, dass man sich die Anerkennung nicht verdienen muss, dass sie fraglos und ungefährdet ist; dass man für seine soziale Existenz keine Opfer bringen muss – mit einem Wort: dass man sozial überhaupt nicht scheitern kann. Hegels Kampf um Anerkennung darf nicht stattfinden. Familien und Freundschaften vermitteln diese Sicherheit.
Aber Engler findet sie eben auch in der Aufrichtigkeitskultur der Aufklärungszeit – und in den "arbeiterlichen Gesellschaften des 20. Jahrhunderts". Zu Deutsch heißt das ja wohl: Wäre das Projekt DDR nicht verraten worden, dann hätte die moderne Gesellschaft "die unverdiente Leichtigkeit sozialen Seins" erreicht. Das ist Ostalgie auf höchstem Niveau.
Auch wenn man darüber den Kopf schüttelt, muss man Engler doch zugestehen, dass er das zentrale Problem des 21. Jahrhunderts erkannt hat, nämlich die Neudefinition des Sozialen. Doch sein Buch zeigt wider Willen, dass man in dieser Frage weder von der Aufklärung noch von der Erfahrung eines DDR-Intellektuellen etwas lernen kann.
Wolfgang Engler hat schon vor Jahren eine soziologische Marktlücke entdeckt und erfolgreich bewirtschaftet: das intelligente Lob der Ostdeutschen. Und nicht nur seine Landsleute aus der ehemaligen DDR, sondern auch die Linken im Westen waren dankbar dafür, Schwarz auf Weiß gezeigt zu bekommen, dass nicht alles schlecht war in Ulbrichts und Honeckers Land.
Es wäre schade um die Intelligenz und stilistische Brillanz dieses Soziologen, wenn er aus ostdeutschem Antikapitalismus ein ewiges Markenzeichen machen würde. Um einen Werbeslogan aus dem Bundestagswahlkampf zu variieren: Unser Autor kann mehr.
Wolfgang Engler: Lüge als Prinzip. Aufrichtigkeit im Kapitalismus
Aufbau Verlag
Deshalb hat man eine unspektakuläre kultursoziologische Arbeit über die Aufklärungszeit mit populärem Antikapitalismus gemixt. Durch diese Mischung produziert Englers Buch eine Botschaft, die schlichter und naiver nicht sein könnte: Nur Aufrichtigkeit kann unsere Gesellschaft aus der Krise retten.
Was man als Wissenschaftler gegen Engler einwenden muss, sei hier nur am Rande erwähnt: dass er nämlich die Auseinandersetzung mit Lionel Trillings großem Essay über Sincerity and Authenticity scheut – und ich sage "scheut", um nicht vermuten zu müssen, dass er dieses Standardwerk gar nicht kennt. Logische Probleme seines Themas wie etwa das Problem, dass gerade die Bekundung und Inszenierung von Aufrichtigkeit Zweifel an der Aufrichtigkeit weckt, ignoriert Engler genau so souverän wie die Lizenz zum Lügen in der Politik.
Dass Politiker nicht aufrichtig sein können, wenn sie an der Macht bleiben wollen, weiß mittlerweile jedes Kind. So spricht man von Weißen Lügen, wenn Politiker – und leider auch Journalisten - bewusst die Unwahrheit sagen, um das so genannte Volk in die politisch korrekte Richtung zu schubsen. Und dass Statistik eine Technik ist, mit der Wahrheit zu lügen, lernt man heute schon im Gymnasium.
Aber kommen wir zum Kern des Buches. Es kreist in seinem sachlichen Teil um zwei Gedanken. Erstens, der Aufrichtigkeitsdiskurs der Aufklärung als Testlauf für die bürgerliche Gesellschaft, und, zweitens, die "wahre" Ökonomie als versäumte Alternative zum Marktradikalismus. Aufrichtigkeitsdiskurse der Aufklärungszeit funktionieren nach Wolfgang Engler ganz ähnlich wie Jürgen Habermas einmal die Funktion der literarischen Öffentlichkeit bestimmt hat - nämlich als unbewusstes Training für die politische Emanzipation des Bürgertums.
"Aufrichtigkeit, ihrem Wesen, ihrem Zweck entsprechend aufgefasst, ermöglichte Menschen, emotional sie selbst zu sein, und zeichnete jene, die die Möglichkeit ergriffen, als ‚wahre’ Menschen aus."
Um das Maß des "wahren Menschen" geht es auch in dem zweiten Schlüsselgedanken Englers: dem vergessenen Erbe der "wahren Ökonomie", die die Wirtschaft nicht der Logik des Marktes überlassen, sondern sozial lenken wollte – Fichte statt Adam Smith! Das klingt in manchen Ohren sicher aktuell, und Wolfgang Engler verkauft es auch geschickt als Keimzelle aller späteren Kritik des Marktliberalismus. Also zurück zu Fichtes geschlossenem Handelsstaat?
Wolfgang Englers prägende Lebenserfahrung ist die Lebenswelt der DDR. Sie ermöglicht es ihm, auf sehr glaubwürdige Weise Aufrichtigkeit als die große Herausforderung für einen anständigen Menschen zu beschreiben: als Mut zum aufrichtigen Sprechen trotz Spitzeln und Zensur, als Mut zum aufrechten Gang trotz Stasi. Indem Engler nun schlankweg SED-Staat und absolutistische Herrschaft analogisiert, hat er den Sprung von der Zeit der Aufklärung in die Gegenwart geschafft.
Die "Fernethik", über die sich der Soziologe Arnold Gehlen noch lustig gemacht hat, propagiert Wolfgang Engler in aller sozialromantischen Unschuld. Die Wirtschaft brauche einen "postreligiösen Auftrag"; die Menschen sollten ihre Wahrheit nicht im Eigensinn, sondern im Gemeinsinn suchen und einen "globalen Teamgeist" entwickeln.
"Es gab eine Zeit, da verstanden sich die Bürger als Glieder einer großen, grenzüberschreitenden, moralischen Versicherungsgemeinschaft. Sie fühlten sich, Bekannte wie Unbekannte, füreinander verantwortlich und verpflichtet, einander Beistand zu leisten. Ihren Bund zu besiegeln, entwickelten sie einen eigenen Code, Merk- und Erkennungszeichen, die nur der redliche Bürger wahrzunehmen und zu deuten verstand. In doppelter Frontstellung zum Klerus und zur Aristokratie einerseits, zum bindungslosen Bourgeois andererseits, konstituierten sich die Bürgerlichen als ‚Gemeinde der Aufrichtigen’."
So spricht der träumende Soziologe. Und man muss zugeben: Das ist einfach schön formuliert und geht ans Herz. Wolfgang Engler fordert nicht wie Gregor Gysi "Reichtum für alle", sondern "Echtheit für alle". Das setzt voraus, dass man sich die Anerkennung nicht verdienen muss, dass sie fraglos und ungefährdet ist; dass man für seine soziale Existenz keine Opfer bringen muss – mit einem Wort: dass man sozial überhaupt nicht scheitern kann. Hegels Kampf um Anerkennung darf nicht stattfinden. Familien und Freundschaften vermitteln diese Sicherheit.
Aber Engler findet sie eben auch in der Aufrichtigkeitskultur der Aufklärungszeit – und in den "arbeiterlichen Gesellschaften des 20. Jahrhunderts". Zu Deutsch heißt das ja wohl: Wäre das Projekt DDR nicht verraten worden, dann hätte die moderne Gesellschaft "die unverdiente Leichtigkeit sozialen Seins" erreicht. Das ist Ostalgie auf höchstem Niveau.
Auch wenn man darüber den Kopf schüttelt, muss man Engler doch zugestehen, dass er das zentrale Problem des 21. Jahrhunderts erkannt hat, nämlich die Neudefinition des Sozialen. Doch sein Buch zeigt wider Willen, dass man in dieser Frage weder von der Aufklärung noch von der Erfahrung eines DDR-Intellektuellen etwas lernen kann.
Wolfgang Engler hat schon vor Jahren eine soziologische Marktlücke entdeckt und erfolgreich bewirtschaftet: das intelligente Lob der Ostdeutschen. Und nicht nur seine Landsleute aus der ehemaligen DDR, sondern auch die Linken im Westen waren dankbar dafür, Schwarz auf Weiß gezeigt zu bekommen, dass nicht alles schlecht war in Ulbrichts und Honeckers Land.
Es wäre schade um die Intelligenz und stilistische Brillanz dieses Soziologen, wenn er aus ostdeutschem Antikapitalismus ein ewiges Markenzeichen machen würde. Um einen Werbeslogan aus dem Bundestagswahlkampf zu variieren: Unser Autor kann mehr.
Wolfgang Engler: Lüge als Prinzip. Aufrichtigkeit im Kapitalismus
Aufbau Verlag
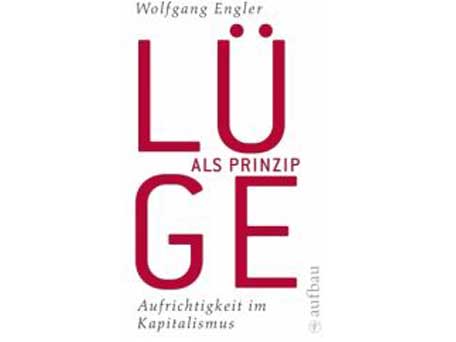
Cover: "Wolfgang Engler: Lüge als Prinzip"© Aufbau Verlag
