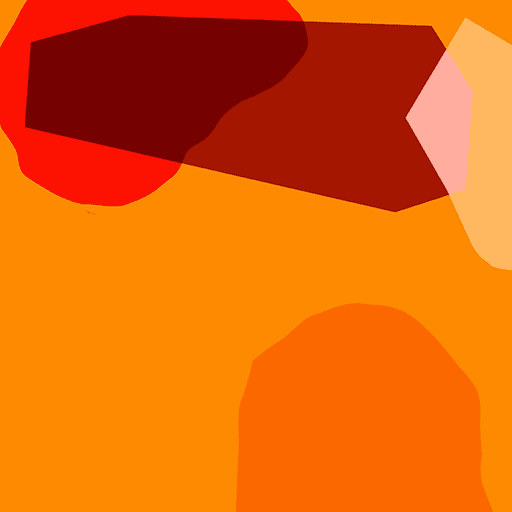Wenn sich der Abend senkt

Athen ist laut, chaotisch - ein Moloch. Doch nachts verwandelt sich die Stadt in einen Ort der kleinen Atempausen.
Christos Ikonomou: "Die Hässlichkeit am Tag! Aber am Abend ist Athen bezaubernd, da hat die Stadt ein mysteriöses Aroma, was damit zu tun hat, dass sie sehr viele Erinnerungen mit sich führt."
Theodoros Grigoriadis: "Das Athen, nach dem sich jetzt alle sehnen, ist das Athen mit den kleinen Häusern und den leeren Straßen, das in den Schwarzweißfilmen zu sehen ist."
Petros Markaris: "Was mich an Athen begeistert, ist die Widersprüchlichkeit dieser Stadt. Sie zeigt jeden Augenblick ein anderes Gesicht, das einen mal abstößt und dann wieder magisch anzieht. ... Athen ist die Stadt der kleinen Atempausen."
Musik: Giorgos Dalaras „Athina".
Athen − die ungeliebte Stadt
Ich kenne eine Stadt, in der der Asphalt brennt
Und wo Du weder Baum noch Schatten findest
Große Geschichte, wichtige Vorfahren
Licht und Grabstein der Welt
Athen, Du erinnerst mich an eine Frau, die weint,
weil niemand sie will.
Athen, Athen, ich sterbe mit Dir,
stirbst Du auch mit mir?
Und wo Du weder Baum noch Schatten findest
Große Geschichte, wichtige Vorfahren
Licht und Grabstein der Welt
Athen, Du erinnerst mich an eine Frau, die weint,
weil niemand sie will.
Athen, Athen, ich sterbe mit Dir,
stirbst Du auch mit mir?
So sang der griechische Sänger Giorgos Dalaras schon 1972 über Athen: als Stadt, die niemand will – und in der inzwischen trotzdem 5,5 Millionen Einwohner leben, die Hälfte der griechischen Bevölkerung. Athen ist ein Moloch, das weiß jeder, der die Stadt einmal besucht hat: laut und hässlich, die Bürgersteige eng, Fahrradwege gibt es so gut wie keine. So vermittelt sie den Bewohnern das Athen-typische Hamsterradgefühl: Man rennt und kommt doch nicht von der Stelle, zuletzt eindrücklich von der Band „Going through" in dem Lied „Athina" besungen.
Ich renne seit dem Morgen und komme doch nie pünktlich an
Ich brate, ich koche den ganzen Tag in meinen eigenen Saft.
Mein schlimmster Tag heißt Montag.
Ich träume davon, in der Lotterie zu gewinnen, doch jedes Mal,
bevor ich das Geld bekomme – verdammt – wache ich auf.
Ich brate, ich koche den ganzen Tag in meinen eigenen Saft.
Mein schlimmster Tag heißt Montag.
Ich träume davon, in der Lotterie zu gewinnen, doch jedes Mal,
bevor ich das Geld bekomme – verdammt – wache ich auf.
Einerseits. Andererseits beginnen alle, die Athen ein bisschen besser kennen, früher oder später von der Stadt zu schwärmen - von ihren versteckten Nischen, von ihren extremen Widersprüchen und von dem Unterschied zwischen Tag und Nacht. Petros Markaris, der griechische Krimiautor, der auch in Deutschland Erfolge feiert, beschrieb Athen in der im Wagenbach Verlag erschienenen Anthologie „Athen. Eine literarische Einladung" als ein „Stadt der kleinen Atempausen".
Doch der vielleicht größte Widerspruch Athens liegt im Unterschied zwischen Tag und Nacht. Was es an Schönheit tagsüber einbüßt, gewinnt es nachts wieder zurück. Das abstoßende, chaotische, marktschreierische Gesicht Athens verblasst, sobald der Abend herabsinkt. Eine Zauberhand verleiht ihm ein schönes Antlitz, das bei Sonnenaufgang wieder verschwindet. Wenn ich Fremden das Leben der Athener erklären möchte, erzähle ich oft, dass sie den ganzen Tag über in der Hölle leben, um nachts für einige Stunden im Paradies zu weilen.
Athen, die Stadt der zwei Gesichter? Einen Eindruck vermittelt der Blick von einem der Hügel, dem Filopappou, auf dem – wie die Menschen früher glaubten – die neun Musen leben und Museus, der Sohn des Orpheus, begraben ist. Den Filopappou erreicht man leicht, denn er liegt im Zentrum. Von der U-Bahnstation „Akropolis" gehe ich an den Losverkäuferinnen und dem Mann, der Vogelstimmenpfeifen verkauft, vorbei – nicht in das Gassengewirr des Touristenviertels Plaka hinein, sondern in die entgegengesetzte Richtung, durch die Straßen von Koukaki und gelange augenblicklich in eine andere Welt.
Enge ansteigende Gassen, altertümliche Friseurläden, im Souterrain liegende Schneidereien. Ältere Damen ziehen ihre Einkaufswägelchen die kaum befahrenen Straßen hinauf. Oberhalb der Bebauung verläuft eine Umgehungstraße, dahinter führen Trampelpfade den Berg hoch. Es ist früher Abend an einem Novembertag, und der gesamte Hügel scheint menschenleer.
Von oben ist der Blick über die Stadt spektakulär – und erschreckend. Im Süden die Viertel bis nach Piräus und das Meer, sogar die Insel Ägina im Saronischen Golf ist zu erkennen. Richtung Westen ragt der Parthenon-Tempel der Akropolis auf, dahinter, auf der anderen Seite der Innenstadt, der kegelförmige Berg Lykabettos. Gen Norden aber erstreckt sich eine schier endlose wirkende Ebene aus Betonhäusern, so eintönig und trostlos, das sich bei dem Gedanken an den Verkehr auf den in Schluchten versenkten Straßen, die Brust verengt. Ich kenne Athen seit dreißig Jahren – aber dieser Anblick verstört und fasziniert mich immer wieder. Die Stadt scheint nicht mit oder aus der Landschaft entstanden, sondern trotz oder gegen sie. Sie wirkt uferlos, chaotisch. Gleichgültigkeit und Gier, das Leben als Überlebenskampf – all das scheint über den Häusern zu stehen und ist wie mit Händen zu greifen.
Athen − Auf der Suche nach den kleinen Atempausen
Machen wir uns also auf die Suche nach dem abendlichen, dem nächtlichen Athen, am besten mit einem Motorroller, dem laut knatternden Athener Fortbewegungsmittel der Improvisation und des Durchschlängelns.
In dem Buch „Poetischer Athen-Führer" schreibt der Herausgeber Gerhard Emrich im Vorwort:
"Athen ist eine sehr alte und zugleich sehr junge Stadt. Sie hat keine Gelegenheit gehabt, wie Paris ganze Viertel auszubilden, welche die Dichter besingen und von denen die Reisenden schwärmen. Und es gibt nicht wie in Rom historisch bedeutsame Örtlichkeiten aus nichtantiker Zeit in vergleichbarer Anzahl. In Athen erblickt man von fast jeder Stelle der Stadt aus das, war wirklich einmalig ist: die Akropolis. Noch in ihren Resten ein Beispiel hoher Kunst, das den langen zeitlichen Raum zwischen Antike und heute in einem Augenblick überwindet."
Zur Einstimmung geht's einmal um die abendliche Akropolis, um diese Akropolis herum, im Ohr einige Zeilen, die Dichter für sie gefunden haben.
Süße Stunde. Hingegeben streckt schön
Sich Athen im April wie eine Hetäre;
Sinnesfreuden die Düfte der Luft,
und auf nichts mehr wartet die Seele.
Sich Athen im April wie eine Hetäre;
Sinnesfreuden die Düfte der Luft,
und auf nichts mehr wartet die Seele.
Die Fahrt geht erst hinunter zur breiten Avenue Singrou, die das Zentrum mit der Küste verbindet und von scheußlichen Betonklötzen und riesigen Hotels gesäumt wird, dann vorbei am Tempel des Olympischen Zeus mit den korinthischen Säulen und am Botanischen Garten entlang, der grünen Lunge der Stadt, 1838 von der Frau des aus Bayern stammenden griechischen Königs Otto, von Königin Amalie, angelegt.
Zu den Häusern neigt sich, beschwert
das Silber der Lider der Abend;
Königin dort oben die Akropolis
Im Purpur der sinkenden Sonne.
Kuss des Lichts, es erblüht der Sterne erster;
Am Ilissos verliebt sich der Wind
In den rosenbräutlich erschauernden Lorbeer.
Süße Stunde der Freude und Liebe, wenn
Die Vögel der eine den anderen jagt
Leicht streifend die Säule des Olympischen Zeus...
Kostas Karyotakis. Athen
das Silber der Lider der Abend;
Königin dort oben die Akropolis
Im Purpur der sinkenden Sonne.
Kuss des Lichts, es erblüht der Sterne erster;
Am Ilissos verliebt sich der Wind
In den rosenbräutlich erschauernden Lorbeer.
Süße Stunde der Freude und Liebe, wenn
Die Vögel der eine den anderen jagt
Leicht streifend die Säule des Olympischen Zeus...
Kostas Karyotakis. Athen
Ich passiere das Parlamentsgebäude am Syntagma-Platz, auf der gleichen Straße, auf der sonst die Demonstrationen stattfinden, fahre links die Eleftherios Venizelou hinunter – leere Läden, Schaufenster mit Zu-vermieten-Schildern, aber ta periptera, die Kioske, geöffnet und mit billigen Sonnenbrillen, Sportzeitungen und Chipstüten behangen wie eh und je. Am Omonia-Platz, der schmuddeligen Schwester des Sytagma-Platzes, biege ich nach links, und gelange schließlich in den Stadtteil Monastiraki.
Im Dämmerlicht noch widerstrahlt die Akropolis
Auf ihren eingestürzten Säulen
Die goldene Farbe die
Die Sonne sich neigend
Wieder ihr schenkte
Eine alte unschätzbare Krone
Für einer Königin Haupt.
Der Parthenon wird leise
Trübe und erlischt
im ersten Dunkel
der Nacht die ersteht.
Und im letzten Schein
Des Tags der erstirbt
Steigt auf in den Himmel
Die Ruine, die göttlich antike.
Jerassimos Anninos. Akropolis
Auf ihren eingestürzten Säulen
Die goldene Farbe die
Die Sonne sich neigend
Wieder ihr schenkte
Eine alte unschätzbare Krone
Für einer Königin Haupt.
Der Parthenon wird leise
Trübe und erlischt
im ersten Dunkel
der Nacht die ersteht.
Und im letzten Schein
Des Tags der erstirbt
Steigt auf in den Himmel
Die Ruine, die göttlich antike.
Jerassimos Anninos. Akropolis
Athen − Die Stadt der Widersprüche
Unterhalb der göttlichen Ruine hört sich Athen an einem Freitagabend gegen 20 Uhr so an.
Menschenmengen drängen sich durch die Gasse, die parallel zu den U-Bahngleisen verläuft. Touristen, natürlich, aber es sind vor allem junge Athener selbst, die vor den Lokalen an den Holztischen mit den karierten Decken sitzen.
Am Ende der Gasse liegt die U-Bahnstation „Thisio". Hier bin ich mit Nikos Panajotopoulos verabredet. Panajotopoulos, 1963 geboren, arbeitet als Schriftsteller und Drehbuchautor und lebt seit seiner Kindheit in Athen. Zwei seiner Bücher, „Der Heiligmacher" und „Die Erfindung des Zweifels" sind auch auf Deutsch erschienen. Er hat aber auch einen interessanten Text über Athen geschrieben, der – übersetzt von Birgit Hildebrandt, unter dem Titel „Die zweigeteilte Stadt", in „Athen. Eine literarische Einladung" erschienen ist. Über den Bahnhof „Thisio" steht dort:
Thisio ist einer der ältesten Bahnhöfe der Elektrischen. Am Ende des 19. Jahrhunderts war hier der Ausgangspunkt der Eisenbahn, die Athen mit dem Hafen Piräus verband.
Nikos Panajotopoulos will mich von hier aus durch die Viertel Psirri, Gazi und Metaxourgio führen, wirft davor aber noch einen belustigten Blick hoch zur Akropolis.
"Die Antike ist nur für die Touristen. Ich weiß nicht, wie viele Athener wirklich einmal oben auf der Akropolis waren. Besser gesagt, wie wenige. Sie sehen sie sich von unten an. Die Akropolis ist da, sie ist ein Teil Athens. Nach dem Motto: Bravo, das waren welche von uns."
Es ist in dieser Zeit unmöglich, über Athen zu sprechen – ohne auf die Finanzkrise zu kommen. Sie macht sich überall bemerkbar und hat Konsequenzen für fast jeden. Natürlich auch für Nikos Panajotopoulos. Der lokale Markt für Fernsehserien ist völlig zusammengebrochen. Ganz Griechenland schaut jetzt entweder Wiederholungen von Basketball- oder Fußballspielen – oder billig eingekaufte Serien aus der Türkei. Panajotopoulos lebt inzwischen davon, dass er vor allem im Ausland Drehbuchseminare gibt:
"Meine Arbeit hat sich in Luft aufgelöst. Sie ist eine Luxusarbeit. Fernsehserien – das kannst du natürlich nur machen, wenn alles gut läuft. Wenn´s schlecht läuft, haben wir andere Probleme."
Wir sind in Psirri angelangt, einem Viertel, das in den Neunziger Jahren neu erschlossen wurde und Restaurants, Cafés und Theater entstanden. Die Restaurants gibt es noch, aber die Theater sind, wie das Theater Embros zum Beispiel, schon lange wegen gestrichener Fördergelder wieder geschlossen.
Panajotopoulos: "In Griechenland geht die Schere immer weiter auf, die Diskrepanz zwischen den beiden Teilen der Gesellschaft wird immer größer. Ich sehe eine total gespaltete Gesellschaft. Alle betrachten einander mit Misstrauen. Keiner vertraut dem anderen. Du wirst wahrscheinlich auch niemanden finden, der noch an eine funktionierende Justiz glaubt. Seit der Krise ist es noch schlimmer geworden, dieses: Ich, meine Familie und die anderen. Und es gibt einen großen Teil der Gesellschaft, der seine Privilegien mit Zähnen und Klauen verteidigt."
Wir kommen zu einer kühl eingerichteten Bar, die sich auch in Berlin Mitte befinden könnte. In der Bar Aeroflot hängen Schriftzüge von der russischen Fluggesellschaft und von der griechischen Olympic Air an den Wänden. Auf Apothekerschränken reihen sich die Whiskeysorten. Aber vielleicht ist die Bar einfach zu schick. Die Tische sind leer. Dafür steht eine Menschentraube in einer nahen Fußgängerzone vor einer Kneipe, in der gerade ein Konzert stattfindet.
Panajotopoulos: "Athen ist eine süße Stadt. Das Klima ist gut zu den Menschen. Und auch die Menschen, die hier leben, sind zum Glück noch offen für andere und warmherzig. Aber gleichzeitig gibt es tausende Gründe, das Land und diese Stadt zu hassen. Niemand fühlt sich hier als Teil einer Gemeinschaft, also fängt man an, sich zurückzuziehen. Die Stadt ist paradox, das Schöne und das Hässliche liegen sehr dicht beieinander. Und die Stadt verjagt die Einwanderer, die sie vorher benutzt hat. Das ganze gegenwärtige Athen wurde von Ausländern gebaut, und jetzt, wo die Arbeit stillsteht, sollen sie wieder gehen."
Für die Künstler, sagt er, sei die Krise natürlich nützlich:
"Sie schüttelt die Dinge durcheinander, und die Kruste fällt ab, und du siehst, was darunter brodelt. Athen ist ein Topf, in dem es brodelt. Das siehst du jedes Mal, wenn die Studenten aufstehen und demonstrieren und die Polizei sie auf brutale Weise auseinandertreibt. Die Krise verändert nicht mein Schreiben, aber mich vielleicht – als Mensch. Sie verändert den Blick."
Wir sind bestimmt über eine Stunde gegangen, aber die in den Abendstunden beleuchtete Akropolis bleibt in Sichtweite, ein Blick über die Schulter genügt. Alle Wege führen irgendwann doch zu einer archäologischen Stätte zurück. Wir erreichen die Ausfallstraße Pireos. Hier liegt der Kerameikos, der alte antike Friedhof, und nur wenige hundert Meter weiter südlich schließt sich das Ausgehviertel Gazi an mit seinen Bars und den zum Kulturzentrum umgebauten ehemaligen Gaswerken. In den belebten Straßen finden sich Bars und Clubs, Striptease-Läden und Bordelle. Als wir an einer ehemaligen Fabrik stehen, erzählt Nikos Panajotopoulos:
"Zwei Schauspieler haben aus dem Komplex ein Theater gemacht. Es gab hier vor kurzem einen großen Skandal mit Ausschreitungen als ein Stück gezeigt wurde, das viele Christen als Provokation empfanden. Es gab einen Menschenauflauf und Randale, auch Faschisten der Goldenen Morgenröte mischten mit. Das da hinten ist übrigens das Kino- und Filmzentrum Athens. Das war früher ein Pornokino. Es ist natürlich schön, dass es dieses Zentrum überhaupt gibt. Aber wenn man bedenkt: Für 5,5 Millionen Einwohner gibt es dieses eine Kulturkino! Für die guten griechischen Filme, die in ganz Europa gefeiert werden, gibt es kaum Publikum."
Doch die Bars in Gazi sind voll.
Später – wir sitzen gegen Mitternacht in einer ruhigen Taverne – sagt Nikos Panajotopoulos, dass die Krise doch Einfluss auf sein Schreiben habe. Als die Krise begann, erschreckte ein Unfall die Bewohner Athens, weil viele ihn für symptomatisch für die neuen Zustände hielten: Ein Obdachloser hatte in einem Müllcontainer übernachtet. Die Müllmänner entdeckten ihn nicht und kippten den Schlafenden in den Müllwagen, wo er zermalmt wurde. Die Sache hat Nikos Panajotopoulos so beschäftigt, dass er ein Stück darüber geschrieben hat:
"In Athen regiert das Schweigen. Die Menschen wollen nicht darüber reden, was mit ihnen geschieht. Niemand spricht über die harte Wirklichkeit der Stadt. Du hörst Menschen, die sagen: Ich bin kein Rassist – ich will bloß keine Einwanderer. Oder: Wir sind keine Nationalisten, aber alles Gute kommt eben aus Griechenland. Schweigen bedeutet, dass Du nicht in den Spiegel gucken willst."
Exkurs: Kaimos oder Ein historischer Schnelldurchlauf
Kaimos. Zu übersetzen als Kummer, tiefes Leiden, das über persönliches Leid hinausgeht und einen kollektiven Schmerz meint, der zum kulturellen griechischen Selbstverständnis gehört und in vielen Liedern besungen, beklagt und zelebriert wird.
Kaimos ist auch der Titel eines Liedes, komponiert von Mikis Theodorakis und zum ersten Mal 1962 von Grigoris Bithikotsis gesungen. Nachgesungen haben es viele wie Vicky Leandros – oder Maria Farantouri:
"Es ist groß das Meer, es ist lang die Welle. Es ist groß die Sorge und bitter das Unglück. Bitterer Fluss ist in mir das Blut Deiner Wunde, doch bitterer als das Blut ist Dein Kuss auf den Mund."
Was wie ein Liebeslied klingt, ist ein hoch politischer Text. Er bezieht sich auf den griechischen Bürgerkrieg, der von 1946 bis 1949 wütete. Mit Kaimos lässt sich aber auch das ambivalente Verhältnis vieler Athener zu ihrer Stadt beschreiben. Die Ur-Klage begann früh, und auch sie hat mit der Akropolis, beziehungsweise mit dem Schmerz über die vergangene Größe zu tun. Die Hochzeit des antiken Athens lag bekanntlich im 5. vorchristlichen Jahrhundert. Politisch hatte es seinen Part aber schon mit dem Ende des Peloponnesischen Krieges im Jahr 404. gespielt.
"Athen fiel in einen langen, Jahrhunderte dauernden Schlaf, aus dem es erst 1834, als es aus Traditionsgründen Hauptstadt des neuen griechischen Staates wurde, erweckt wurde. Denn das Machtzentrum hatte sich von Rom nicht etwa nach Attika, sondern an den fernen Bosporus verlagert, nach Byzanz oder Konstantinopel, und obwohl seiner Ausprägung nach griechisch, hatte dieses für Athen keinen Platz."
Das schreibt Gerhard Emrich in seinem „Poetischen Athen-Führer" und zitiert ein Gedicht des Gelehrten Michael Choniates, der über den elenden Zustand der bewunderten Stadt erschrak, als er im Jahr 1182 als Erzbischof nach Athen kam:
Die Liebe zu Athen, dessen Ruhm einst weit erscholl, schrieb dieses nieder, doch mit Wolken spielt sie nur und kühlt an Schatten ihrer Sehnsucht heiße Glut. Denn nimmer, ach! Und nirgend mehr erschaut mein Blick Hier jene einst im Lied so hochgepriesene Stadt. ...Athen bewohn ich und doch schau ich nicht Athen, nur Öde Herrlichkeit bedeckt mit grausem Schutt.
Es ist eine Klage, die bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts ähnlich klingen wird. Trauernd beugt man sich über die einst bedeutsamen Scherben der Vergangenheit, während die Stadt, auch unter dem Einfluss der osmanischen Besetzung, immer orientalischer wird. Eine versuchte Wiederbelebung des antiken Erbes findet dann mit der Gründung des neugriechischen Staates 1821 statt. Gerhard Emrich:
Im 19. Jahrhundert werden gewaltige Anstrengungen unternommen, die alten Denkmäler einer Hochkultur vom „grausen Schutt" zu befreien, in Athen und an anderen antiken Stätten Griechenlands. In Athen wird das klassischste aller Relikte, die Akropolis, nicht nur vom Schutt, sondern auch von allen Zutaten der Jahrhunderte befreit. Denn die Kultstätte antiker Götter war zuerst christlich, dann muslimisch geworden, der Parthenon zuletzt gar eine Pulverkammer, der ganze Burgberg wie zu seinen Anfängen eine bewohnte Festung.
Für die Griechen selbst brachte der Bezug zu den übergroßen Vorfahren nicht nur eine Aufwertung mit sich; es nistete sich auch ein latentes Minderwertigkeitsgefühl im kollektiven Bewusstsein ein sowie das fatalistische Eingeständnis, diesem Vergleich niemals standhalten zu können. Und der schmerzhafte Wunsch, dass der antike Geist, der längst weitergewandert war, irgendwann nach Hause zurückkehren möge. Geradezu euphorisch imaginierte der griechische Nationaldichter Kostis Palamas, 1859 in Patras geboren, diese Heimkehr in dem Gedicht „Hundert Stimmen, Nr. 97 (Karyatide)", anhand der Rückkehr einer Karyatide aus dem Britischen Museum zu ihrem angestammten Platz auf der Akropolis.
"O Karyatiden, kennt ihr mich nicht? Ich bin keine Fremde/ auch wenn aus der Fremde ich wiederkam. Die verlorene/ Schwester bin ich/ umarmt mich wieder, mein Platz hier wartet auf mich wie ein Thron./ Franken, Alemannen und Skythen, von meiner Milch haben alle getrunken,/die Diebe wurden zu Helden, jetzt schlägt das Herz des Barbaren/ vom teuren Blut der hellenischen Väter./ Aus der Jugend der Welt bin wiedererblüht, eine Diebin, die euch der Antike heilige Flamme in neuem Rohr verborgen/ zurückbringt."
Für Palamas kommt die Karyatide „verfeinert durch abendländischen Gelehrtenfleiß" wieder, wie Gerhard Emrich schreibt. Für den großen griechischen Dichter und Nobelpreisträger Giorgos Seferis ist Jahrzehnte später, also schon im 20. Jahrhundert, eine solche Art von Rückkehr nicht mehr möglich. Seferis wurde 1900 in Smyrna geboren. Er war 1914 nach Athen umgesiedelt, lebte aber 1922, als der Griechisch-Türkische Krieg mit dem Sieg der Türkei endete, als Student in Paris. Die sogenannte „Kleinasiatische Katastrophe", die einen gigantischen Bevölkerungsaustausch zwischen Griechenland und der Türkei zur Folge hatte, markierte für ihn das Ende der Idee, dass die Ideale der Antike im modernen Griechenland noch irgendeine Bedeutung haben könnten. Mitte der Zwanziger Jahre kam Giorgos Seferis nach Athen zurück und erlebte die Stadt als krank. Er begann, ein Buch unter dem Titel „Sechs Nächte auf der Akropolis" zu schreiben. In einem Tagebucheintrag, den der Herausgeber Asteris Kutulas im Nachwort der Deutschen Ausgabe zitiert, schreibt Seferis:
"Der Grundgedanke ist die Krankheit Athens, die Krankheit, die von Athen ausgeht, nicht die Vorstellung des einen oder anderen Typs."
Athen, oder wie Kutulas schreibt, die „Stadt der Städte", entpuppt sich als Ort der Kommunikationslosigkeit. In dem Roman versucht ein Freundeskreis um die Hauptfigur Strathis, in der Sphäre der vom Mond beschienenen Akropolis diese Isolation zu überwinden. Aber das gelingt nicht. Für Strathis und all die anderen phantasmagorischen Figuren scheint jeder Tag der letzte zu sein. Und Salome, das, wie Kutulas schreibt, „einzig lebende Molekül" in diesem Buch, ist am Ende tot:
"Dienstag, spät in der Nacht. Wir gingen noch einmal auf die Akropolis. Heute Abend. Der vollrunde Mond spendete wässriges Licht, leichthin. Der Fels reiste durch die Lüfte, und wir liefen übers Deck der Galeere, alle Segel gesetzt. In der Nähe des Nike-Tempels blieben wir stehen. Ich umfasste ihre Taille. Ich fühlte, dass der Durst uns nicht mehr trennte. – Salome, zum ersten Mal spüre ich an meiner Seite einen Menschen...einen Menschen meines Schlags. Sie sah mich an. In ihrem Gesicht dieser Ausdruck, den ich liebgewonnen hatte während unserer Rückkehr aus Asteri... – Weißt Du, ich heiße nicht Salome; ich heiße Bilio. Eine Prozession von Mythologien zog an mir vorbei und entschwand; eine Flügelschar. – Und was noch bedeutender ist, fuhr sie fort, wir werden uns nie mehr trennen. Mir war, als würde unser Schiff durch einen Kanal fahren; ich fühlte mich eingeengt. – Jetzt, sagte ich, ist die Trennung belanglos. – Umso besser ...Weißt du, ich werde nicht lange leben. Ein laut tönender Rhythmus rollte über das Meer des Mondes und kam mir immer näher. Dann funkelten, wie die Augen der Tiere auf nächtlichen Straßen, in meiner Erinnerung die Marmorblöcke jenes Tages. – Ach, zusammen unter der Sonne leben, sagte ich. – Ja, unter der Sonne, erwiderte sie. Für mich ist die Akropolis passé. Ebenso unser Freundeskreis... Ich sprach kein Wort. Wir waren oben an der Marmortreppe angelangt. – Lass mich allein gehen; es wäre mir lieber. – Mach´s gut, sagte ich. – Mach´s gut. Vergiss mich nicht. Sie stieg die Treppe hinunter. ... Ich betrachtete sie. Mir schien plötzlich, als schlucke der Marmor alles Licht und stürze mit ihm in die totale Finsternis. „Aber wer bin ich denn nun?", fragte ich mich wie im Traum."
Athen ist vom größeren Dorf zu Beginn des letzten Jahrhunderts zur vielfachen Millionenstadt angewachsen. Und die Gründe, den Kaimos, das kollektive Leid wie im Rembetiko, dem „griechischen Blues", zu besingen, wurden immer zahlreicher. Ursprünglich entwickelte sich der Rembetiko aus der Verbindung griechischer Volksmusik und osmanischer Musiktraditionen und wurde in den Zwanziger Jahren des 20. Jahrhunderts vor allem in Athen, Piräus und Thessaloniki von den Flüchtlingen gespielt, die nach der Kleinasiatischen Katastrophe aus Smyrna oder von der kleinasiatischen Küste vertrieben worden waren und die verlorene Heimat besangen. Später kamen weitere Traueranlässe hinzu und legten sich wie Ringe um das kollektive Gemüt: die Diktatur von General Ioannis Metaxas ab 1936, die Besetzung durch die Deutschen 1941-44, der sich anschließende Bürgerkrieg bis 1949 und schließlich das Regime der Militärdiktatur von 1967-1974. Die Volksmusik, die in Griechenland ohnehin einen hohen Stellenwert hatte, wurde zum Ventil für die unterschiedlichen Ausprägungen des Kaimos - zu einer Möglichkeit, dem Schmerz Ausdruck zu verleihen und ihn zugleich zu überwinden, das Ach! des Fatalismus zu zelebrieren und gleichzeitig durch Musik und Lieder Widerstand zu leisten.
Vor allem in den Jahren der Militärdiktatur beteiligten sich viele Musiker am Widerstand, die Menschen hörten die Lieder heimlich und sangen sie nach dem Rücktritt der Obristen auf den ersten Konzerten 1974 von Mikis Theodorakis oder Nikos Xilouris wie Nationalgesänge der Freiheit.
Xilouris singt: Mpikan stin poli oi ochtroi
Die Feinde sind in die Stadt eingedrungen
Die Türen haben sie eingeschlagen, die Feinde
Und wir haben in der Nachbarschaft gelacht
Am ersten Tag
Die Feinde sind in die Stadt eingedrungen
Haben unsere Brüder mitgenommen
Und wir hatten nur Augen für Frauen
Am folgenden Tag
Die Feinde sind in die Stadt eingedrungen
Haben bei uns Feuer gelegt, die Feinde
Und wir haben im Dunkeln geschrien
Am dritten Tag
Die Türen haben sie eingeschlagen, die Feinde
Und wir haben in der Nachbarschaft gelacht
Am ersten Tag
Die Feinde sind in die Stadt eingedrungen
Haben unsere Brüder mitgenommen
Und wir hatten nur Augen für Frauen
Am folgenden Tag
Die Feinde sind in die Stadt eingedrungen
Haben bei uns Feuer gelegt, die Feinde
Und wir haben im Dunkeln geschrien
Am dritten Tag
Athen − Der Platz der Blumen
Am nächsten Abendbin ich mit dem Schriftsteller Theodoros Grigoriadis verabredet. Grigoriadis, Ende 50 und frühpensionierter Lehrer, hat einen schönen Roman mit dem Titel „Ellys Geheimnis" geschrieben. Darin geht es viel um die veränderten Lebensbedingungen während der Finanzkrise. Ein arbeitsloser Familienvater beginnt eine Affäre mit einer alleinstehenden Lehrerin. Wir könnten uns in Gazi treffen, wo der Roman spielt, schlage ich vor, aber Theodoros Grigoriadis will mir stattdessen die Plateia Agias Irinis, den Platz der Hl. Irene zeigen, den momentanen Hotspot der Stadt nicht weit vom Syntagma-Platz entfernt.
Die Plateia Agias Irinis liegt im klassischen Handelszentrum, was wohl verhindern wird, dass sie wieder verödet, sobald die Künstler und Intellektuellen sich woanders treffen. In Athen zieht die symbolische Aufwertung einer Gegend durch Künstler höchstens punktuell steigende Immobilienpreise nach sich.
Grigoriadis: "Selbst in den guten Vierteln ist der Wert der Immobilien auf die Hälfte gefallen. In den ehemals bürgerlichen Vierteln, in denen heute vor allem Migranten und Flüchtlinge leben, kosten Einzimmerwohnungen manchmal nur 5000 Euro. Wir zahlen aber Steuern nicht auf den realen, sondern auf einen hypothetischen Wert, der im Moment 100 Prozent über dem Realen liegt. Wenn dieser veranschlagte Wohnungswert nicht nach unten korrigiert wird, müssen viele ihre Wohnungen verkaufen."
Erstaunlicherweise sei der Buchmarkt in der Krise nicht ganz so stark eingebrochen wie zu befürchten war:
"Natürlich: Verlage mussten schließen, Ketten wie „Elefterodakis" haben dichtgemacht, und die Zeit, in der Autoren Vorschüsse bekamen, ist natürlich auch vorbei. Aber die sogenannte Rosé-Literatur wird noch immer gekauft. So heißen die simpel gestrickten Unterhaltungsromane wegen ihrer negligéfarbenen Cover. Aber auch Bücher über die verlorenen Gegenden Griechenlands gehen bestens: Bücher über Alexandria, Konstantinopel, Smyrna. Sie füttern ein nostalgisches Bedürfnis. Es ist, als ob Du gerührt Postkarten anschaust."
Von nostalgischen Gefühlen ist auch Theodoros Grigoriadis nicht ganz frei:
"Athen hat sich sehr verändert. Vor 25 Jahren war Athen noch sehr provinziell, weder modern noch traditionell, es gab eigentlich gar nichts. Dann fielen Gelder vom Himmel, also das Geld, das wir jetzt schulden und bis ins Jahr 2004, bis zur Olympiade, wurde Athen hergerichtet, das war ein regelrechter Modernisierungsschub sogar ins Postmoderne hinein. Das Athen, nach dem sich jetzt alle sehnen, ist das alte Athen der fünfziger und sechziger Jahre. Das war die Akropolis, dann Ano Petralona, Syntagma, Omonia, Patissia. Das ist das alte Athen mit den kleinen Häusern und den leeren Straßen, das in den Schwarzweißfilmen gezeigt wird. Interessant ist, dass dort, wo früher das kleinbürgerliche Athen war und die gesellschaftlichen Aufsteiger gelebt haben, fast nur noch Nicht-Griechen leben. Es gibt rumänische Viertel, afrikanische, pakistanische, und nur noch wenige Griechen leben dort."
Wie aufs Stichwort kommt der nächste Leierkastenmann an der Terrasse vorbei. Theodoros kennt den älteren Herrn im altertümlichen Anzug sogar. Wie so viele hat auch er zwei Jobs. Tagsüber steht er an einem U-Bahn-Eingang und versucht, vorbeihetzenden Passanten Lose zu verkaufen.
Athener Filmnächte oder: Auf Leben und Tod
Grigoriadis meinte mit den Schwarzweißfilmen aus der alten Zeit Filme wie „Stella" von Michalis Kakojiannis, dem Regisseur, der mit „Zorbas the Greek" weltberühmt wurde. In „Stella" aus dem Jahre 1955 lässt Kakojannis die wunderbare Melina Mercouri als freiheitsliebende Sängerin am machohaften Stolz des Fußballspieler Milto scheitern.
Die Tragik der Musik, die Freiheitsliebe der Merkouri, die eher stirbt, als sich in das Korsett der unterwürfigen Ehefrau zu begeben. Eine verknöcherte Gesellschaft, die zwar beim abendlichen Amüsement in den Bouzouki-Läden die alten Widerstandsklassiker mitschmettert, aber keine Gnade kennt, wenn sich eine Frau der Konvention zu entziehen versucht. Paradisos – Paradies heißt das Etablissement, in dem sich dieses Drama ereignet, und auf dem Werbeplakat am Eingang steht: „Alle Lieder über das Leben, die Liebe und den Tod, die die Psyche des griechischen Volkes spiegeln."
Über fünfzig Jahre später, 2012, drehte der Regisseur Panos Koutra den Film „Strella" über Athener Nächte der Gegenwart. „Strella", eine Mischung aus dem Namen Stella und dem Wort trellos, was verrückt bedeutet, spielt im Milieu der Drag Queens und Transsexuellen. Nachdem Giorgos, wegen Totschlags zu fünfzehn Jahren verurteilt, aus dem Gefängnis kommt, lernt er die verrückte Strella kennen, eine Transsexuelle, die als Prostituierte arbeitet und in Nachtclubs lustige Auftritte als koksendes Maria Callas-Double hinlegt.
Das Leben, die Liebe, der Tod. Mit geradezu antiker Archaik geht auch dieser Film zu Werke. Denn kaum haben Giorgos und Strella eine Affäre begonnen, kommt heraus, dass die junge Frau eigentlich Giorgos´ Sohn ist, der, als sein Vater ins Gefängnis kam, noch ein Kind war. Ödipus im 21. Jahrhundert. Der Sohn schläft, zur Frau geworden, mit seinem Vater und wird von ihm deswegen fast erschlagen.
Athen – die unsichtbare Stadt
Lykabettos: Glockenturm
Ikone, Öllicht
Lied, ein Lächeln in
meinen Augen, auf den Lippen.
Thanos Kitsikopoulos. Lykabettos.
Ikone, Öllicht
Lied, ein Lächeln in
meinen Augen, auf den Lippen.
Thanos Kitsikopoulos. Lykabettos.
Athen bildet, von oben betrachtet, ein uferloses Häusermeer, doch innerhalb des Zentrums sind die Wege kurz. Von der Plateia Agias Irinis unterhalb des Syntagma-Platzes braucht man mit dem Roller nur ein paar Minuten nach Exarchia – oder nach Kolonaki. Beide Viertel liegen unterhalb des Hügels Lykabettos. Kolonaki und Exarchia grenzen aneinander, aber zwischen ihnen verläuft ein unsichtbarer unüberbrückbarer Graben. Manchmal ist Athen nur ein Dorf, in dem Feindschaften über Generationen gepflegt werden.
Kolonaki, das Viertel der Boutiquen und Juweliere, der Fernsehköche, Starlets und berühmten Schauspieler. Auch wenn viele Geschäfte inzwischen leer stehen, an der Plateia Kolonakiou sieht man sie noch immer: die Jeeps auf den Bürgersteigen und die Frauen mit den großen Sonnenbrillen und den sperrigen Gucci-Tüten. Und auf der anderen Seite: Exarchia, das Viertel der Buchhandlungen, Druckereien und einer noch höchst lebendigen Anarchistenszene.
Hier treffe ich Petros, einen freundlichen Untergrund-Dichter, wie er selbst genannt werden möchte. Petros ist Anfang dreißig, er sitzt in einem Café in der Nähe der Plateia Exarchiou. Hier kostet der Kaffee noch einen Euro und nicht vier, wie im Nachbarviertel. Mit seiner Vespa bräuchte er nicht einmal eine Minute nach Kolonaki, aber nach Kolonaki würde er niemals fahren, aus Prinzip nicht. Kolonaki und all die anderen Bezirke der Reichen oder angeblich ehemals Reichen, liegen auf der Seite des korrupten Establishments. Petros ist sehr sympathisch, er spricht viel, aber eben nicht in ein Mikrofon, aus Prinzip nicht. Er hebt den Zeigefinger, schüttelt leicht den Kopf und sagt bedauernd NEIN. Wir bleiben hier unter uns, sagt er, im versteckten, im unsichtbaren Athen. Man könnte auch sagen: im Athen des Ochi. Im Athen des Nein.
Das Nein gehört ohnehin zum griechischen Selbstverständnis – wie der Kaimos. Es gibt sogar einen staatlichen Ochi-Tag, an dem das Nein! gefeiert wird, mit dem General Ioannis Metaxas 1940 auf Mussolinis Forderung der Kapitulation reagierte. Aber nirgendwo sonst beherrscht das Nein das Lebensgefühl so stark wie in Exarchia. Hier wohnt Petros, hier arbeitet er als Bote für einen Verlag, hier trifft er die immer gleichen Freunde. Über Politik redet er nicht. Das führe eh zu nichts. Dafür aber über die Vergangenheit. Sein Großvater war Kommunist. Er zeigt auf die nächste Straßenkreuzung. In den Dezembertagen 1944, als nach Abzug der Deutschen Wehrmacht blutige Kämpfe zwischen den linken und bürgerlichen Widerstandsgruppen ausbrachen, verlief genau dort die Frontlinie. Überall gab es Stacheldraht. Er erzählt von dem Tunnel, den die Linken gegraben hatten, um das Hotel „Grande Bretagne" und darin den Britischen General Scobie in die Luft zu sprengen. Die Aktion wurde abgeblasen, weil auch Churchill sich zum Zeitpunkt des Anschlages im Hotel aufhalten sollte.
Petros nennt Straßennahmen, markiert Viertel, zeichnet die Verschiebungen der Kampflinie in die Luft, die Karte eines geheimen, für ihn noch immer gegenwärtigen Athens, in dem sich zwei Parteien auf Leben und Tod gegenüberstehen. Er lächelt, umgeben von seinen Geistern, und mir fällt ein, dass die Gegend ja nicht nur zu Beginn des Bürgerkriegs umkämpft war, sondern auch 30 Jahre später durch einen anderen Kampf zu mythischer Bedeutung gelangte. In der Technischen Universität, Polytechnio, genannt, läutete der Aufstand der Studenten im November 1973 das Ende der Militärdiktatur ein, deren Unterdrückung der Dichter Jannis Ritsos zwei Jahre zuvor in dem Gedicht „Athener Straße" so eingefangen hatte:
Der blinde Musikant, der blinde Loskäufer,
der blinde Tag, der blinde Hund, die Niki-Straße;
Gitarre, Violine, Akkordeon; am blindeste die Gitarre;
du vertauschtest ihre Plätze, du gabst ihnen das Lied an;
der Losverkäufer: die Violine; der Hund: die Lose;
die Alte: das Akkordeon; die Gitarre: für sich allein.
Wie schön die Musik klingt in der Niki-Straße am frühen Abend
vor der Apotheke, wo sie auf die Straße werfen
die braunen Fläschchen mit den Schlafmitteln
und die abgeschnittenen Finger des letzten Kunden:
Des schönen Pianisten des Abendrestaurants.
Und es waren ausgegangen die Binden und der Ersatz.
der blinde Tag, der blinde Hund, die Niki-Straße;
Gitarre, Violine, Akkordeon; am blindeste die Gitarre;
du vertauschtest ihre Plätze, du gabst ihnen das Lied an;
der Losverkäufer: die Violine; der Hund: die Lose;
die Alte: das Akkordeon; die Gitarre: für sich allein.
Wie schön die Musik klingt in der Niki-Straße am frühen Abend
vor der Apotheke, wo sie auf die Straße werfen
die braunen Fläschchen mit den Schlafmitteln
und die abgeschnittenen Finger des letzten Kunden:
Des schönen Pianisten des Abendrestaurants.
Und es waren ausgegangen die Binden und der Ersatz.
Petros verabschiedet sich bald wieder, aber ich bleibe noch an der Plateia Exarchiou, wo Menschen aus aller Herren Länder friedlich auf den Bänken sitzen und ihr Bier trinken.
Die Restaurants und Imbisse sind voll. In einer Bar tragen die beiden Frauen hinterm Tresen pinkfarbene Perücken, laden auf ihrem Computer You-Tube Lieder aus der guten alten Athener Zeit herunter und küssen sich theatralisch wie auf einer Bühne.
Zwei Häuser weiter wird live gespielt. Ein junger Mann, ein älterer Mann, eine junge Frau, die, wenn sie gerade nicht singt, Kette raucht und literweise Wasser in sich hineinschüttet. Als ich um drei Uhr morgens nach draußen trete, steht ein einsames Taxi auf der Straße. Der Fahrer kommt mit ausgebreiteten Armen auf mich zu, als seien wir Freunde, und lässt die Arme sinken, als ich mich auf die Vespa schwinge.
Auf nach Piräus!
In Phaliron
Die Öde hat uns gestern wieder hergebracht
Nach Phaliron, an einen Streifen Strand
- einst Liebeshöhle für uns beide.
Noch weiter weg, einsam im Abend,
sich zart berührend, Hand in Hand,
saßen zwei verliebte junge Menschen.
Uns aber suchte unser Herz vergeblich
Uns alte Freuden in Erinnerung zu rufen.
Und als allmählich uns die Kühle fasste,
„Was sollen wir", so sprachst du, „hier um diese Zeit?"
Es war – gewiss – erschreckend kalt
Am Strand an jenem Abend
Die anderen aber waren doch geblieben...
Sophia Mavroidi-Papadaki. In Phaliron.
Die Öde hat uns gestern wieder hergebracht
Nach Phaliron, an einen Streifen Strand
- einst Liebeshöhle für uns beide.
Noch weiter weg, einsam im Abend,
sich zart berührend, Hand in Hand,
saßen zwei verliebte junge Menschen.
Uns aber suchte unser Herz vergeblich
Uns alte Freuden in Erinnerung zu rufen.
Und als allmählich uns die Kühle fasste,
„Was sollen wir", so sprachst du, „hier um diese Zeit?"
Es war – gewiss – erschreckend kalt
Am Strand an jenem Abend
Die anderen aber waren doch geblieben...
Sophia Mavroidi-Papadaki. In Phaliron.
Athen ist ein Fluchtpunkt. Nicht nur für Menschen aus Asien oder Afrika, sondern schon das ganze 20. Jahrhundert hindurch vor allem für die Griechen selbst. Vor einhundert Jahren kamen die Flüchtlinge von der kleinasiatischen Küste; nach Krieg und Bürgerkrieg strömten sie aus den armen Provinzen in die Hauptstadt, ein letztes Mal in den 1980er Jahren, als der damalige Premier Andreas Papandreou Arbeit und Geld für alle versprach. Piräus zum Beispiel, Athens berühmter Hafen, ist – trotz seines Alters – zugleich ein Industriezentrum, das in jüngerer Zeit entstanden ist. Der Schriftsteller Christos Ikonomou ist hier aufgewachsen und hat ein Buch mit Kurzgeschichten über Menschen aus Piräus geschrieben, das unter dem Titel „Warte nur, es geschieht schon was", auch auf Deutsch erschienen ist:
"Perama liegt dort gegenüber, und einige Blöcke weiter beginnt das Viertel Nikia, und es beginnen dort all die Gebiete - Koridalos, Keratsini -, die von Flüchtlingen gegründet wurden, von Griechen, nach der Kleinasiatischen Katastrophe."
Von der alten, besonderen Architektur, die diese Gegend früher ausgezeichnet hat, ist nichts mehr geblieben. Mit bitterer Genugtuung zeigt Christos Ikonomou auf das Rathaus, das sich mit geradezu grotesker Hässlichkeit aus dem Dunkeln abhebt.
"Du siehst, dass es keinerlei Achtung gibt vor dem, was wir den öffentlichen Raum nennen. Dieses Gebäude ist nicht nur ästhetisch eine Zumutung, es stößt dich regelrecht zurück. Und das ist ein Grund für die Gleichgültigkeit des Bürgers gegenüber dem Gemeinwesen. Der Bürger denkt sich: Warum soll ich mich kümmern? Was soll ich hier eigentlich respektieren und achten?"
Doch was war zuerst da? Es ist wie mit der Henne und dem Ei. Denn auch der Einzelne hat Teil am abstoßenden Eindruck der Stadt. Antiparochi heißt das Schreckenswort, das so viel wie Gegenleistung bedeutet. Besitzer eines Grundstückes ohne viel Geld können sich von Bauherren ein Mehrfamilienhaus auf ihren Grund setzen lassen. Von den, sagen wir, zehn entstehenden Wohnungen fallen sieben an den Bauherren und drei an den Grundstücksbesitzer. In einer wohnt er selbst, die anderen beiden vermietet er. So entsteht Einkommen ohne Arbeit. Und so wurden fast alle der kleinen bescheidenen Einwanderhäuschen durch gleichförmige Mietwohnschachteln ersetzt, denen die Gleichgültigkeit für alles andere als den persönlichen Gewinn von der schäbigen Betonfassade springt. Gerade dieses Rohe, Ungeschminkte entfaltet aber auch eine erschreckende Faszination.
Ikonomou: "Athen ist eine Stadt mit sehr vielen Widersprüchen, und in der Krise sieht man diese Widersprüche umso klarer. Es gibt Eindrücke, die nicht zusammen passen. Die Hässlichkeit am Tag, aber am Abend ist Athen bezaubernd, da hat sie ein mysteriöses Aroma, was damit zu tun hat, dass sie sehr viele Erinnerungen mit sich führt. Du gehst um eine Ecke und siehst unerwartetes Elend, und eine Straße weiter etwas unerwartet Schönes, ein Gesicht, einen helfenden Menschen oder ein schönes Geschäft. Athen ist eine Landschaft, ein Ort, der sich ständig ändert. Eben, als wir durch Piräus gelaufen sind, hast Du gesehen, wie sich in wenigen Minuten alles geändert hat: die Menschen, die Architektur. Es ist nicht einfach, das in Schubladen zu packen."
Inzwischen sitzen wir in einem Café am alten Hafen von Piräus, dem Turkolimeno, an dem Hunderte Segelboote liegen. Es ist ein geradezu pittoreskes Bild. Die Boote, das den Mond spiegelnde Wasser, die beleuchteten Stadtviertel im Hintergrund. Als wollte er die Postkartenanmutung zerstören, erzählt Christos Ikonomou, dass am letzten Wochenende ein verrückt gewordener junger Mann mit einer Maschinenpistole in eine der vielen Promenadenbars gestürmt sei und im letzten Moment daran gehindert werden konnte, um sich zu schießen. Wahrscheinlich ein Eifersuchtsdrama.
"Die Konsequenzen der Diktatur und des Bürgerkriegs spürt man heute noch, diese Erbschaft ist natürlich noch viel stärker zu spüren als die der byzantinischen Zeit. Aber ich kann das nicht abtrennen und sagen, dieser Bereich, diese Phase der Geschichte interessiert mich am meisten. Viele Dinge, die sich in den letzten dreißig, vierzig Jahren ereignet haben, sind das Ergebnis des Bürgerkrieges: Die Linke verlor, die Rechten haben gewonnen. Und vieles spürt man eben auch heute noch, zum Beispiel in der Grundhaltung, jemanden zum Freund oder zum Feind zu erklären."
In seinem letzten Buch „Das Gute wird aus dem Meer kommen", das noch nicht in deutscher Übersetzung vorliegt, geht es um Menschen, die im Zuge der Krise Athen verlassen haben und nun auf einer fiktiven Insel die Erfahrung machen, selbst als Fremde nicht willkommen zu sein. Im Gegensatz zu seinen Figuren könnte Christos Ikonomou Athen allerdings niemals verlassen:
"Ich bin hier geboren und möchte alles über Griechenland schreiben oder zumindest schreiben können. Ich möchte alles über Griechenland lernen, um dann darüber schreiben zu können. Da, wo ich aufgewachsen bin, befand sich to mploko tis kokkinias, ein Platz, wo die Deutschen Massenerschießungen durchgeführt haben. Da haben sie Dutzende Menschen zusammengetrieben und dann erschossen, ganz nah am Haus meines Vaters. Diese Ereignisse sind ja noch lebendig."
Geht in Athen denn nie etwas vorbei? Die permanente Anwesenheit des Vergangenen – sie generiert bekanntlich Unfreiheit. Andererseits: Wenn das Gewebe der Gegenwart so locker zusammengefügt ist, dass die Geschehnisse aller Zeiten in den Maschen Platz finden – kommt das nicht einem zeitenthobenen Zustand der Ewigkeit ziemlich nah? Wie sagte Christos Ikonomou? Abends habe die Stadt ein mysteriöses Aroma, was daran liege, dass sie so viele Erinnerungen in sich berge.
Athen – die Stadt der Stille
Um ein Uhr nachts ist der Hafen von Piräus ein gespenstischer Ort. Die riesigen Fähren, die morgens nach Kreta, Rhodos oder zu den Kykladen ablegen, liegen verlassen an den Molen. Die weiten Rangierflächen sind menschenleer, die Ticketverschläge verbarrikadiert. Unter dem Vordach einer geschlossenen Cafeteria liegen Menschen in Schlafsäcken, ob Obdachlose oder Touristen ist nicht zu unterscheiden.
Die Nacht endet dort, wo der Tag bereits wieder beginnt: um vier Uhr dreißig, an der Markthalle im Zentrum der Stadt. Die Fleisch- und Fischstände werden vorbereitet, der Boden abgespritzt, ein erster Lastwagen ausgeladen. An dem einzigen Stand, der schon geöffnet hat, wollen mir zwei Metzger Koteletts verkaufen und verwickeln mich in ein Gespräch über das Leben und die Liebe im Allgemeinen. In Schweden, sagt der eine, hat man einem Mann erlaubt, ein Pferd zu heiraten. Ist doch verrückt!
Für einen Moment scheint die Zeit still zu stehen. Ich hole das Buch „Athen. Eine literarische Einladung aus der Tasche", blättere es durch und bleibe an dem Text von Nikos Panajotopoulos hängen:
"Ich bin in Athen geboren und aufgewachsen, und seit ich denken kann, meckere ich ununterbrochen über alles, was ich so sehe und höre und was sich um mich herum abspielt...Manchmal fange ich an zu brüllen, ich koche vor Wut, ich tobe! Ich hasse diese Stadt. Ich weiß nicht, ob sie mich verstehen...Ich vergöttere diese Stadt. Mein Herz ist eben zerrissen – genauso wie meine Stadt."