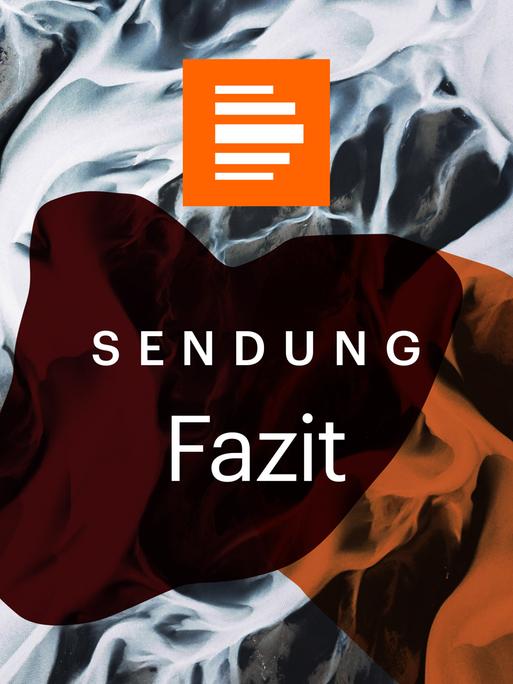Kommentar

Kunstprojekt "Verkehrsschilder der Gerechtigkeit" des Papiertheaters Nürnberg: Zivilcourage zeigen ist oft nicht einfach. © picture alliance / Eibner-Pressefoto / Ardan Fuessman
Appell gegen das Schweigen
04:38 Minuten

Wir alle kennen Momente wie diesen im Alltag: Jemand wird verbal angegriffen, und plötzlich ist es still. Unsicherheit, Angst oder Bequemlichkeit lassen uns schweigen. Doch raushalten können wir uns so nicht – das Schweigen macht uns zu Komplizen.
Neulich in der S-Bahn: Ein Mädchen mit Kopftuch steigt ein. Ein Mann brüllt: „Geht zurück, wo du herkommst!“ Stille. Niemand sagt etwas. Auch ich nicht. Ein einziger Satz hätte gereicht – doch er blieb mir im Hals stecken. Noch Tage später lässt es mich nicht los.
Warum fällt uns das Einschreiten so schwer – nicht nur in der Bahn, sondern auch am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft, kurz: überall dort, wo wir Unrecht oder aggressives Verhalten beobachten?
"Misch' dich nicht ein" ist das Motto
Es hat weniger mit Gleichgültigkeit zu tun, als mit einem Reflex, der tief in uns sitzt: „Misch' dich nicht ein.“ Und: „Halte dich raus.“ So wurden viele von uns erzogen. Anpassung galt als klug, Zurückhaltung als sicher. Und so wurde das Schweigen zu einer Art sozialem Schmierstoff – unauffällig, konfliktvermeidend. Dazu kommt der sogenannte Bystander-Effekt: Je mehr Zeugen, desto größer die Versuchung, Verantwortung an die anderen abzugeben.
Couragiert im Alltag aufzutreten, wurde vielen von uns als Kindern nicht vorgelebt: Zivilcourage heißt, genau diese unsichtbare Ordnung zu stören. Und Stören gilt in unserer Gesellschaft nicht als Tugend. Es bremst, hält auf, irritiert, ist unangenehm.
Wer sich einmischt, geht das Risiko ein, auf Ablehnung zu stoßen, Ärger zu provozieren oder gar in Gefahr zu geraten. Doch was heißt das für eine Gesellschaft, wenn Schweigen die Norm ist?
Mut heißt, den Kurs zu ändern
Zivilcourage ist nicht nur in Extremsituationen gefragt, sondern auch im Alltag: im Büro, wenn eine Kollegin von oben herab behandelt wird; in der Schule, wenn ein Kind ausgegrenzt wird; im Freundeskreis, wenn das Lästern beginnt. Mut bedeutet nicht immer, sich zwischen Täter und Opfer zu stellen. Mut heißt, den Kurs zu ändern. Ein paar Worte reichen oft: „Stopp!“ – „So reden wir hier nicht.“ – „Alles in Ordnung bei Ihnen?“
Vielleicht liegt das eigentliche Problem tiefer: Viele verwechseln Schweigen mit Neutralität. Als könnten wir uns heraushalten, wenn andere bloßgestellt, beleidigt oder gedemütigt werden. Doch Neutralität gibt es in solchen Momenten nicht. Wer nichts sagt, stellt sich auf die Seite des Stärkeren und stimmt dem Unrecht zu.
Genau hier zeigt sich, wie sehr Zivilcourage ein Prüfstein unserer Zeit ist. Denn wir leben in einer Gesellschaft, in der das öffentliche Klima rauer geworden ist. Hassparolen, Ausgrenzung, Abwertung – all das geschieht nicht nur im Verborgenen. Es geschieht laut, mitten unter uns. Je mehr wir dazu schweigen, desto normaler wird es.
Zivilcourage ist deshalb nicht nur ein privater Akt der Solidarität, sondern auch ein politischer. Sie setzt Grenzen, bevor eine Situation kippt.
Empathie ist ein seltenes Gut. Vielleicht, weil wir in einer Welt leben, in der Aufmerksamkeit eine knappe Ressource geworden ist. Wer ständig mit Arbeit, Terminen, digitalen Reizen beschäftigt ist, sieht das Leid anderer oft nur am Rande. Empathie braucht Zeit – und genau daran mangelt es. Vielleicht auch, weil wir uns an Härte gewöhnt haben: an die Logik des Wettbewerbs, an die Sprache der Abwertung, an die Illusion, dass Stärke mit emotionaler Kälte gleichzusetzen sei.
Wer eingreift, macht sich angreifbar
Risiken bleiben. Wer eingreift, macht sich angreifbar. Aber die entscheidende Frage lautet nicht, ob wir uns Zivilcourage leisten können – sondern ob wir es uns leisten können, sie zu unterlassen. Die bittere Wahrheit lautet: Schweigen schützt nie das Opfer, sondern immer den Täter.
Doch ohne Empathie verarmt das Zusammenleben. Zivilcourage ist ihre Praxis: Sie zeigt, dass wir einander nicht egal sind.
Das Schweigen ist der Resonanzraum der Aggression. Wer ihn unterbricht, macht den Ort für alle ein Stück sicherer – auch für Sie und für mich.