An der Grenze zum Kitsch
Der niederländische Philosoph Rob Riemen spürt der Geschichte der humanistischen Ideale nach. In seinem Essay ist viel von Freiheit die Rede, von der Pflicht zur Wahrheit und von der Kraft des Geistes - ohne dass jedoch von diesem oder jenem wirklich Gebrauch gemacht wird.
Um es vorwegzunehmen: das Buch hält nicht, was sein Titel verspricht. Wer das Diktum vom Adel des Geistes wörtlich nimmt und distinguierte, mutig-originelle oder womöglich sogar 'vornehme' Gedanken im Sinne Nietzsches erwartet, wird enttäuscht. Vielmehr eröffnet der Autor gleich mit jenem üblich gewordenen Muster, das vor Generalverdächtigungen schützt: Rob Riemen erzählt, wie er sich einst in New York mit der menschenrechtlich engagierten Elisabeth Mann Borgese traf, die ihn wiederum in das Schicksal eines alten Freundes, Joseph Goodman, einführte.
Goodman ist Jude, gebildet, sensibel, und zudem ein hochbegabter Komponist, dem 1938 die Flucht in die USA gelang, während seine Eltern ermordet wurden. Sein einziges Kind stirbt an einer Infektionskrankheit. Goodmans große Leidenschaft gilt dem amerikanischen Dichter Walt Whitman. Diesem hat er sein Lebenswerk gewidmet, eine symphonische Kantate mit dem Titel Nobilitiy of Spirit. Als Goodman auch noch die Schrecken des 11. Septembers erleben muss, ist für ihn die Sache sofort klar:
"Du meinst also..., dass wir einfach verstehen müssen, warum dreitausend unschuldige Menschen von ein paar religiösen Spinnern ermordet worden sind?! Als ob es so schwierig ist, zu begreifen, dass es wieder Faschisten sind, Menschen, die Böses wollen!"
Elisabeth Mann Borgese verhilft ihrem Freund daraufhin, dessen Kantate endlich zur Aufführung zu bringen, um ein Zeichen gegen das Böse zu setzen. Kurz darauf stirbt Goodman, woraus für Riemen die Verpflichtung erwächst, seinerseits über den 'Adel des Geistes' zu schreiben, damit 'Joe' einen Ort habe, an dem er weiterexistiere.
Deutlich streift der Autor hier die Grenze zum Kitsch. Doch der Verdacht, es handle sich dabei um bewusste Ironisierung in Anlehnung an sein großes Vorbild Thomas Mann, erweist sich im Verlauf der Lektüre als unbegründet. Auch der Name Goodman, der dazu einlädt, mit 'Gutmensch' übersetzt zu werden, dürfte ohne jeden schelmischen Hintersinn sein.
In dem Buch ist viel von Freiheit, von der Pflicht zur Wahrheit, und von der Kraft des Geistes die Rede, ohne dass jedoch von diesem oder jenem wirklich Gebrauch gemacht wird. Aber es soll so scheinen. Und darin liegt das eigentlich Bedenkliche: die ewigen Verweise auf die groben Verbrechen der Vergangenheit verstellen den Blick für die subtileren Übel der Gegenwart. So zitiert er Spinoza:
"Lässt sich ein größeres Unglück für einen Staat denken, als dass achtbare Männer, bloß weil sie eine abweichende Meinung haben und nicht zu heucheln verstehen, wie Verbrecher des Landes verwiesen werden?"
So sei es früher gewesen. Doch ist dieses Unglück, zumal in Deutschland, nicht von ungeheurer Aktualität? Aber darüber verliert der Autor kein Wort. Wie anders wäre das Buch sonst in zwölf Sprachen übersetzt worden und hätten sich führende Vertreter des Kulturbetriebs bereits sehr positiv darüber geäußert?
Jene entschuldigen gern, wenn die Richtung stimmt, so manche Plattheit. Denn es fehlt dem Niederländer Riemen, der das Buch zunächst auf englisch erscheinen ließ, sowohl an historischer Empathie als auch an fundierten geistesgeschichtlichen Kenntnissen, besonders wenn es um deutsche Belange geht. So heißt es wiederholt über die Terroranschläge vom 11. September, sie seien von Männern verübt worden,
"mit einer Ideologie des mittelalterlichen theokratischen Ideals, das auch die deutschen Faschisten im Jahre 1919 für so erstrebenswert hielten. Das Weltbild der Taliban – jener Sekte, der sich die Terroristen verbunden fühlen – ist ein totalitäres, faschistoides Weltbild, diesmal in der Gestalt des Islam."
Überhaupt enthält der Text zu viele Klischees, Detailfehler und gröbste Vereinfachungen, die Riemen als Opfer eben jener geistigen Verflachung ausweisen, gegen die er anzuschreiben vorgibt. Etwa wenn er – der Thomas-Mann-Kenner – keinen Unterschied macht zwischen 'Kultur' und 'Zivilisation', obwohl gerade darin der Schlüssel zum Verständnis der deutschen Geistesgeschichte im frühen 20. Jahrhundert liegt. Das Zeitalter Nietzsches wird auf folgende knappe, geradezu naive Formel gebracht:
"Vierzehn Jahre nach seinem Tod brach der Erste Weltkrieg aus. Europa geriet in die Gewalt von Faschismus, Kommunismus und Nationalsozialismus. Es kam ein Zweiter Weltkrieg. Eine Orgie der Gewalt triumphierte über das Wahre, Gute und Schöne. Das Kulturideal wurde verachtet. Viele Millionen Menschen begrüßten, bewunderten und förderten diese Gewalt. Viele Millionen Leben wurden vernichtet. Nihilismus endet immer und unvermeidlich in Gewalt und Zerstörung."
Riemen beschwört ein Ideal, das er nur noch in verblasster Kopie zu kennen scheint. Und so bleibt er überall bloß an der Oberfläche, wo die Betrachtung Tiefe verlangte. Dabei stellt er durchaus interessante Fragen, etwa:
"Was ist die Zukunft der Demokratie, der politischen Freiheit, wenn die Menschen nicht mehr wissen, was das Wesen der Freiheit ist?"
Dass dieser Zustand bereits erreicht sein könnte, wagt er jedoch nicht auszusprechen. Stattdessen wird ein wenig behäbig die Rückkehr zu den 'ewigen Werten' gepredigt und vom american dream geschwärmt.
Erst auf den letzten Seiten, als Sokrates ins Spiel kommt, gewinnt das Buch an Kraft und ein paar wohlfeile 'Wahrheiten' geraten ins Wanken. So als habe der Autor schließlich doch Mut gefasst, seine Kritik auch einmal gegen die bestehende Wirklichkeit zu richten:
"Wo keine Freiheit herrscht, kann es keine Kultur geben, aber wo die Kultur vertrieben wurde, ist jede Freiheit bedeutungslos, und es bleiben nur Willkür und Banalität."
Das Buch ist in jeder Hinsicht ein Produkt der Ethik nivellierter Massendemokratien, auch dort, wo es diese verurteilt. Sein 'Adel' erschöpft sich in dem für geistige Menschen doch etwas schlichten Anspruch, ein bloß 'guter Mensch' sein zu wollen. Mit den viel differenzierteren Gedanken echter Humanisten – von Humboldt bis Hofmannsthal – hat das wenig zu tun. Das wäre an sich noch kein Makel, wenn der Titel nicht etwas anderes suggerierte.
So liest sich das Buch wie ein rührendes Bekenntnis zum Guten, Wahren und Schönen aus den Kellerräumen der Kultur. Die Sonne des Humanismus hat diese Räume nie beschienen. Stattdessen wurden sie ausgeleuchtet mit dem Kunstlicht der Gleichheit.
Rob Riemen: Adel des Geistes. Ein vergessenes Ideal
Siedler Verlag, München/2010
Goodman ist Jude, gebildet, sensibel, und zudem ein hochbegabter Komponist, dem 1938 die Flucht in die USA gelang, während seine Eltern ermordet wurden. Sein einziges Kind stirbt an einer Infektionskrankheit. Goodmans große Leidenschaft gilt dem amerikanischen Dichter Walt Whitman. Diesem hat er sein Lebenswerk gewidmet, eine symphonische Kantate mit dem Titel Nobilitiy of Spirit. Als Goodman auch noch die Schrecken des 11. Septembers erleben muss, ist für ihn die Sache sofort klar:
"Du meinst also..., dass wir einfach verstehen müssen, warum dreitausend unschuldige Menschen von ein paar religiösen Spinnern ermordet worden sind?! Als ob es so schwierig ist, zu begreifen, dass es wieder Faschisten sind, Menschen, die Böses wollen!"
Elisabeth Mann Borgese verhilft ihrem Freund daraufhin, dessen Kantate endlich zur Aufführung zu bringen, um ein Zeichen gegen das Böse zu setzen. Kurz darauf stirbt Goodman, woraus für Riemen die Verpflichtung erwächst, seinerseits über den 'Adel des Geistes' zu schreiben, damit 'Joe' einen Ort habe, an dem er weiterexistiere.
Deutlich streift der Autor hier die Grenze zum Kitsch. Doch der Verdacht, es handle sich dabei um bewusste Ironisierung in Anlehnung an sein großes Vorbild Thomas Mann, erweist sich im Verlauf der Lektüre als unbegründet. Auch der Name Goodman, der dazu einlädt, mit 'Gutmensch' übersetzt zu werden, dürfte ohne jeden schelmischen Hintersinn sein.
In dem Buch ist viel von Freiheit, von der Pflicht zur Wahrheit, und von der Kraft des Geistes die Rede, ohne dass jedoch von diesem oder jenem wirklich Gebrauch gemacht wird. Aber es soll so scheinen. Und darin liegt das eigentlich Bedenkliche: die ewigen Verweise auf die groben Verbrechen der Vergangenheit verstellen den Blick für die subtileren Übel der Gegenwart. So zitiert er Spinoza:
"Lässt sich ein größeres Unglück für einen Staat denken, als dass achtbare Männer, bloß weil sie eine abweichende Meinung haben und nicht zu heucheln verstehen, wie Verbrecher des Landes verwiesen werden?"
So sei es früher gewesen. Doch ist dieses Unglück, zumal in Deutschland, nicht von ungeheurer Aktualität? Aber darüber verliert der Autor kein Wort. Wie anders wäre das Buch sonst in zwölf Sprachen übersetzt worden und hätten sich führende Vertreter des Kulturbetriebs bereits sehr positiv darüber geäußert?
Jene entschuldigen gern, wenn die Richtung stimmt, so manche Plattheit. Denn es fehlt dem Niederländer Riemen, der das Buch zunächst auf englisch erscheinen ließ, sowohl an historischer Empathie als auch an fundierten geistesgeschichtlichen Kenntnissen, besonders wenn es um deutsche Belange geht. So heißt es wiederholt über die Terroranschläge vom 11. September, sie seien von Männern verübt worden,
"mit einer Ideologie des mittelalterlichen theokratischen Ideals, das auch die deutschen Faschisten im Jahre 1919 für so erstrebenswert hielten. Das Weltbild der Taliban – jener Sekte, der sich die Terroristen verbunden fühlen – ist ein totalitäres, faschistoides Weltbild, diesmal in der Gestalt des Islam."
Überhaupt enthält der Text zu viele Klischees, Detailfehler und gröbste Vereinfachungen, die Riemen als Opfer eben jener geistigen Verflachung ausweisen, gegen die er anzuschreiben vorgibt. Etwa wenn er – der Thomas-Mann-Kenner – keinen Unterschied macht zwischen 'Kultur' und 'Zivilisation', obwohl gerade darin der Schlüssel zum Verständnis der deutschen Geistesgeschichte im frühen 20. Jahrhundert liegt. Das Zeitalter Nietzsches wird auf folgende knappe, geradezu naive Formel gebracht:
"Vierzehn Jahre nach seinem Tod brach der Erste Weltkrieg aus. Europa geriet in die Gewalt von Faschismus, Kommunismus und Nationalsozialismus. Es kam ein Zweiter Weltkrieg. Eine Orgie der Gewalt triumphierte über das Wahre, Gute und Schöne. Das Kulturideal wurde verachtet. Viele Millionen Menschen begrüßten, bewunderten und förderten diese Gewalt. Viele Millionen Leben wurden vernichtet. Nihilismus endet immer und unvermeidlich in Gewalt und Zerstörung."
Riemen beschwört ein Ideal, das er nur noch in verblasster Kopie zu kennen scheint. Und so bleibt er überall bloß an der Oberfläche, wo die Betrachtung Tiefe verlangte. Dabei stellt er durchaus interessante Fragen, etwa:
"Was ist die Zukunft der Demokratie, der politischen Freiheit, wenn die Menschen nicht mehr wissen, was das Wesen der Freiheit ist?"
Dass dieser Zustand bereits erreicht sein könnte, wagt er jedoch nicht auszusprechen. Stattdessen wird ein wenig behäbig die Rückkehr zu den 'ewigen Werten' gepredigt und vom american dream geschwärmt.
Erst auf den letzten Seiten, als Sokrates ins Spiel kommt, gewinnt das Buch an Kraft und ein paar wohlfeile 'Wahrheiten' geraten ins Wanken. So als habe der Autor schließlich doch Mut gefasst, seine Kritik auch einmal gegen die bestehende Wirklichkeit zu richten:
"Wo keine Freiheit herrscht, kann es keine Kultur geben, aber wo die Kultur vertrieben wurde, ist jede Freiheit bedeutungslos, und es bleiben nur Willkür und Banalität."
Das Buch ist in jeder Hinsicht ein Produkt der Ethik nivellierter Massendemokratien, auch dort, wo es diese verurteilt. Sein 'Adel' erschöpft sich in dem für geistige Menschen doch etwas schlichten Anspruch, ein bloß 'guter Mensch' sein zu wollen. Mit den viel differenzierteren Gedanken echter Humanisten – von Humboldt bis Hofmannsthal – hat das wenig zu tun. Das wäre an sich noch kein Makel, wenn der Titel nicht etwas anderes suggerierte.
So liest sich das Buch wie ein rührendes Bekenntnis zum Guten, Wahren und Schönen aus den Kellerräumen der Kultur. Die Sonne des Humanismus hat diese Räume nie beschienen. Stattdessen wurden sie ausgeleuchtet mit dem Kunstlicht der Gleichheit.
Rob Riemen: Adel des Geistes. Ein vergessenes Ideal
Siedler Verlag, München/2010
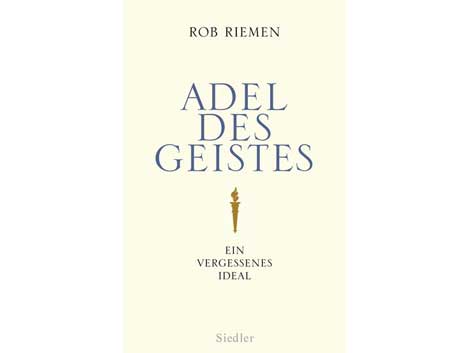
Buchcover: "Adel des Geistes" von Rob Riemen© Siedler Verlag
