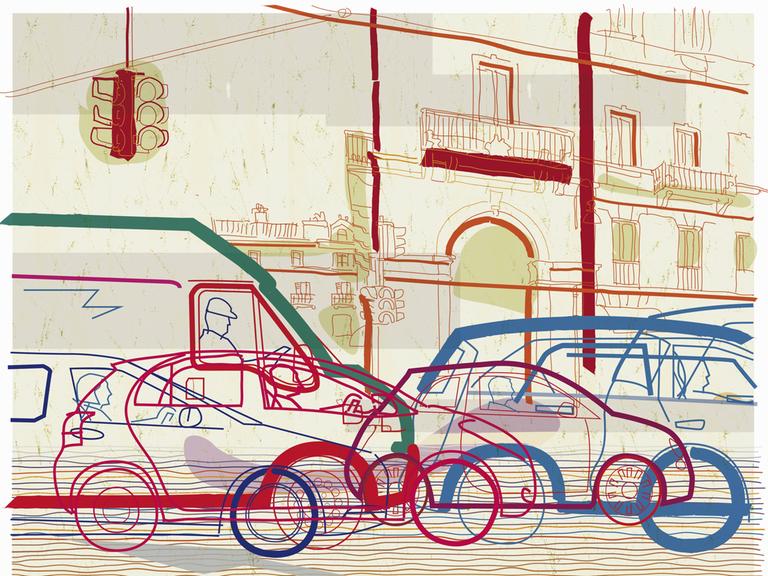Kommentar

Streiten ist wichtig, auch und gerade in der Politik, meint Pauline Pieper. © Getty Images / iStockphoto / Nuthawut Somsuk
Wir brauchen mehr Streit in der Politik
04:27 Minuten

Heizungsgesetz, Klimaschutz und jetzt auch noch die Kontroverse ums Ehegatten-Splitting: Der Dauerstreit in der Ampel-Koalition steht hart in der Kritik. Pauline Pieper hält das für falsch, denn gute Politik lebe von inhaltlichen Konflikten.
Neuer Tag, neuer Streit. Die Ampel hat die Chronik ihrer Uneinigkeiten um ein weiteres Kapitel ergänzt: das Ehegattensplitting. In den Medien war allgemeines Aufstöhnen zu vernehmen: Nicht schon wieder ein Konflikt in der Ampel! Erst das monatelange Ringen um das Heizungsgesetz, dann die Diskussionen um die Kindergrundsicherung, das Elterngeld und jetzt auch noch eine Steuerdebatte. Die Regierung ist knapp zwei Jahre im Amt, in der Zwischenbilanz scheint man sich einig zu sein: Die Ampel streitet zu viel.
In diesem Urteil kommt eine bestimmte Idee des Politischen zum Ausdruck. Im politischen Prozess sollte stets darauf abgezielt werden, einen Konsens zu bilden. Werden unterschiedliche Positionen vertreten, müsse man in einen besonnenen, rationalen Dialog treten. An dessen Ende – so die Vorstellung – stehe dann ein Ergebnis, das allen zugutekomme.
In diesem Urteil kommt eine bestimmte Idee des Politischen zum Ausdruck. Im politischen Prozess sollte stets darauf abgezielt werden, einen Konsens zu bilden. Werden unterschiedliche Positionen vertreten, müsse man in einen besonnenen, rationalen Dialog treten. An dessen Ende – so die Vorstellung – stehe dann ein Ergebnis, das allen zugutekomme.
Eine unhintergehbare Dimension des Politischen
Diese Sichtweise ist der Politikwissenschaftlerin Chantal Mouffe zufolge aber grundfalsch. Einen rationalen Konsens könne es nämlich gar nicht geben. Denn politische Fragen erlauben in der Regel keine gute Lösung für alle. Handfeste unterschiedliche Interessen und Machtverhältnisse sorgen im gesellschaftlichen Zusammenleben für anhaltende Konflikte. Für Mouffe ist diese Konflikthaftigkeit eine unhintergehbare Dimension des Politischen. Dabei ist die Frage meist nicht, wer den anderen überzeugt, sondern wer sich am Ende durchsetzt.
Aufgabe der Parteien ist es demzufolge nicht, ihre widerstreitenden Positionen miteinander zu versöhnen. Vielmehr muss es darum gehen, die eigene Agenda möglichst deutlich zum Vorschein zu bringen. Die einzige Partei der Ampel, die das verstanden zu haben scheint, ist die FDP: der kleinste Koalitionspartner, der die Interessen der Reichen vertritt und sich immer wieder durchsetzt. Daneben verblasst das Profil der Grünen und der SPD.
Aufgabe der Parteien ist es demzufolge nicht, ihre widerstreitenden Positionen miteinander zu versöhnen. Vielmehr muss es darum gehen, die eigene Agenda möglichst deutlich zum Vorschein zu bringen. Die einzige Partei der Ampel, die das verstanden zu haben scheint, ist die FDP: der kleinste Koalitionspartner, der die Interessen der Reichen vertritt und sich immer wieder durchsetzt. Daneben verblasst das Profil der Grünen und der SPD.
Kanzler Scholz redet von Respekt vor der hart arbeitenden Bevölkerung. Aber wo sind die klaren Forderungen der SPD, die in deren Interesse wären? Anstatt etwa die viel zu geringe Mindestlohnerhöhung eindeutig zu kritisieren, hat Scholz vor allem problematisiert, dass die zuständige Kommission sich nicht einstimmig geeinigt habe. Da wird die mangelnde Harmonie im Einigungsprozess zum größeren Problem als der Inhalt der Einigung selbst.
Auch die Grünen sind immerzu bemüht, die Differenzen in der Koalition bloß nicht zu dramatisch erscheinen zu lassen. Man gerät offensichtlich permanent mit der FDP aneinander, doch Habeck betont, das persönliche Verhältnis zu Lindner sei "supi". Aus Angst, sich regelrecht zu zerstreiten, steckt man lieber zurück, ob beim Klimaschutz oder der Kindergrundsicherung.
Rechte profitieren von zu viel Konsens
Diese Überhöhung der Harmonie verfehlt aber – mit Mouffe betrachtet – nicht nur den konfliktgeprägten Charakter des Politischen. Sie ist auch gefährlich. Denn wenn die unterschiedlichen Interessen in der demokratischen Arena keinen angemessenen Ausdruck finden, brechen sie sich auf anderem Weg Bahn. So vertritt Mouffe die These, dass rechtsnationalistische Strömungen von einer allzu konsensorientierten Politik profitieren. Wenn die Parteien im demokratischen Spektrum den widerstreitenden Interessen keinen Raum bieten, drohe die Identifikation mit rechten Positionen.
Immer wieder wird behauptet, die jüngsten Erfolge der AfD ließen sich auf den Streit in der Ampel zurückführen. Aber die richtige Antwort auf den Rechtsruck ist womöglich nicht weniger, sondern mehr Streit. Denn Reibungen sind nicht per se schlecht. Wer streitet, bezieht Position und kann echte Alternativen aufzeigen. Ein ordentlicher Krach kann die Demokratie mehr beleben als erzwungene Harmonie. In diesem Sinne: neuer Tag, neuer Streit!