Abschied von einer Lebenslüge
Aus der blutigen Ära der Roten Armee Fraktion sticht der Mord an Jürgen Ponto noch immer heraus. Es war schließlich Pontos eigene Patentochter Susanne Albrecht, die seinen Mördern den Eintritt ins Haus verschaffte.
Damit war der Mord auch ein Verrat. Dieser Verrat betraf zwei Familien, die seit der gemeinsamen Studienzeit von Hans-Christian Albrecht und Jürgen Ponto eng befreundet waren, und die nach der Tat nur einmal noch zusammenkamen und dann nie wieder.
Corinna Ponto war nach dem Abitur für einige Wochen nach London gegangen. Dort erfährt sie vom Tod ihres Vaters.
"Das war so ein unwirklicher Film im Durchgangsflur, an dem Telefon mit dem kurzen Kabel, dass ich mich noch im selben Moment von der Wirklichkeit abkoppelte. Es blieb für mich ein ,Unfall’. Es zählte nur der Tod – das war die Katastrophe. Nicht die Umstände."
Die Mittäterschaft von Susanne Albrecht blendet sie aus. Kurze Zeit darauf verlässt sie mit ihrer Mutter Deutschland und zieht für viele Jahre in die USA.
Auch für die 13jährige Julia Albrecht, die jüngere Schwester von Susanne, bricht durch die Gewalttat die Welt zusammen:
"Mein Schmerz war völlig unartikuliert und wild. Ich trauerte um den Verlust der Schwester, ich hatte panische Angst vor einem weiteren Gewaltverbrechen, dessen Opfer ich sein könnte, ich fühlte mich bloßgestellt meinen Freundinnen und Freunden gegenüber und wie nichtexistent, weil ich von diesem Tag an für viele Jahre in den Augen der anderen die Schwester von Susanne war – und nichts anderes."
Nach über 30 Jahren nimmt die Schwester der Terroristin Kontakt zur Tochter des Opfers auf. Julia Albrecht und Corinna Ponto beschreiben ihr Zögern, und finden dann doch genug Vertrauen zueinander, um sich noch einmal jener Tat und den Folgen zu stellen. Sie können das, weil es beiden nicht um Susanne Albrecht geht. Beide haben mit der Terroristin, die inzwischen in Bremen Ausländern Deutschunterricht erteilt, offenbar abgeschlossen.
Corinna Ponto nimmt den Namen im Buch nicht in den Mund, spricht nur von "S." Für Julia Albrecht ist das Buch auch ein Abschied von ihrer Schwester, der sie mit 26 Jahren in einem Ost-Berliner Gefängnis zum ersten Mal wieder gegenübersaß. Erst kurz zuvor war herausgekommen, dass die DDR RAF-Terroristen Unterschlupf geboten hatte.
"Susanne sprach sächsisch. Original sächsisch. Da war nichts Hamburgisches in ihrer Stimme. Die durch die Kehle gezogenen Worte klangen ganz anders als meine – und schafften eine künstliche und gleichzeitig passende Distanz. Sie erzählte, dass ihre Legende in der DDR nur eine Schwester vorgesehen habe. Ich verstand, dass ich dabei irgendwie durch den Rost gefallen war. Und dass das Gedächtnis ihr dementsprechend einen Streich gespielt und sie mich gleich ganz und gar gestrichen hatte."
In diesem Moment wird Julia Albrecht verstanden haben, dass ein Dialog mit ihrer Schwester sinnlos ist. Der Verrat setzt sich fort. Sie wendet sich stattdessen an die Patentochter ihres Vaters, um über die Katastrophe zu sprechen, die diese Tat auch für ihre Familie bedeutet hat. Julia Albrecht leugnet dabei nicht, dass sich die Familie die Mittäterschaft ihrer Tochter und Schwester bis zuletzt nicht eingestehen wollte:
"Weitgehend Konsens, wenn auch nicht deutlich ausgesprochen, war in unserer Familie, dass Susanne sich an der Ermordung von Jürgen Ponto nicht aus freien Stücken und nicht als ,echtes’ Mitglied der RAF beteiligt hatte. Wir hielten zäh daran fest, dass nicht sein konnte, was nicht sein durfte. Wir hielten fest an dem, was wir uns selbst zuzumuten bereit waren. Die Fakten lagen auf dem Tisch. Nur wollten wir sie nicht wahrhaben."
Julia Albrecht verabschiedet sich in dem Buch von dieser Lebenslüge. Sie hat verstanden, dass ihre geliebte Schwester eine Terroristin war, die auch das Morden gewollt hat und nicht von anderen dazu verführt worden war. Dass das so lange gedauert hat, dass sich die Eltern trotz der Unterschrift ihrer Tochter unter das Bekennerschreiben der RAF überhaupt an diese Illusion geklammert haben, ist Ausdruck rührender Elternliebe, die den Verrat nicht ertragen konnte.
Zugleich ist es schrecklich naiv, dass sie die Besuche ihrer Tochter bei den Pontos, die dem Anschlag vorausgingen, sogar als Wiederannäherung an eine bürgerliche Existenz deuteten. Julia Albrecht zitiert aus einem nie abgeschickten Brief ihres Vaters an die Witwe von Jürgen Ponto:
"Wir waren froh, als sie Lust zeigte, Euch zu besuchen. Dass das alles vorgetäuscht gewesen sein soll, können wir auch heute nicht glauben. Sollte sie uns so getäuscht haben?"
Das hat sie. Und hätten die Albrechts sich nicht täuschen lassen, wäre es vermutlich nicht zu dem Attentat gekommen. Die Eltern wussten, dass Karl-Heinz Dellwo, der an dem Anschlag auf die deutsche Botschaft in Stockholm beteiligt war, mit Susanne zusammengewohnt hatte. Sie haben es für sich behalten. Den Vorwurf, dass die Albrechts die Pontos nicht ausreichend über das offensichtliche Abgleiten ihrer Tochter in den militanten Untergrund gewarnt hätten - Julia Albrecht kann ihn nicht entkräften. Sie ist so ehrlich, es auch nicht zu versuchen.
Doch Corinna Ponto interessiert sich nicht dafür, familiäre Schuld abzurechnen. Und vermutlich konnte dieser bewegende Briefdialog nur deshalb glücken, weil die Frauen in Wahrheit aneinander vorbeireden. Julia Albrecht geht es um Versöhnung, zu der auch das Bekenntnis zur Schuld gehört. Ihr Projekt ist mit dem Buch in gewisser Weise abgeschlossen. Corinna Ponto geht es um historische Aufklärung, die aus ihrer Sicht noch lange nicht abgeschlossen ist. Ähnlich wie Michael Buback, der Sohn des von der RAF ermordeten Generalbundesanwalts, will Corinna Ponto endlich die Wahrheit über die Rote Armee Fraktion und ihre politische Vernetzung erfahren. Sie will…
"…dass die komplette Geschichte erzählt wird. Die Verbindung zwischen RAF und Stasi und anderen östlichen Geheimdiensten. Und ich will nicht, dass man mich deshalb in die Ecke der Verschwörungstheoretiker stellt. Die RAF war ein nationaler Vorläufer des heutigen internationalen Terrorismus. Das wird sich in einer größeren Zeitskala von ganz allein einordnen."
In einem jedoch bleiben die beiden Frauen sich völlig einig: der Täterin und dem terroristischen Milieu der RAF nicht noch mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Es ist ihnen eindrucksvoll gelungen, die Verheerung darzustellen, die Mord und Verrat in zwei Familien angerichtet haben.
Julia Albrecht, Corinna Ponto: Patentöchter. Im Schatten der RAF – ein Dialog
Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln 2011
Corinna Ponto war nach dem Abitur für einige Wochen nach London gegangen. Dort erfährt sie vom Tod ihres Vaters.
"Das war so ein unwirklicher Film im Durchgangsflur, an dem Telefon mit dem kurzen Kabel, dass ich mich noch im selben Moment von der Wirklichkeit abkoppelte. Es blieb für mich ein ,Unfall’. Es zählte nur der Tod – das war die Katastrophe. Nicht die Umstände."
Die Mittäterschaft von Susanne Albrecht blendet sie aus. Kurze Zeit darauf verlässt sie mit ihrer Mutter Deutschland und zieht für viele Jahre in die USA.
Auch für die 13jährige Julia Albrecht, die jüngere Schwester von Susanne, bricht durch die Gewalttat die Welt zusammen:
"Mein Schmerz war völlig unartikuliert und wild. Ich trauerte um den Verlust der Schwester, ich hatte panische Angst vor einem weiteren Gewaltverbrechen, dessen Opfer ich sein könnte, ich fühlte mich bloßgestellt meinen Freundinnen und Freunden gegenüber und wie nichtexistent, weil ich von diesem Tag an für viele Jahre in den Augen der anderen die Schwester von Susanne war – und nichts anderes."
Nach über 30 Jahren nimmt die Schwester der Terroristin Kontakt zur Tochter des Opfers auf. Julia Albrecht und Corinna Ponto beschreiben ihr Zögern, und finden dann doch genug Vertrauen zueinander, um sich noch einmal jener Tat und den Folgen zu stellen. Sie können das, weil es beiden nicht um Susanne Albrecht geht. Beide haben mit der Terroristin, die inzwischen in Bremen Ausländern Deutschunterricht erteilt, offenbar abgeschlossen.
Corinna Ponto nimmt den Namen im Buch nicht in den Mund, spricht nur von "S." Für Julia Albrecht ist das Buch auch ein Abschied von ihrer Schwester, der sie mit 26 Jahren in einem Ost-Berliner Gefängnis zum ersten Mal wieder gegenübersaß. Erst kurz zuvor war herausgekommen, dass die DDR RAF-Terroristen Unterschlupf geboten hatte.
"Susanne sprach sächsisch. Original sächsisch. Da war nichts Hamburgisches in ihrer Stimme. Die durch die Kehle gezogenen Worte klangen ganz anders als meine – und schafften eine künstliche und gleichzeitig passende Distanz. Sie erzählte, dass ihre Legende in der DDR nur eine Schwester vorgesehen habe. Ich verstand, dass ich dabei irgendwie durch den Rost gefallen war. Und dass das Gedächtnis ihr dementsprechend einen Streich gespielt und sie mich gleich ganz und gar gestrichen hatte."
In diesem Moment wird Julia Albrecht verstanden haben, dass ein Dialog mit ihrer Schwester sinnlos ist. Der Verrat setzt sich fort. Sie wendet sich stattdessen an die Patentochter ihres Vaters, um über die Katastrophe zu sprechen, die diese Tat auch für ihre Familie bedeutet hat. Julia Albrecht leugnet dabei nicht, dass sich die Familie die Mittäterschaft ihrer Tochter und Schwester bis zuletzt nicht eingestehen wollte:
"Weitgehend Konsens, wenn auch nicht deutlich ausgesprochen, war in unserer Familie, dass Susanne sich an der Ermordung von Jürgen Ponto nicht aus freien Stücken und nicht als ,echtes’ Mitglied der RAF beteiligt hatte. Wir hielten zäh daran fest, dass nicht sein konnte, was nicht sein durfte. Wir hielten fest an dem, was wir uns selbst zuzumuten bereit waren. Die Fakten lagen auf dem Tisch. Nur wollten wir sie nicht wahrhaben."
Julia Albrecht verabschiedet sich in dem Buch von dieser Lebenslüge. Sie hat verstanden, dass ihre geliebte Schwester eine Terroristin war, die auch das Morden gewollt hat und nicht von anderen dazu verführt worden war. Dass das so lange gedauert hat, dass sich die Eltern trotz der Unterschrift ihrer Tochter unter das Bekennerschreiben der RAF überhaupt an diese Illusion geklammert haben, ist Ausdruck rührender Elternliebe, die den Verrat nicht ertragen konnte.
Zugleich ist es schrecklich naiv, dass sie die Besuche ihrer Tochter bei den Pontos, die dem Anschlag vorausgingen, sogar als Wiederannäherung an eine bürgerliche Existenz deuteten. Julia Albrecht zitiert aus einem nie abgeschickten Brief ihres Vaters an die Witwe von Jürgen Ponto:
"Wir waren froh, als sie Lust zeigte, Euch zu besuchen. Dass das alles vorgetäuscht gewesen sein soll, können wir auch heute nicht glauben. Sollte sie uns so getäuscht haben?"
Das hat sie. Und hätten die Albrechts sich nicht täuschen lassen, wäre es vermutlich nicht zu dem Attentat gekommen. Die Eltern wussten, dass Karl-Heinz Dellwo, der an dem Anschlag auf die deutsche Botschaft in Stockholm beteiligt war, mit Susanne zusammengewohnt hatte. Sie haben es für sich behalten. Den Vorwurf, dass die Albrechts die Pontos nicht ausreichend über das offensichtliche Abgleiten ihrer Tochter in den militanten Untergrund gewarnt hätten - Julia Albrecht kann ihn nicht entkräften. Sie ist so ehrlich, es auch nicht zu versuchen.
Doch Corinna Ponto interessiert sich nicht dafür, familiäre Schuld abzurechnen. Und vermutlich konnte dieser bewegende Briefdialog nur deshalb glücken, weil die Frauen in Wahrheit aneinander vorbeireden. Julia Albrecht geht es um Versöhnung, zu der auch das Bekenntnis zur Schuld gehört. Ihr Projekt ist mit dem Buch in gewisser Weise abgeschlossen. Corinna Ponto geht es um historische Aufklärung, die aus ihrer Sicht noch lange nicht abgeschlossen ist. Ähnlich wie Michael Buback, der Sohn des von der RAF ermordeten Generalbundesanwalts, will Corinna Ponto endlich die Wahrheit über die Rote Armee Fraktion und ihre politische Vernetzung erfahren. Sie will…
"…dass die komplette Geschichte erzählt wird. Die Verbindung zwischen RAF und Stasi und anderen östlichen Geheimdiensten. Und ich will nicht, dass man mich deshalb in die Ecke der Verschwörungstheoretiker stellt. Die RAF war ein nationaler Vorläufer des heutigen internationalen Terrorismus. Das wird sich in einer größeren Zeitskala von ganz allein einordnen."
In einem jedoch bleiben die beiden Frauen sich völlig einig: der Täterin und dem terroristischen Milieu der RAF nicht noch mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Es ist ihnen eindrucksvoll gelungen, die Verheerung darzustellen, die Mord und Verrat in zwei Familien angerichtet haben.
Julia Albrecht, Corinna Ponto: Patentöchter. Im Schatten der RAF – ein Dialog
Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln 2011
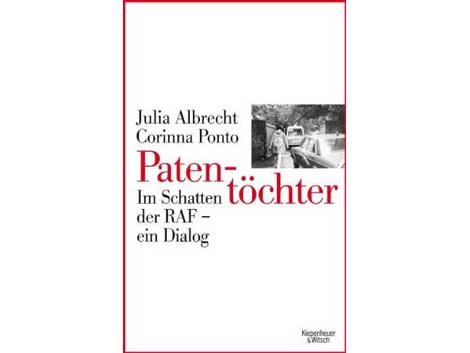
Cover Albrecht / Ponto "Patentöchter"© Kiepenheuer & Witsch
