Abschied von der Demokratie
Die Demokratie ist für den englischen Sozialwissenschaftler Colin Crouch nicht auf dem Vormarsch, sondern einem Prozess der Aushöhlung unterworfen und insofern auf dem Rückzug. Denn auch dort, wo demokratisch regiert wird – so seine These - ist die Masse der Bürger daran nur sehr marginal, nämlich bei Wahlen, beteiligt. Die scheinbar intakten Demokratien sind für ihn Postdemokratien.
"Der Begriff bezeichnet ein Gemeinwesen, in dem zwar nach wie vor Wahlen abgehalten werden, die sogar dazu führen, dass Regierungen ihren Abschied nehmen müssen, in dem allerdings konkurrierende Teams professioneller PR-Experten die öffentliche Debatte während der Wahlkämpfe so stark kontrollieren, dass sie zu einem reinem Spektakel verkommt … Die Mehrheit der Bürger spielt dabei ein passive, schweigende, ja sogar apathische Rolle … Im Schatten dieser politischen Inszenierung wird die reale Politik hinter verschlossenen Türen gemacht: von gewählten Regierungen und Eliten, die vor allem die Interessen der Wirtschaft vertreten."
Diese These belegt der Autor, der sich zur britischen Labour Party zählt, historisch und systematisch mit überzeugenden Belegen und Argumenten. In der Zeit zwischen den Weltkriegen, vor allem aber nach dem Zweiten Weltkrieg kam es in allen Industriestaaten zu einem Interessenausgleich zwischen Kapital und Arbeit und zur Bildung unterschiedlicher Typen von Wohlfahrtsstaaten. Diese beruhten auf der Mobilisierung der Massenkaufkraft und einer keynesianischen Wirtschafts- und Sozialpolitik, verbanden also industrielle Modernisierung und die Verringerung sozialer Ungleichheit. Ende der 80er Jahre zerbrach dieses Modell. Die Inflation verringerte die Nachfrage und bewirkte - zusammen mit der Automatisierung von Produktionsabläufen - eine massenhafte Arbeitslosigkeit. Der Einfluss von Gewerkschaften sank, jener der Unternehmen, Lobbyisten und Wirtschaftsverbände stieg und der Wohlfahrtsstaat wurde abgebaut. Das Ergebnis dieser Prozesse beschreibt Crouch so:
"Je mehr sich der Staat aus der Fürsorge für das Leben der normalen Menschen zurückzieht und zulässt, dass diese in politische Apathie versinken, desto leichter können Wirtschaftsverbände ihn – mehr oder minder unbemerkt – zu einem Selbstbedienungsladen machen."
Letzteres ist wörtlich zu verstehen und Crouch illustriert das an einem Beispiel aus England. Die europäischen Staaten begaben sich im Zeichen neoliberaler Deregulierung in einen unerbittlichen Wettbewerb um möglichst geringe Steuern und andere Standortvorteile. So holte Tony Blair im Jahr 2000 Fabriken von Ford und BMW ins Land. Wenige Jahre später wurden diese wieder dicht gemacht, weil das Schließen deutscher Produktionsstandorte teurer geworden wäre. Das Nachsehen hatten - neben der Belegschaft - die britischen Steuerzahler.
Das gilt auch für viele Privatisierungen von öffentlichen Leistungen. Den Regierungen erschienen Privatisierungen als Wundermittel zur Sanierung ihrer Haushalte. Vor allem aber wurde den Regierenden wie den Bürgern von den Interessenten das Axiom buchstäblich in die Köpfe gehämmert, der Markt sei der politischen Regulierung prinzipiell überlegen und die Regierung sei nur
"eine Mischung aus Inkompetenz, parasitärer Strippenzieherei und Wahlpropaganda"."
Je weniger sich die Regierungen zutrauten und je mehr sie sich zurückzogen und wichtige Bereiche der Versorgung den vermeintlich vollkommen funktionierenden Märkten überließen, desto mehr wuchs der Einfluss der Interessenten.
" "Die Macht, die sie in den Firmen ohnehin bereits ausüben, wird in politische Macht übersetzt, mit der sie Zugriff auf weitere soziale Bereiche bekommen."
Ein Beispiel dafür sind die Arbeits- und Lohnverhältnisse im Dienstleistungssektor, wo - insbesondere für Ungelernte und Frauen - ein gnadenloses Lohndumping stattfindet, das die Ungleichheiten ständig vergrößert. Crouch ist kein Utopist, denn er räumt ein:
"Die Spannung zwischen egalitären Forderungen der Demokratie und den Ungleichheiten, die aus dem Kapitalismus resultieren, kann nie vollkommen beseitigt werden, allerdings sind mehr oder weniger konstruktive Kompromisse möglich."
Diese gehen momentan jedoch fast immer auf Kosten der Schwächeren und das mündet Crouch zufolge in eine "Entropie", also eine Umkehrung "der Demokratie", deren auf Gleichheit gebaute Legitimationsbasis zerbröselt wird. Dieselbe Wirkung hat auch das symbiotische Zusammenspiel von privaten Anbietern und Regierungen, wodurch private Unternehmen einen privilegierten Zugang zur Politik erhalten wie in vordemokratischen Zeiten die Hoflieferanten zum Monarchen.
Über die Chancen einer Revitalisierung der Demokratie in Zeiten ihrer Aushöhlung macht sich Crouch keine Illusionen. Die Banalisierung und Infantilisierung der politischen Kommunikation im privaten Fernsehen etwa, lässt daran zweifeln, ob der mündige und informierte Bürger - ohne den keine Demokratie auskommt - noch eine realistische Annahme ist. Andererseits haben die jüngsten Krisen auf den Aktienmärkten gezeigt, dass der Glaube an das überlegene Wissen erfolgreicher Unternehmen eine Ideologie ist, die für viele brüchig geworden ist. Um der anti-egalitären und antidemokratischen Macht der Wirtschaft entgegenzutreten, plädiert Crouch dafür, die Handlungsmöglichkeiten der Bürger zu erweitern. Dazu können die Mittel der direkten Demokratie - zum Beispiel das Referendum gegen Parlamentsbeschlüsse und Gesetzesinitiativen - ebenso dienen wie soziale Bewegungen, Protestbewegungen und Bürgerinitiativen. Unverzichtbar sind dabei aber auch starke Parteien, die nicht nur Mitgliederbeiträge einziehen, sondern die Mitglieder in den politischen Diskurs einbinden. Als abschreckendes Beispiel zitiert Crouch die Labour Party, die auf Spendengelder von Unternehmen setzt, seit sie die finanzielle Unterstützung durch die Gewerkschaften faktisch verloren hat.
Die Analyse von Crouch endet weder apokalyptisch noch hoffnungsvoll. Er zeigt die realen Machtverhältnisse in der wirtschaftlich dominierten Postdemokratie, doch er hält die Lage für ambivalent. Der Sieg der "betriebswirtschaftlichen Logik" über demokratisch-egalitäre Ansprüche ist keine Notwendigkeit und keine beschlossene Sache.
Colin Crouch: Postdemokratie
Aus dem Englischen von Nikolaus Gramm
Edition Suhrkamp, Frankfurt am Main 2008
Diese These belegt der Autor, der sich zur britischen Labour Party zählt, historisch und systematisch mit überzeugenden Belegen und Argumenten. In der Zeit zwischen den Weltkriegen, vor allem aber nach dem Zweiten Weltkrieg kam es in allen Industriestaaten zu einem Interessenausgleich zwischen Kapital und Arbeit und zur Bildung unterschiedlicher Typen von Wohlfahrtsstaaten. Diese beruhten auf der Mobilisierung der Massenkaufkraft und einer keynesianischen Wirtschafts- und Sozialpolitik, verbanden also industrielle Modernisierung und die Verringerung sozialer Ungleichheit. Ende der 80er Jahre zerbrach dieses Modell. Die Inflation verringerte die Nachfrage und bewirkte - zusammen mit der Automatisierung von Produktionsabläufen - eine massenhafte Arbeitslosigkeit. Der Einfluss von Gewerkschaften sank, jener der Unternehmen, Lobbyisten und Wirtschaftsverbände stieg und der Wohlfahrtsstaat wurde abgebaut. Das Ergebnis dieser Prozesse beschreibt Crouch so:
"Je mehr sich der Staat aus der Fürsorge für das Leben der normalen Menschen zurückzieht und zulässt, dass diese in politische Apathie versinken, desto leichter können Wirtschaftsverbände ihn – mehr oder minder unbemerkt – zu einem Selbstbedienungsladen machen."
Letzteres ist wörtlich zu verstehen und Crouch illustriert das an einem Beispiel aus England. Die europäischen Staaten begaben sich im Zeichen neoliberaler Deregulierung in einen unerbittlichen Wettbewerb um möglichst geringe Steuern und andere Standortvorteile. So holte Tony Blair im Jahr 2000 Fabriken von Ford und BMW ins Land. Wenige Jahre später wurden diese wieder dicht gemacht, weil das Schließen deutscher Produktionsstandorte teurer geworden wäre. Das Nachsehen hatten - neben der Belegschaft - die britischen Steuerzahler.
Das gilt auch für viele Privatisierungen von öffentlichen Leistungen. Den Regierungen erschienen Privatisierungen als Wundermittel zur Sanierung ihrer Haushalte. Vor allem aber wurde den Regierenden wie den Bürgern von den Interessenten das Axiom buchstäblich in die Köpfe gehämmert, der Markt sei der politischen Regulierung prinzipiell überlegen und die Regierung sei nur
"eine Mischung aus Inkompetenz, parasitärer Strippenzieherei und Wahlpropaganda"."
Je weniger sich die Regierungen zutrauten und je mehr sie sich zurückzogen und wichtige Bereiche der Versorgung den vermeintlich vollkommen funktionierenden Märkten überließen, desto mehr wuchs der Einfluss der Interessenten.
" "Die Macht, die sie in den Firmen ohnehin bereits ausüben, wird in politische Macht übersetzt, mit der sie Zugriff auf weitere soziale Bereiche bekommen."
Ein Beispiel dafür sind die Arbeits- und Lohnverhältnisse im Dienstleistungssektor, wo - insbesondere für Ungelernte und Frauen - ein gnadenloses Lohndumping stattfindet, das die Ungleichheiten ständig vergrößert. Crouch ist kein Utopist, denn er räumt ein:
"Die Spannung zwischen egalitären Forderungen der Demokratie und den Ungleichheiten, die aus dem Kapitalismus resultieren, kann nie vollkommen beseitigt werden, allerdings sind mehr oder weniger konstruktive Kompromisse möglich."
Diese gehen momentan jedoch fast immer auf Kosten der Schwächeren und das mündet Crouch zufolge in eine "Entropie", also eine Umkehrung "der Demokratie", deren auf Gleichheit gebaute Legitimationsbasis zerbröselt wird. Dieselbe Wirkung hat auch das symbiotische Zusammenspiel von privaten Anbietern und Regierungen, wodurch private Unternehmen einen privilegierten Zugang zur Politik erhalten wie in vordemokratischen Zeiten die Hoflieferanten zum Monarchen.
Über die Chancen einer Revitalisierung der Demokratie in Zeiten ihrer Aushöhlung macht sich Crouch keine Illusionen. Die Banalisierung und Infantilisierung der politischen Kommunikation im privaten Fernsehen etwa, lässt daran zweifeln, ob der mündige und informierte Bürger - ohne den keine Demokratie auskommt - noch eine realistische Annahme ist. Andererseits haben die jüngsten Krisen auf den Aktienmärkten gezeigt, dass der Glaube an das überlegene Wissen erfolgreicher Unternehmen eine Ideologie ist, die für viele brüchig geworden ist. Um der anti-egalitären und antidemokratischen Macht der Wirtschaft entgegenzutreten, plädiert Crouch dafür, die Handlungsmöglichkeiten der Bürger zu erweitern. Dazu können die Mittel der direkten Demokratie - zum Beispiel das Referendum gegen Parlamentsbeschlüsse und Gesetzesinitiativen - ebenso dienen wie soziale Bewegungen, Protestbewegungen und Bürgerinitiativen. Unverzichtbar sind dabei aber auch starke Parteien, die nicht nur Mitgliederbeiträge einziehen, sondern die Mitglieder in den politischen Diskurs einbinden. Als abschreckendes Beispiel zitiert Crouch die Labour Party, die auf Spendengelder von Unternehmen setzt, seit sie die finanzielle Unterstützung durch die Gewerkschaften faktisch verloren hat.
Die Analyse von Crouch endet weder apokalyptisch noch hoffnungsvoll. Er zeigt die realen Machtverhältnisse in der wirtschaftlich dominierten Postdemokratie, doch er hält die Lage für ambivalent. Der Sieg der "betriebswirtschaftlichen Logik" über demokratisch-egalitäre Ansprüche ist keine Notwendigkeit und keine beschlossene Sache.
Colin Crouch: Postdemokratie
Aus dem Englischen von Nikolaus Gramm
Edition Suhrkamp, Frankfurt am Main 2008
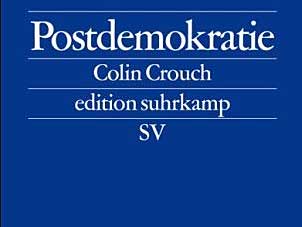
Colin Crouch: Postdemokratie© Edition Suhrkamp
