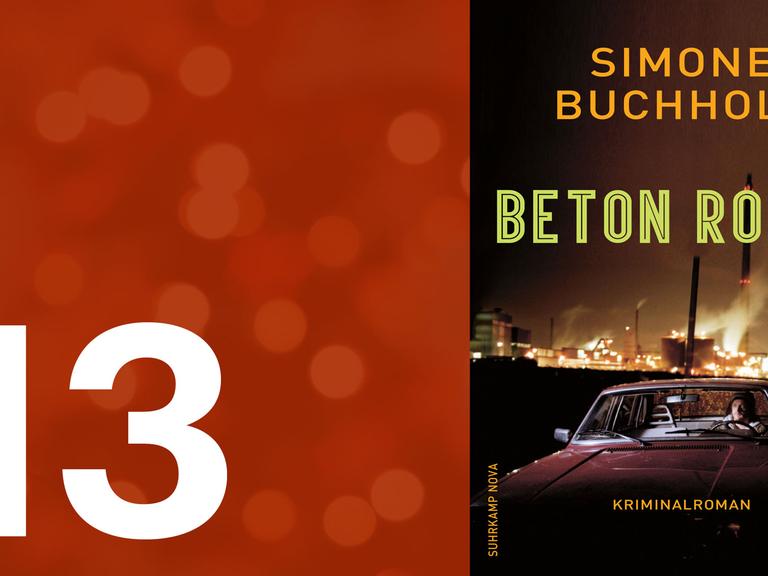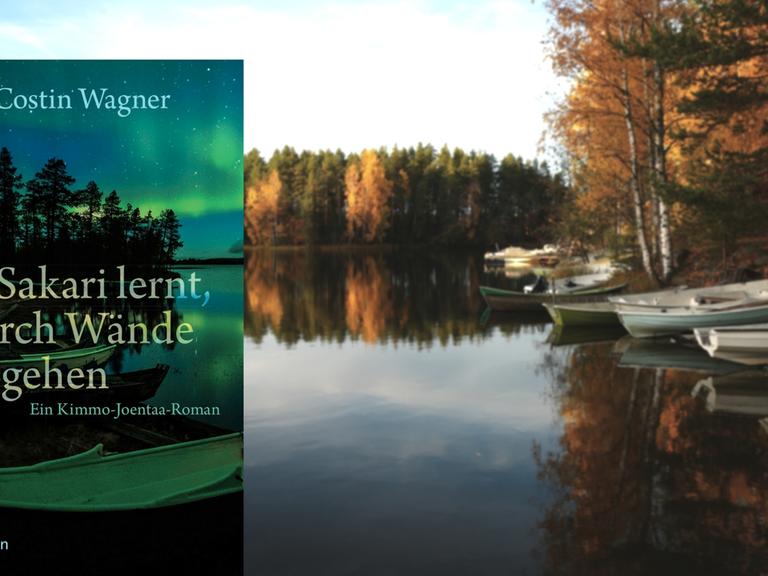Virtuoses Sittenbild einer verkommenen Gesellschaft

Von Thomas Wörtche · 15.12.2017
Er ist widerlich, hässlich und brutal: E.O. Smonk wird als Krimi-Held vermutlich vielen Lesern im Gedächtnis bleiben. Wie Tom Franklin in "Smonk: Stadt der Witwen" das Panoptikum einer US-Gesellschaft entwirft, die vor die Hunde geht, findet unser Kritiker schlicht grandios.
E.O. Smonk hat ein Glasauge, einen Kropf, Gicht, Tripper, Blutzucker, Nervenschmerzen, Schüttelfrost, Malaria und Schwindsucht. Er ist hässlich, abstoßend, brutal, ein Tyrann und Frauenschänder, mörderisch und hemmungslos. Das wandelnde Faustrecht, das eine ganze Region in Alabama im Jahr 1911 terrorisiert. Sein Arzt sagt ihm seinen baldigen Tod aus medizinischen Ursachen voraus, aber Smonk, das wissen wir von Anfang an, wird aus ganz anderen Gründen sterben. Vorher allerdings legt er, weil er sich zu Unrecht, vor Gericht gezerrt fühlt, eine Kleinstadt in Schutt und Asche.
Man denkt an die Filme von Altman und Peckinpah
So beginnt "Smonk" von Tom Franklin, ein Hybrid aus "Anti-Western" und Thriller, der einmal mehr die moral-sittlichen Grundmythen der amerikanischen Gesellschaft zerfetzt. "Smonk" schließt direkt an alle Narrative an, die spätestens seit den 1960er Jahren den "American Dream" ideologiekritisch destruierten. Neben literarischen Fixsternen wie William Faulkner und James Carlos Blake, waren das vor allem jene Filme – Italowestern und New Hollywood gleichermaßen -, die man als "Anti-Western" bezeichnete, weil sie radikal mit den verschiedenen genre-topischen Heroismen aufräumten. "Dirty little Billy" von Stan Dragoti gehört hierher, "McCabe & Mrs.Miller" von Robert Altman und vor allem "The Wild Bunch" von Sam Peckinpah.
Massaker und Kinderhuren
Dieses Amerika ist schmutzig, verkommen und extrem gewalttätig. Bevölkert von religiösen Spinnern, psychophatischen Monstern, inzestuösem White Trash, tyrannischen Gesetzeshütern, basierend auf Völkermord, Sklaverei, schreiender sozialer Ungerechtigkeit, Ausbeutung, Rassismus und dem Recht des Stärkeren.In seinem Roman "Smonk" bündelt Franklin all diese Aspekte und überhöht sie. Das Anfangsmassaker ist eine virtuose Steigerung von Peckinpahs Shootouts (inklusive Zeitlupe) und was folgt ist ein deliranter Karneval der grotesken Leiblichkeit aus dem Geiste François Rabelais – dafür steht besonders bezugreich die 15jährige Hure Evangeline, die mit ihrem Motto und Werbeschild "Ficken 1 $" und ihrer Schwangerschaft in einer durch Irrsinn steril gewordenen Gesellschaft letztendlich das utopische Moment der Romans ausmacht.
Sprachliche Artistik
Tatsächlich ist es aber die sprachliche Artistik Franklins, die aus den schon lange tradierten Motiven und Figuren (korrupte Richter, bigotte Bürgersfrauen, christlich-fanatische Deputies etc.) einen grandiosen Roman macht. Er kreuzt einen archaischen, schon fast biblischen Erzählgestus mit knappsten Lakonismen und Sarkasmen, mit Introspektionen in die krudesten Gedankengänge seiner Figuren und bedient sich auch in der Erzählerrede pausenlos aus "fremden", z.B. grob rassistischen und sexistischen Sprachebenen, deren Widerwärtigkeit dadurch umso evidenter werden. Auf jeden Fall ist es ein zunächst wunderbar zynischer Clou, dass, so erzählt, das ganze Elend extrem unterhaltend und komisch erscheint, ohne dass – an der Stelle nicht zynisch - der kritische Kern verlorengeht. Das ist eine Operation, die nicht auf Thesen über das Wesen von homo sapiens oder die conditio americana setzt, sondern strikt literarisch verfährt.