Soziale Demokratie heute
Frank Walter Steinmeier, Fraktionsvorsitzender der SPD im Bundestag, liest viel. Im Gespräch mit Claus Leggewie stellt der ehemalige Außenminister Tony Judts Traktakt "Dem Land geht es schlecht" und "Die empathische Zivilisation" von Jeremy Rifkin vor.
Claus Leggewie: Willkommen zu einer neuen Lesart Spezial aus dem Schauspiel Essen, einer Büchersendung von Deutschlandradio Kultur, der Buchhandlung Proust und dem Kulturwissenschaftlichen Institut in Essen. Unser Medienpartner ist die Westdeutsche Allgemeine Zeitung. Mein Name ist Claus Leggewie. Guten Tag.
Dass Politiker keine Bücher lesen oder höchstens im Urlaub, dürfte ein pauschales Vorurteil sein. Unser heutiger Gast, Frank Walter Steinmeier, Fraktionsvorsitzender der SPD im Bundestag und bis vor nicht so langer Zeit unser Außenminister, liest viel und wird uns ein Buch vorstellen, das er ohnehin gelesen hat, und zwei weitere, die er für uns gelesen hat. Willkommen in Essen, Herr Steinmeier.
Frank-Walter Steinmeier: Guten Abend, Herr Leggewie.
Leggewie: Alle Autoren, die wir heute unter dem Generalthema "soziale Demokratie heute" vorstellen, sind US-Amerikaner, die einen starken Bezug zu Europa haben oder hatten. Der voriges Jahr verstorbene Historiker Tony Judt kam aus England und blieb in den USA ein europäischer Kosmopolit. Der Washingtoner Ökonom und Soziologe Jeremy Rifkin ist sehr häufig auch als Berater der EU und nationaler Regierungen in Europa unterwegs und preist seinen Landsleuten die alte Welt als Vorbild. Und der Dritte, den verraten wir noch nicht.
Zum ersten Buch "Dem Land geht es schlecht" von Tony Judt: Der Titel ist aus einem irischen Klagegedicht des späten 18. Jahrhunderts entnommen. Und im Untertitel wird etwas klarer, worum es geht: "Ein Traktat über unsere Unzufriedenheit".
Man darf es vielleicht als Tony Judts Vermächtnis lesen. Judt war ein herausragender, scharf denkender Public Intelectual, ein öffentlicher Intellektueller, der seine Tätigkeit als herausragender Historiker des 20. Jahrhunderts an der New York University mit regel mäßigen Beiträgen in der berühmten New York Review of Books und der New York Times verband. Er hat mehrere grundlegende Werke über die europäische Geschichte geschrieben und ist in Europa sehr bekannt. Aber dieses schmale gewichtige Traktat ist schon im Rollstuhl entstanden, an den der Autor aufgrund einer schweren Erkrankung in seinem letzten Lebensjahr gefesselt war.
Dieses Buch ist etwas anderes. Wie haben Sie es gelesen, Herr Steinmeier?
Steinmeier: Zunächst mal ein Wort, warum amerikanische Literatur. Vielleicht hängt es ein bisschen damit zusammen, dass die Verhältnisse mit unseren amerikanischen Freunden in den letzten zehn Jahren so schwierig waren, dass ich mich – jedenfalls immer wieder dann, wenn es auf der politischen Ebene schwer ging – häufig mit amerikanischer Literatur, auch mit politikwissenschaftlicher Literatur befasst habe. Einen Unterschied zwischen uns beiden gibt es. Sie haben Tony Judt noch lebend kennengelernt. Ich kenne ihn nur aus seinen Büchern. Jeremy Rifkin kenne ich besser, habe eine Reihe seiner Bücher nach der jeweiligen deutschen Übersetzung in Deutschland vorstellen können, was anstrengend ist, weil Jeremy Rifkin schneller schreibt, als wir beide lesen können. Insofern erscheinen relativ viele Bücher.
Die beiden Autoren sind sich in vielem so ähnlich. Sie haben das eben gesagt. Sie sind etwa gleichen Alters. Sie haben mindestens zuletzt beide in Amerika gelehrt. Sie haben beide einen jüdischen Hintergrund und haben eine komplett unterschiedliche Näherung, finde ich jedenfalls, gegenüber dem alten Kontinent, gegenüber Europa.
Wenn man so will, sind es eigentlich zwei Autoren, die die Reise des Kolumbus in anderer Richtung gemacht haben, zwei Autoren, die nach der Erfahrung der Hybris des Marktes in den USA noch mal der Verunsicherung, die nicht nur Autoren, sondern auch Bürger in Amerika erfahren haben, einfach noch mal neu auf Europa geschaut haben und geschaut haben: Was geht dort eigentlich anders? Und ist das, was anders geht in Europa, möglicherweise das bessere Modell? Da kommt Tony Judt zu ganz anderen Ergebnissen als Jeremy Rifkin. Und über die Unterschiede, denke ich, werden wir reden.
Leggewie: Ich lese mal ein Zitat aus Tony Judts Buch: "Irgendetwas ist grundfalsch an der Art und Weise, wie wir heute leben. Seit 30 Jahren verherrlichen wir eigennütziges Gewinnstreben. Wenn unsere Gesellschaft überhaupt ein Ziel hat, dann ist es diese Jagd nach dem Profit. Wir wissen, was die Dinge kosten, aber wir wissen nicht, was sie wert sind. Nach einem Gerichtsurteil oder einem Gesetz fragen wir nicht, ob es gut ist, ob es gerecht und vernünftig ist."
Und dann kommt der entscheidende Appell: "Früher waren das die entscheidenden politischen Fragen, auch wenn es keine einfachen Antworten gab. Wir müssen wieder lernen, diese Fragen zu stellen."
Steinmeier: Ja, ich glaube, da hat er in vielem Recht. Oder, wenn ich es mit meinen Worten sagen müsste: Das, was sich in den letzten 20 Jahren ergeben hat, was wir auch wahrgenommen haben, auf der Bühne hat sich die Heldenrolle verändert. Vor 20 Jahren war das so. Da war der Held der Geschichte der Markt. Der Markt hat die Dinge geregelt. Und Staat und Politik, das war so etwas griesgrämig Graues, eigentlich überflüssig oder mindestens hinderlich.
Dann kam eine Phase tiefer Enttäuschungen, die nicht erst mit der Finanzmarktkrise 2008 begann, sondern schon mit einer Krise auf den Aktienmärkten 2000, 2001: das Platzen der Blase an den neuen Märkten, viele Enttäuschen, gerade auch in den USA, viele Vermögen, die vernichtet worden sind, erste Irritationen, Enttäuschungen auch darüber, dass der Markt die Dinge offenbar nicht selber regelt.
Und die dritte Phase ist die, dass man auch in den USA, und das spürt man eben bei Tony Judt, mit einer neuen Wertschätzung auf Staat und Politik schaut. Bei Tony Judt ist es so, dass er Erwartungen an den Staat formuliert, an die Politik formuliert, diese Erwartungen aber durch moderne Politik, auch der Demokraten in den USA, nicht erfüllt sieht. Und bei Tony Judt führt das zu einer merkwürdigen Rückwärtsversicherung in die amerikanische Geschichte. Er lobt den New Deal. Er lobt Roosevelt. Er lobt staatliche Investitionspolitik. Aber im Grunde genommen macht er den Schritt in die Moderne nicht mit, sieht nicht richtig, was sich in der Welt verändert hat. Oder anders ausgedrückt: Die Rezepte, die er gibt für staatliche Politik in den USA, sind immer sehr nationalstaatliche Konzepte.
Er unterstellt, dass eine amerikanische Regierung heute allein die Verhältnisse für Amerika regeln könnte. Ich glaube, das fällt inzwischen, obwohl er Historiker ist, aus meiner Sicht ein bisschen aus der Geschichte, weil die Bedingungen in den Zeiten der Globalisierung, die ich nicht heroisiere, aber die einfach stattfindet, weil die Bedingungen für Politik anders, schwieriger geworden sind. Vernetztes Handeln, der Versuch, das, was man nationalstaatlich nicht regeln kann, durch internationale Vereinbarungen zu regeln, ist viel schwerfälliger, viel langsamer. Aber nur die Anrufung der guten alten Roosevelt-Zeit wird am Ende noch keine ausreichende Erklärung sein.
Leggewie:. Aber ist das in Europa auch so? Ist der Staat deswegen schwach, weil er nicht mehr kann, weil er entkräftet worden ist, weil – heute sagen wir nicht mehr der Markt, sondern wir sehen ja plötzlich die Märkte – die Märkte ihn angreifen, aushöhlen, unterwandern? Oder ist er deswegen stark, weil wir ihn nicht stark machen als Bürgerinnen und Bürger und als politische Eliten?
Ich glaube, um es mal pointiert dagegen zu sagen, dass wir einfach eine nicht nur neue Politisierung im Moment erleben, sondern auch unbedingt einen gestaltenden Staat wieder brauchen würden, der hier klare Ansagen macht, in diese oder jene Richtung soll es gehen.
Ich nehme mal die Energiewende 1. Da wurde allen wohl und niemandem weh – ein bisschen für die Steinkohle, ein bisschen für die Atom, Verlängerung der Laufzeiten, bisschen...
Steinmeier: 1 ist jetzt Herbst letzten Jahres.
Leggewie: Das war die davor, jetzt haben wir eine andere, wo man wirklich mal einen Akzent gesetzt hat, der mir überhaupt nicht weit genug geht. Ich habe es als Beispiel gesagt. Es muss einen gestaltenden Staat geben, der auch mehr Bürgerbeteiligung zulässt. Und ich glaube, das wäre Tony Judt durchaus recht gewesen. Und Sie haben vollkommen recht. Der Nationalstaat an und für sich ist da sicherlich nicht mehr zu fähig. Aber wo sehen Sie die Ansätze zu einer globalen internationalen Kooperation?
Steinmeier: Ja, der Unterschied ist doch der, ich meine, das ist ja vielleicht auch unsere unterschiedliche Näherungsweise zu dem Text:
Wir haben gemeinsam eine Zeit durchlebt, in der das Gerede über den schlanken Staat eigentlich gesagt hat, der Staat ist überflüssig geworden. Es war das Gegenteil von einem gestaltenden Staat verlangt und eine Politik mit Anspruch wurde als eher, sagen wir mal, 19. Jahrhundert oder frühes 20. Jahrhundert begriffen, jedenfalls nicht mehr zeitgemäß.
Dann funktioniert das Ganze Modell des Marktes nicht. Es treten Erschütterungen auf, Enttäuschungen darüber, dass nicht nur keine Gerechtigkeit hergestellt wird, sondern dass in Phasen, wie wir sie nach 2008 nach dem Zusammenbrechen von Lehman Brothers und anderen erlebt haben, dass danach dann ganze Wirtschaftssysteme nicht mehr funktionieren und nur noch staatlich gestützt werden können. Das hat doch dazu geführt, dass nachdem der Staat zunächst, die Politik verpönt war, jetzt auf einmal wir in eine Phase treten, dass der Staat alles regeln soll.
Jetzt sind wir aber in einer Phase, in der wir nicht mehr allein gestalten können. Und deshalb sind diese Anrufungen, macht endlich was, natürlich jetzt etwas hilflos.
Leggewie: Sie möchten ja auch die Ressourcen haben. Die Sozialdemokratie, finde ich, hat sehr mutig gesagt, wir werden die Steuern erhöhen.
Steinmeier: Eben. Die Steuern erhöhen ist, sagen wir mal, ein Beitrag zur Ehrlichkeit, weil ich sage: Wenn es in der gegenwärtigen Krise zwei Erkenntnisse gibt, dass wir erstens uns entschulden müssen, Neuverschuldung zurückfahren, den Berg der Altschulden abbauen und zweitens gleichzeitig die Notwendigkeit haben dafür zu sorgen, dass wir bessere Schulen haben, in denen Kinder auch tatsächlich zu Abschlüssen kommen und bessere Ausbildung haben, dann müssen wir dieses Dilemma politisch lösen. Und das geht nicht im Zweifel durch weniger Geld, das geht nicht durch Verarmung des Staates, sondern da müssen wir die Leute darauf vorbereiten, dass wir keine Steuersenkungen haben werden, sondern – wie man so schön sagt – die Einnahmen konsolidieren. – Subventionsabbau, in Teilen sicherlich auch Steuererhöhungen.
Aber das ist ja sozusagen noch nicht Gestaltung von Politik. Das ist sozusagen das, was im nationalen Rahmen möglich ist. Die Wiedergewinnung von Handlungsfähigkeit der Politik oder, wie Politikwissenschaftler sagen, die Sicherung des Primats der Politik, die werden wir ja nur dann wieder herstellen, wenn wir den Menschen den Eindruck verschaffen, dass nicht mehr die Märkte das Recht bestimmen, sondern das Recht wieder die Märkte bestimmt. Und da hinzukommen, das wird nicht ganz so einfach sein, weil Sie jetzt an der ganzen Debatte über die Besteuerung der Finanzmärkte sehen, wenn sich ein einzelner Staat dazu entscheidet, bewirkt das nichts, weil Anlageinstitute und Finanzmarktplätze innerhalb von 24 Stunden ihren Sitz verlegen können – von Frankfurt nach Paris, von Paris nach London.
Deshalb muss man versuchen, so schwierig das ist, da mit anderen zusammen, mit Nachbarn zusammen zu einer Politik zu kommen, in der der Staat sich verlorenes Terrain zurückerobert.
Leggewie: Ein Kapitel in dem Buch von Tony Judt heißt ein bisschen polemisch: "Was ist lebendig und was tot an der Sozialdemokratie?" – Sie haben sich schon gedacht, dass ich Ihnen die Frage stellen werde, was Sie von der Frage halten.
Ob wir im Augenblick nach Spanien schauen auf die Bilder aus Madrid oder ob wir auf die brennenden Innenstädte in Großbritannien schauen, eines lehrt uns doch dieser Teil der Realität. Demokratie wird keine Zukunft haben ohne ein Mindestmaß an sozialer Balance. Verblendet, wie ein großer Teil der Politik vielleicht in den letzten 10, 20 Jahren war, ist das in Vergessenheit geraten. Ich glaube, es gibt eine wirkliche Chance, ich hoffe, dann auch für die SPD, und daran arbeite ich, ich hoffe, es gibt eine Chance, das Bewusstsein dafür wieder zu erwecken, dass wir noch so gutes made in Germany produzieren können, dass wir wunderbares German Engineering in die Welt verkaufen können, aber dass das hierzulande in Deutschland auf Dauer nicht geht, wenn wir nicht eine Politik haben, die für soziale Balance in dieser Gesellschaft sorgt und kulturelle, soziale Spaltungen versucht zu verhindern.
Das wird unter den sich verändernden Bedingungen immer wieder schwierig sein. Und das wird auch nie zur vollen Zufriedenheit gelingen, aber das muss der Impetus von Politik sein und bleiben. Und das ist soziale Demokratie.
Leggewie: Das Plädoyer von Tony Judt ist ja immer gewesen, sozusagen den Privatisierungswahn aufzuhören. Und er bezieht da die Formen der Sozialdemokratie, wie sie unter Schröder, Blair und anderen auch in Frankreich und in vielen anderen Ländern, Spanien haben sie schon erwähnt, seinerzeit sich Bahn gebrochen haben, wo gewissermaßen auch die Privatisierung als ein Patentrezept, die bezieht er ja ein in diese Kritik. Und das letzte Buch, an dem er gearbeitet hat, das aber nicht fertig geworden ist, war eines über die Privatisierung der britischen Eisenbahn. Das ist auch ein kleines Kapitel in diesem Buch. Und er war sozusagen ein glühender Verfechter dessen, was man jetzt nicht nur bezogen auf die Bahn – und jeder weiß ja hier, wenn ich (von) Bahn rede, von welcher Bahn wir auch in Deutschland mittlerweile reden -, dass wir nicht nur in Bezug auf die Bahn so etwas bräuchten wie eine Renaissance der Idee, des Gedankens, aber auch der Institution von öffentlichem Dienst. Das sind nämlich die einzigen Einrichtungen, die Kollektivgüter in einer Gesellschaft, aber dann natürlich auch globaler Natur verwalten können. Ich glaube nicht, dass die Märkte das können. Ich glaube nicht, dass die Privatisierung der Weg gewesen ist, um – auch ökonomisch, nebenbei gesagt – zu besseren Ergebnissen zu kommen.
Steinmeier: Nein, das ist eindeutig. Das würde ich unterschreiben. Nur ich glaube, die Darstellung von Tony Judt ist – vielleicht auch bedingt durch die Entfernungen – für das, was hierzulande geschehen ist, nach meiner Erinnerung so ganz nicht richtig. Wenn Sie die Bahn sagen, die ist nach wie vor zu 100 Prozent Staatseigentum.
Leggewie: Benimmt sich aber wie ein Privater.
Steinmeier: Für mich hat sich der zentrale Konflikt an einer ganz anderen und, ich finde, noch entscheidenderen Stelle deutlich gemacht. Das hat auch noch jeder in Erinnerung. Die große Rentenreform damals unter Walter Riester, die ist begleitet worden durch viele publizistische Initiativen, Anzeigenkampagnen. Und ich erinnere, es gab damals großflächige Beilagen zu allen deutschen Tageszeitungen, meistens den Wochenendausgaben, in denen gesagt wurde: Wer heute noch auf das klassische Rentenversicherungssystem, auf das Umlagesystem, wie das technisch heißt, sich stützt, der ist ein Idiot. Schaut an die Aktienmärkte, schaut auf die Fonds. Da kann eine Rentenversicherung wirklich Geld machen. Und wenn ihr nicht umsteigt von dem klassischen Umlagesystem der Rentenversicherung auf ein kapitalgedecktes System, dann haltet ihr den Leuten Geld vor, was die eigentlich kriegen könnten im Alter.
Das war damals ein unbeschreiblicher Druck. Ich war nicht der Arbeitsminister oder der Sozialminister, nicht, dass wir uns missverstehen. Aber für denjenigen, der da eine Reform durchzukämpfen hatte, war das ein unheimlicher Druck, weil man sich ja zunächst als Idiot dargestellt sieht, wenn man einen scheinbar sich aufdrängenden Weg nicht mitgeht. Und heute mit zehn Jahren Abstand frage ich mich manchmal: Wenn man da auch nur eine Sekunde gezuckt hätte, wenn man diesen Weg mitgegangen wäre, wenn man es wirklich verantwortet hätte, dass die deutschen Renten nur noch auf Kapitaldeckungsbasis, sprich, auf Aktien und Fonds gestützt worden wären, dann wäre heute alles weg.
Insofern: Ja, der Zeitgeist hat auch hier geweht. Und selbstverständlich auch in den Jahren, in denen wir regiert haben, waren wir nicht unabhängig vom Zeitgeist. Aber ich würde schon sagen, dass wir an den entscheidenden Stellen eben gerade einen englischen oder amerikanischen Weg nicht mitgegangen sind. Wenn das so wäre, dann würde die Republik heute anders aussehen.
Leggewie: Letzte Frage zu Tony Judt, in seinem Sinne vielleicht auch: Lässt sich der Wahnsinn der Märkte revidieren? Ist die Politik, der Staat, die Bürgergesellschaft eigentlich im Moment stark genug, um dagegen zu halten? Tony Judt redet auch von der Empörung, die da ist, die man ja jetzt überall spürt. Er hat im Grunde genommen hier auch etwas vorausgesehen, was sich dann von Kairo bis Barcelona und auch London auf den Straßen gezeigt hat. Wir sagen immer, das passiert bei uns nicht – wollen wir mal sehen. Aber ist dem überhaupt noch etwas entgegenzusetzen? Läuft die Maschinerie? Oder kann man sie aufhalten?
Steinmeier: Ich bin ja – sagen wir mal – von einer etwas anderen Struktur als Tony Judt, vermute ich. Deshalb kann ich nicht zu der Antwort kommen, da ist nichts mehr zu machen. Dieses kulturpessimistische Bild habe ich nicht, sondern jedenfalls, solange ich selbst Politik mache, streite ich natürlich dafür, dass sich etwas ändern lässt.
Aber ich will den Mund nicht so voll nehmen. Ich weiß, wie schwierig es ist, wie ich vorhin gesagt habe, verlorenes Terrain zurückzugewinnen. Es gibt, sagen wir mal, aus dem Erschrecken über die Krise an den Finanzmärkten ein paar Reaktionen, die einen bisschen optimistisch scheinen lassen. Nehmen Sie mal so Dinge wie die Debatte über die Besteuerung der Finanzmärkte. Da haben wir immer gesagt: Es kann nicht sein, dass der allgemeine Steuerzahler die ganzen Lasten der Krise trägt. Auch diejenigen, die zu den Verursachern gehören, müssen ihren Teil dazu beitragen – Finanzmarktbesteuerung.
Das war jetzt, sagen wir mal, zwei, drei Jahre fast tabuisiert in diesem Lande. Jetzt öffnet sich da zum ersten Mal eine Diskussion und das könnte der Einstieg sein, wo man dann auch eine Vergewisserung in der Politik zurückkriegt, dass wir nicht bei einer Besteuerung der Finanzmärkte stehen bleiben dürfen, sondern dass wir zu einer Art Schaffung neuer Regeln kommen, in denen erwiesenermaßen schädliche Finanzmarktprodukte tatsächlich vom Markt genommen werden. Das ist jedenfalls das Projekt, an dem wir arbeiten – nicht leicht, aber ich glaube, das ist wirklich ein Projekt, bei dem man mal sagen kann, "alternativlos", wenn wir Demokratie wahren wollen.
Leggewie: Zum zweiten Buch in Lesart Spezial: Es stammt von dem Soziologen, Ökonomen Jeremy Rifkin, ist 2010 in Deutsch unter dem Titel "Die empathische Zivilisation. Wege zu einem globalen Bewusstsein" im Campus Verlag Frankfurt erschienen. Herr Steinmeier, auch ein US-Autor, aber – Sie haben es schon angedeutet – verschiedener könnten zwei amerikanische Europakenner kaum sein, oder?
Steinmeier: Ich habe Jeremy Rifkin zum ersten Mal kennengelernt zu Zeiten, als ich Chef des Kanzleramtes war. Ich hatte ihn eingeladen, weil ich völlig erstaunt war, dass ein Amerikaner ein Buch schreibt über den europäischen Traum. Das war damals die Zeit, in der uns vorgehalten wurde, der Sozialstaat hat sich eigentlich erledigt, soziale Politik erst recht. Das war der Höhepunkt der Marktideologie in Deutschland. Frau Merkel hat damals empfohlen, dass wir uns amerikanischen Wirtschaftsweisen möglichst schnell annähern müssen. Herr Westerwelle war der Meinung, dass das irische Modell das Beste für Deutschland sei. Das war die Zeit, in der dieses Buch erschienen ist "Der europäische Traum".
Und ich hab da reingeguckt, war fasziniert, weil, mit einem solchen Selbstbewusstsein reden wir in Europa nicht über uns selbst, wie der Amerikaner auf die Europäer schaut. Ja, und es war ein Abend, der uns noch mal die Augen neu geöffnet hat. Und seitdem bin ich mit Rifkin verbunden. Sein neues Buch über die dritte industrielle Revolution ist eine Fortentwicklung der empathischen Zivilisation.
Es ist ein verrücktes Buch, weil er sich im Grunde genommen die Geschichte der Energieproduktion und des Energieverbrauchs angeschaut hat und Zeitphasen schneidet, wo er sagt: Mit der Veränderung der Energieproduktion und der Veränderung der Energienutzung verändert sich auch die Gesellschaft als ganze. Ich weiß nicht, ob das so stimmt. Und ich weiß auch nicht, ob ein Historiker zu dem Ergebnis käme, dass das alles in jeder Hinsicht haltbar ist. Aber es ist ein ganz anderes Buch als das von Tony Judt, ein sehr geschichtsoptimistisches Buch, in dem er im Grunde genommen nicht den Fortschritt per se und naiv positiv würdigt, aber in dem er sagt: Unsere Aufgabe ist es doch, die positiven Potenziale, die in jedem Fortschritt liegen, zu suchen, zu definieren und die dann, die positiven Potenziale, zur Politik zu machen. – Das ist das, was Jeremy Rifkin in diesem Buch empfiehlt. Und es ist ein Buch, das beseelt ist von einer neuen Sicht auf eine sich ökologischem Bewusstsein öffnende Welt, indem er sieht, dass die Energieversorgung sich Richtung der regenerativen Energien entwickelt, die er sich nur entwickeln sieht, wenn sie einhergeht mit einer Vernetzung der Kommunikationsinfrastruktur – das, glaube ich, ist ganz richtig – und von da aus ein ganz neues, ein ganz optimistisches Weltbild beschreibt, in dem die Politik wieder zu ihrer ordnenden Rolle für Gesellschaft zurückfindet – gänzlich anders als Tony Judt.
Leggewie: Der Rifkin schöpft ja immer aus vielen Disziplinen. Ich hab immer bewundert, wie viel wissenschaftliche Mitarbeiter an seinen Büchern mitmachen dürfen. Eine Quelle ist der Chemie-Nobelpreisträger Frederick Soddy. Der hat Folgendes geschrieben: "Letztendlich entscheiden die thermodynamischen Gesetze über Aufstieg und Fall politischer Systeme, über Freiheit und Unfreiheit von Staaten, über die Vorgänge in Handel und Industrie, dem Ursprung von Reichtum und Armut und das allgemeine physische Wohlergehen unserer Spezies." Zitat Ende.
Wir könnten denken, wenn wir die Zeitungen aufschlagen, es sind die Märkte oder, wir haben eben gesagt, vielleicht sind es auch wieder die politischen Entscheidungsträger, die darüber mitentscheiden. Ich möchte Sie mal an so einem Zitat, das ja eigentlich von unseren Naturgrenzen spricht, testen, wie grün eigentlich auch eine soziale Demokratie heute ist, indem sie anerkennt, dass wir letztendlich auf den thermodynamischen Gesetzen, erster und zweiter Satz, rekurrieren müssen, um zu sehen, wie wir Politik, wie wir das Handeln von Ökonomie ansetzen.
Steinmeier: Ich weiß nicht, ob das notwendig ist. Ich meine, ich bin kein im Herzen Grüner – keine Missverständnisse aufkommen lassen. Aber ich zähle mich schon zu den Menschen, die wissen, dass unsere Naturvorräte endlich sind, und die wissen, dass wir unseren kommenden Generationen ein lebenswertes Leben auf dieser Erde übergeben müssen. Ich meine, ich gehöre zu denjenigen, die nicht die Energiewende 1 und nicht die Energiewende 2, sondern die richtige Energiewende im Jahre 2000 verhandelt haben.
Wie das jetzt in Zukunft wird, weiß ich nicht, weil wir eine Menge von Zielen vereinbart haben, wie schnell wir mit welchen Anteilen erneuerbare Energien schaffen wollen. Aber wir haben keine Infrastruktur, damit sind wir bei Jeremy Rifkin, um die regenerativ erzeugte Energie – meinetwegen in der Ostsee, meinetwegen in der Nordsee – dahin zu transportieren, wo sie gebraucht wird. Das ist ein bislang ungelöstes Problem. Insofern sage ich vollends ja zu der Notwendigkeit einer Politik mit Rücksicht auf knapper werdende Ressourcenvorkommen, mit Rücksicht auf die Veränderung des Weltklimas, mit Blick auf die Zukunft dieser Welt für unsere Kinder. Natürlich finde ich das notwendig, in unsere Politik zu integrieren. Ich finde, wenn man sich nur auf diesen Ansatz beschränkt, es zu knapp, weil die Menschen einfach mehr Erwartungen an uns, an die Politik haben. Und die versuche ich, in einen deutlich ganzheitlicheren Ansatz einzubringen.
Leggewie: Das Buch heißt ja "Die empathische Zivilisation". Viele werden nicht so genau wissen, was überhaupt mit dem Begriff Empathie gemeint ist. Deswegen zwei Fragen: Könnten Sie das ganz kurz skizzieren, was eigentlich Rifkin mit einer empathischen Zivilisation meint? Und wie wirkt das auf einen handelnden Politiker. Also, wenn hier jemand von Empathie spricht als eigentlich das Leitprinzip künftiger Vergemeinschaftung?
Steinmeier: Bei der Buchvorstellung haben wir genau über diesen Begriff gestritten. Und ich habe ihm auch gesagt, dass ich ihm in seiner Darstellung so nicht folgen kann. Empathie hat mehr als emotionale Befürwortung eines politischen Ziels. Bei ihm ist empathische Zivilisation ein Entwicklungsprozess, bei dem er unterstellt, dass wir durch die Veränderung von Produktionsformen und von Energienutzung sozusagen, wie er sagt, zur Kollaboration gezwungen sind, Menschen untereinander gezwungen sind oder sich freiwillig stärker miteinander zu vernetzen.
Es ist jemand, Sie merken, dass der ganz stark aus der Perspektive der Internetgeneration heraus denkt und die Umgangsformen der Internetgeneration sozusagen auf gesellschaftliche Demokratie überträgt. Ich hab ihm gesagt: Dieser Zwangsläufigkeit folge ich nicht. Meine Erfahrung als Politiker spricht eher dagegen, dass ohne Politik und ohne politischen Rahmen die Menschen sich einfach zusammenfinden und geradezu selbstlos nach den jeweils besten Lösungen suchen. Dazu stehen halt häufig genug – ich glaube, das ist fast banal –die Interessen von Menschen oder Menschengruppen oder Branchen oder was immer Sie nehmen im Alltag im Widerspruch zueinander. Und geregelte Formen der Konfliktschlichtung, mindestens das muss Politik anbieten, das geht meistens nicht ohne eine Zielrichtung, in der sich Gesellschaft entwickeln soll. Und dafür ist jedenfalls gewählte Politik auch verantwortlich – Orientierung zu geben, wenn Sie so wollen.
Leggewie: Ich glaube, das Buch lohnt sich gleichwohl, obwohl es so etwas Visionäres hat, zu lesen, weil es im Grunde genommen nicht wie die Märkte oder der rational choice, den uns die Ökonomen immer vorhalten, die rationale Wahl des Nutzenmaximierers, die von einer Wolfsnatur des Menschen ausgeht, wo jeder des anderen Feind ist und nur auf seinen Vorteil bedacht ist, sondern wo eigentlich die Anlagen im Menschen gefördert werden sollen, zum Beispiel durch Bildung, Sozialisation, aber auch Politik...
Steinmeier: Dagegen haben wir ja nichts.
Leggewie: ... die auf Empathie aus sind. Die schöne Übung in unserer Sendung, die damit leider schon so langsam zu Ende geht, ist, dass der Gast auch immer noch ein Buch zur Lektüre empfiehlt, das er oder sie zuletzt gelesen hat. Und das stammt auch von einem Amerikaner mit europäischer, in diesem Fall auch deutscher Affinität, einem großen Kollegen von Ihnen.
Steinmeier: In aller Bescheidenheit. Nein, das ist Absicht, dass es sich um ein drittes amerikanisches Buch handelt. Das hat etwas mit meinem Einleitungssatz zu tun, mit einem schwierigen Verhältnis, das wir in den letzten zehn Jahren mitunter, rund um den Irakkrieg, mit den Amerikanern hatten. Aber es hat viel Kraft und viel Konzentration auf dieses deutsch-amerikanische Verhältnis gekostet. Und manchmal denke ich mir, vielleicht hat die Konzentration darauf dazu geführt, dass wir etwas anderes nicht mit derselben Konzentration beachtet und beobachtet haben. Das ist das, was sich in Ostasien tut. Und deshalb empfehle ich Ihnen dringend zur Lektüre ein wunderbares, faszinierendes Buch von Henry Kissinger: "On China" heißt es.
Leggewie: Vielen Dank, Herr Steinmeier. Das war eine Lesart Spezial von Deutschlandradio Kultur, mit dem wir vom Kulturwissenschaftlichen Institut gemeinsam mit der Buchhandlung Proust diese Sendung produzieren. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag.
Literatur:
Tony Judt "Dem Land geht es schlecht. Ein Traktat über unsere Unzufriedenheit", Hanser 2011
Jeremy Rifkin "Die empathische Zivilisation. Wege zu einem globalen Bewusstsein", Campus 2011
Dass Politiker keine Bücher lesen oder höchstens im Urlaub, dürfte ein pauschales Vorurteil sein. Unser heutiger Gast, Frank Walter Steinmeier, Fraktionsvorsitzender der SPD im Bundestag und bis vor nicht so langer Zeit unser Außenminister, liest viel und wird uns ein Buch vorstellen, das er ohnehin gelesen hat, und zwei weitere, die er für uns gelesen hat. Willkommen in Essen, Herr Steinmeier.
Frank-Walter Steinmeier: Guten Abend, Herr Leggewie.
Leggewie: Alle Autoren, die wir heute unter dem Generalthema "soziale Demokratie heute" vorstellen, sind US-Amerikaner, die einen starken Bezug zu Europa haben oder hatten. Der voriges Jahr verstorbene Historiker Tony Judt kam aus England und blieb in den USA ein europäischer Kosmopolit. Der Washingtoner Ökonom und Soziologe Jeremy Rifkin ist sehr häufig auch als Berater der EU und nationaler Regierungen in Europa unterwegs und preist seinen Landsleuten die alte Welt als Vorbild. Und der Dritte, den verraten wir noch nicht.
Zum ersten Buch "Dem Land geht es schlecht" von Tony Judt: Der Titel ist aus einem irischen Klagegedicht des späten 18. Jahrhunderts entnommen. Und im Untertitel wird etwas klarer, worum es geht: "Ein Traktat über unsere Unzufriedenheit".
Man darf es vielleicht als Tony Judts Vermächtnis lesen. Judt war ein herausragender, scharf denkender Public Intelectual, ein öffentlicher Intellektueller, der seine Tätigkeit als herausragender Historiker des 20. Jahrhunderts an der New York University mit regel mäßigen Beiträgen in der berühmten New York Review of Books und der New York Times verband. Er hat mehrere grundlegende Werke über die europäische Geschichte geschrieben und ist in Europa sehr bekannt. Aber dieses schmale gewichtige Traktat ist schon im Rollstuhl entstanden, an den der Autor aufgrund einer schweren Erkrankung in seinem letzten Lebensjahr gefesselt war.
Dieses Buch ist etwas anderes. Wie haben Sie es gelesen, Herr Steinmeier?
Steinmeier: Zunächst mal ein Wort, warum amerikanische Literatur. Vielleicht hängt es ein bisschen damit zusammen, dass die Verhältnisse mit unseren amerikanischen Freunden in den letzten zehn Jahren so schwierig waren, dass ich mich – jedenfalls immer wieder dann, wenn es auf der politischen Ebene schwer ging – häufig mit amerikanischer Literatur, auch mit politikwissenschaftlicher Literatur befasst habe. Einen Unterschied zwischen uns beiden gibt es. Sie haben Tony Judt noch lebend kennengelernt. Ich kenne ihn nur aus seinen Büchern. Jeremy Rifkin kenne ich besser, habe eine Reihe seiner Bücher nach der jeweiligen deutschen Übersetzung in Deutschland vorstellen können, was anstrengend ist, weil Jeremy Rifkin schneller schreibt, als wir beide lesen können. Insofern erscheinen relativ viele Bücher.
Die beiden Autoren sind sich in vielem so ähnlich. Sie haben das eben gesagt. Sie sind etwa gleichen Alters. Sie haben mindestens zuletzt beide in Amerika gelehrt. Sie haben beide einen jüdischen Hintergrund und haben eine komplett unterschiedliche Näherung, finde ich jedenfalls, gegenüber dem alten Kontinent, gegenüber Europa.
Wenn man so will, sind es eigentlich zwei Autoren, die die Reise des Kolumbus in anderer Richtung gemacht haben, zwei Autoren, die nach der Erfahrung der Hybris des Marktes in den USA noch mal der Verunsicherung, die nicht nur Autoren, sondern auch Bürger in Amerika erfahren haben, einfach noch mal neu auf Europa geschaut haben und geschaut haben: Was geht dort eigentlich anders? Und ist das, was anders geht in Europa, möglicherweise das bessere Modell? Da kommt Tony Judt zu ganz anderen Ergebnissen als Jeremy Rifkin. Und über die Unterschiede, denke ich, werden wir reden.
Leggewie: Ich lese mal ein Zitat aus Tony Judts Buch: "Irgendetwas ist grundfalsch an der Art und Weise, wie wir heute leben. Seit 30 Jahren verherrlichen wir eigennütziges Gewinnstreben. Wenn unsere Gesellschaft überhaupt ein Ziel hat, dann ist es diese Jagd nach dem Profit. Wir wissen, was die Dinge kosten, aber wir wissen nicht, was sie wert sind. Nach einem Gerichtsurteil oder einem Gesetz fragen wir nicht, ob es gut ist, ob es gerecht und vernünftig ist."
Und dann kommt der entscheidende Appell: "Früher waren das die entscheidenden politischen Fragen, auch wenn es keine einfachen Antworten gab. Wir müssen wieder lernen, diese Fragen zu stellen."
Steinmeier: Ja, ich glaube, da hat er in vielem Recht. Oder, wenn ich es mit meinen Worten sagen müsste: Das, was sich in den letzten 20 Jahren ergeben hat, was wir auch wahrgenommen haben, auf der Bühne hat sich die Heldenrolle verändert. Vor 20 Jahren war das so. Da war der Held der Geschichte der Markt. Der Markt hat die Dinge geregelt. Und Staat und Politik, das war so etwas griesgrämig Graues, eigentlich überflüssig oder mindestens hinderlich.
Dann kam eine Phase tiefer Enttäuschungen, die nicht erst mit der Finanzmarktkrise 2008 begann, sondern schon mit einer Krise auf den Aktienmärkten 2000, 2001: das Platzen der Blase an den neuen Märkten, viele Enttäuschen, gerade auch in den USA, viele Vermögen, die vernichtet worden sind, erste Irritationen, Enttäuschungen auch darüber, dass der Markt die Dinge offenbar nicht selber regelt.
Und die dritte Phase ist die, dass man auch in den USA, und das spürt man eben bei Tony Judt, mit einer neuen Wertschätzung auf Staat und Politik schaut. Bei Tony Judt ist es so, dass er Erwartungen an den Staat formuliert, an die Politik formuliert, diese Erwartungen aber durch moderne Politik, auch der Demokraten in den USA, nicht erfüllt sieht. Und bei Tony Judt führt das zu einer merkwürdigen Rückwärtsversicherung in die amerikanische Geschichte. Er lobt den New Deal. Er lobt Roosevelt. Er lobt staatliche Investitionspolitik. Aber im Grunde genommen macht er den Schritt in die Moderne nicht mit, sieht nicht richtig, was sich in der Welt verändert hat. Oder anders ausgedrückt: Die Rezepte, die er gibt für staatliche Politik in den USA, sind immer sehr nationalstaatliche Konzepte.
Er unterstellt, dass eine amerikanische Regierung heute allein die Verhältnisse für Amerika regeln könnte. Ich glaube, das fällt inzwischen, obwohl er Historiker ist, aus meiner Sicht ein bisschen aus der Geschichte, weil die Bedingungen in den Zeiten der Globalisierung, die ich nicht heroisiere, aber die einfach stattfindet, weil die Bedingungen für Politik anders, schwieriger geworden sind. Vernetztes Handeln, der Versuch, das, was man nationalstaatlich nicht regeln kann, durch internationale Vereinbarungen zu regeln, ist viel schwerfälliger, viel langsamer. Aber nur die Anrufung der guten alten Roosevelt-Zeit wird am Ende noch keine ausreichende Erklärung sein.
Leggewie:. Aber ist das in Europa auch so? Ist der Staat deswegen schwach, weil er nicht mehr kann, weil er entkräftet worden ist, weil – heute sagen wir nicht mehr der Markt, sondern wir sehen ja plötzlich die Märkte – die Märkte ihn angreifen, aushöhlen, unterwandern? Oder ist er deswegen stark, weil wir ihn nicht stark machen als Bürgerinnen und Bürger und als politische Eliten?
Ich glaube, um es mal pointiert dagegen zu sagen, dass wir einfach eine nicht nur neue Politisierung im Moment erleben, sondern auch unbedingt einen gestaltenden Staat wieder brauchen würden, der hier klare Ansagen macht, in diese oder jene Richtung soll es gehen.
Ich nehme mal die Energiewende 1. Da wurde allen wohl und niemandem weh – ein bisschen für die Steinkohle, ein bisschen für die Atom, Verlängerung der Laufzeiten, bisschen...
Steinmeier: 1 ist jetzt Herbst letzten Jahres.
Leggewie: Das war die davor, jetzt haben wir eine andere, wo man wirklich mal einen Akzent gesetzt hat, der mir überhaupt nicht weit genug geht. Ich habe es als Beispiel gesagt. Es muss einen gestaltenden Staat geben, der auch mehr Bürgerbeteiligung zulässt. Und ich glaube, das wäre Tony Judt durchaus recht gewesen. Und Sie haben vollkommen recht. Der Nationalstaat an und für sich ist da sicherlich nicht mehr zu fähig. Aber wo sehen Sie die Ansätze zu einer globalen internationalen Kooperation?
Steinmeier: Ja, der Unterschied ist doch der, ich meine, das ist ja vielleicht auch unsere unterschiedliche Näherungsweise zu dem Text:
Wir haben gemeinsam eine Zeit durchlebt, in der das Gerede über den schlanken Staat eigentlich gesagt hat, der Staat ist überflüssig geworden. Es war das Gegenteil von einem gestaltenden Staat verlangt und eine Politik mit Anspruch wurde als eher, sagen wir mal, 19. Jahrhundert oder frühes 20. Jahrhundert begriffen, jedenfalls nicht mehr zeitgemäß.
Dann funktioniert das Ganze Modell des Marktes nicht. Es treten Erschütterungen auf, Enttäuschungen darüber, dass nicht nur keine Gerechtigkeit hergestellt wird, sondern dass in Phasen, wie wir sie nach 2008 nach dem Zusammenbrechen von Lehman Brothers und anderen erlebt haben, dass danach dann ganze Wirtschaftssysteme nicht mehr funktionieren und nur noch staatlich gestützt werden können. Das hat doch dazu geführt, dass nachdem der Staat zunächst, die Politik verpönt war, jetzt auf einmal wir in eine Phase treten, dass der Staat alles regeln soll.
Jetzt sind wir aber in einer Phase, in der wir nicht mehr allein gestalten können. Und deshalb sind diese Anrufungen, macht endlich was, natürlich jetzt etwas hilflos.
Leggewie: Sie möchten ja auch die Ressourcen haben. Die Sozialdemokratie, finde ich, hat sehr mutig gesagt, wir werden die Steuern erhöhen.
Steinmeier: Eben. Die Steuern erhöhen ist, sagen wir mal, ein Beitrag zur Ehrlichkeit, weil ich sage: Wenn es in der gegenwärtigen Krise zwei Erkenntnisse gibt, dass wir erstens uns entschulden müssen, Neuverschuldung zurückfahren, den Berg der Altschulden abbauen und zweitens gleichzeitig die Notwendigkeit haben dafür zu sorgen, dass wir bessere Schulen haben, in denen Kinder auch tatsächlich zu Abschlüssen kommen und bessere Ausbildung haben, dann müssen wir dieses Dilemma politisch lösen. Und das geht nicht im Zweifel durch weniger Geld, das geht nicht durch Verarmung des Staates, sondern da müssen wir die Leute darauf vorbereiten, dass wir keine Steuersenkungen haben werden, sondern – wie man so schön sagt – die Einnahmen konsolidieren. – Subventionsabbau, in Teilen sicherlich auch Steuererhöhungen.
Aber das ist ja sozusagen noch nicht Gestaltung von Politik. Das ist sozusagen das, was im nationalen Rahmen möglich ist. Die Wiedergewinnung von Handlungsfähigkeit der Politik oder, wie Politikwissenschaftler sagen, die Sicherung des Primats der Politik, die werden wir ja nur dann wieder herstellen, wenn wir den Menschen den Eindruck verschaffen, dass nicht mehr die Märkte das Recht bestimmen, sondern das Recht wieder die Märkte bestimmt. Und da hinzukommen, das wird nicht ganz so einfach sein, weil Sie jetzt an der ganzen Debatte über die Besteuerung der Finanzmärkte sehen, wenn sich ein einzelner Staat dazu entscheidet, bewirkt das nichts, weil Anlageinstitute und Finanzmarktplätze innerhalb von 24 Stunden ihren Sitz verlegen können – von Frankfurt nach Paris, von Paris nach London.
Deshalb muss man versuchen, so schwierig das ist, da mit anderen zusammen, mit Nachbarn zusammen zu einer Politik zu kommen, in der der Staat sich verlorenes Terrain zurückerobert.
Leggewie: Ein Kapitel in dem Buch von Tony Judt heißt ein bisschen polemisch: "Was ist lebendig und was tot an der Sozialdemokratie?" – Sie haben sich schon gedacht, dass ich Ihnen die Frage stellen werde, was Sie von der Frage halten.
Ob wir im Augenblick nach Spanien schauen auf die Bilder aus Madrid oder ob wir auf die brennenden Innenstädte in Großbritannien schauen, eines lehrt uns doch dieser Teil der Realität. Demokratie wird keine Zukunft haben ohne ein Mindestmaß an sozialer Balance. Verblendet, wie ein großer Teil der Politik vielleicht in den letzten 10, 20 Jahren war, ist das in Vergessenheit geraten. Ich glaube, es gibt eine wirkliche Chance, ich hoffe, dann auch für die SPD, und daran arbeite ich, ich hoffe, es gibt eine Chance, das Bewusstsein dafür wieder zu erwecken, dass wir noch so gutes made in Germany produzieren können, dass wir wunderbares German Engineering in die Welt verkaufen können, aber dass das hierzulande in Deutschland auf Dauer nicht geht, wenn wir nicht eine Politik haben, die für soziale Balance in dieser Gesellschaft sorgt und kulturelle, soziale Spaltungen versucht zu verhindern.
Das wird unter den sich verändernden Bedingungen immer wieder schwierig sein. Und das wird auch nie zur vollen Zufriedenheit gelingen, aber das muss der Impetus von Politik sein und bleiben. Und das ist soziale Demokratie.
Leggewie: Das Plädoyer von Tony Judt ist ja immer gewesen, sozusagen den Privatisierungswahn aufzuhören. Und er bezieht da die Formen der Sozialdemokratie, wie sie unter Schröder, Blair und anderen auch in Frankreich und in vielen anderen Ländern, Spanien haben sie schon erwähnt, seinerzeit sich Bahn gebrochen haben, wo gewissermaßen auch die Privatisierung als ein Patentrezept, die bezieht er ja ein in diese Kritik. Und das letzte Buch, an dem er gearbeitet hat, das aber nicht fertig geworden ist, war eines über die Privatisierung der britischen Eisenbahn. Das ist auch ein kleines Kapitel in diesem Buch. Und er war sozusagen ein glühender Verfechter dessen, was man jetzt nicht nur bezogen auf die Bahn – und jeder weiß ja hier, wenn ich (von) Bahn rede, von welcher Bahn wir auch in Deutschland mittlerweile reden -, dass wir nicht nur in Bezug auf die Bahn so etwas bräuchten wie eine Renaissance der Idee, des Gedankens, aber auch der Institution von öffentlichem Dienst. Das sind nämlich die einzigen Einrichtungen, die Kollektivgüter in einer Gesellschaft, aber dann natürlich auch globaler Natur verwalten können. Ich glaube nicht, dass die Märkte das können. Ich glaube nicht, dass die Privatisierung der Weg gewesen ist, um – auch ökonomisch, nebenbei gesagt – zu besseren Ergebnissen zu kommen.
Steinmeier: Nein, das ist eindeutig. Das würde ich unterschreiben. Nur ich glaube, die Darstellung von Tony Judt ist – vielleicht auch bedingt durch die Entfernungen – für das, was hierzulande geschehen ist, nach meiner Erinnerung so ganz nicht richtig. Wenn Sie die Bahn sagen, die ist nach wie vor zu 100 Prozent Staatseigentum.
Leggewie: Benimmt sich aber wie ein Privater.
Steinmeier: Für mich hat sich der zentrale Konflikt an einer ganz anderen und, ich finde, noch entscheidenderen Stelle deutlich gemacht. Das hat auch noch jeder in Erinnerung. Die große Rentenreform damals unter Walter Riester, die ist begleitet worden durch viele publizistische Initiativen, Anzeigenkampagnen. Und ich erinnere, es gab damals großflächige Beilagen zu allen deutschen Tageszeitungen, meistens den Wochenendausgaben, in denen gesagt wurde: Wer heute noch auf das klassische Rentenversicherungssystem, auf das Umlagesystem, wie das technisch heißt, sich stützt, der ist ein Idiot. Schaut an die Aktienmärkte, schaut auf die Fonds. Da kann eine Rentenversicherung wirklich Geld machen. Und wenn ihr nicht umsteigt von dem klassischen Umlagesystem der Rentenversicherung auf ein kapitalgedecktes System, dann haltet ihr den Leuten Geld vor, was die eigentlich kriegen könnten im Alter.
Das war damals ein unbeschreiblicher Druck. Ich war nicht der Arbeitsminister oder der Sozialminister, nicht, dass wir uns missverstehen. Aber für denjenigen, der da eine Reform durchzukämpfen hatte, war das ein unheimlicher Druck, weil man sich ja zunächst als Idiot dargestellt sieht, wenn man einen scheinbar sich aufdrängenden Weg nicht mitgeht. Und heute mit zehn Jahren Abstand frage ich mich manchmal: Wenn man da auch nur eine Sekunde gezuckt hätte, wenn man diesen Weg mitgegangen wäre, wenn man es wirklich verantwortet hätte, dass die deutschen Renten nur noch auf Kapitaldeckungsbasis, sprich, auf Aktien und Fonds gestützt worden wären, dann wäre heute alles weg.
Insofern: Ja, der Zeitgeist hat auch hier geweht. Und selbstverständlich auch in den Jahren, in denen wir regiert haben, waren wir nicht unabhängig vom Zeitgeist. Aber ich würde schon sagen, dass wir an den entscheidenden Stellen eben gerade einen englischen oder amerikanischen Weg nicht mitgegangen sind. Wenn das so wäre, dann würde die Republik heute anders aussehen.
Leggewie: Letzte Frage zu Tony Judt, in seinem Sinne vielleicht auch: Lässt sich der Wahnsinn der Märkte revidieren? Ist die Politik, der Staat, die Bürgergesellschaft eigentlich im Moment stark genug, um dagegen zu halten? Tony Judt redet auch von der Empörung, die da ist, die man ja jetzt überall spürt. Er hat im Grunde genommen hier auch etwas vorausgesehen, was sich dann von Kairo bis Barcelona und auch London auf den Straßen gezeigt hat. Wir sagen immer, das passiert bei uns nicht – wollen wir mal sehen. Aber ist dem überhaupt noch etwas entgegenzusetzen? Läuft die Maschinerie? Oder kann man sie aufhalten?
Steinmeier: Ich bin ja – sagen wir mal – von einer etwas anderen Struktur als Tony Judt, vermute ich. Deshalb kann ich nicht zu der Antwort kommen, da ist nichts mehr zu machen. Dieses kulturpessimistische Bild habe ich nicht, sondern jedenfalls, solange ich selbst Politik mache, streite ich natürlich dafür, dass sich etwas ändern lässt.
Aber ich will den Mund nicht so voll nehmen. Ich weiß, wie schwierig es ist, wie ich vorhin gesagt habe, verlorenes Terrain zurückzugewinnen. Es gibt, sagen wir mal, aus dem Erschrecken über die Krise an den Finanzmärkten ein paar Reaktionen, die einen bisschen optimistisch scheinen lassen. Nehmen Sie mal so Dinge wie die Debatte über die Besteuerung der Finanzmärkte. Da haben wir immer gesagt: Es kann nicht sein, dass der allgemeine Steuerzahler die ganzen Lasten der Krise trägt. Auch diejenigen, die zu den Verursachern gehören, müssen ihren Teil dazu beitragen – Finanzmarktbesteuerung.
Das war jetzt, sagen wir mal, zwei, drei Jahre fast tabuisiert in diesem Lande. Jetzt öffnet sich da zum ersten Mal eine Diskussion und das könnte der Einstieg sein, wo man dann auch eine Vergewisserung in der Politik zurückkriegt, dass wir nicht bei einer Besteuerung der Finanzmärkte stehen bleiben dürfen, sondern dass wir zu einer Art Schaffung neuer Regeln kommen, in denen erwiesenermaßen schädliche Finanzmarktprodukte tatsächlich vom Markt genommen werden. Das ist jedenfalls das Projekt, an dem wir arbeiten – nicht leicht, aber ich glaube, das ist wirklich ein Projekt, bei dem man mal sagen kann, "alternativlos", wenn wir Demokratie wahren wollen.
Leggewie: Zum zweiten Buch in Lesart Spezial: Es stammt von dem Soziologen, Ökonomen Jeremy Rifkin, ist 2010 in Deutsch unter dem Titel "Die empathische Zivilisation. Wege zu einem globalen Bewusstsein" im Campus Verlag Frankfurt erschienen. Herr Steinmeier, auch ein US-Autor, aber – Sie haben es schon angedeutet – verschiedener könnten zwei amerikanische Europakenner kaum sein, oder?
Steinmeier: Ich habe Jeremy Rifkin zum ersten Mal kennengelernt zu Zeiten, als ich Chef des Kanzleramtes war. Ich hatte ihn eingeladen, weil ich völlig erstaunt war, dass ein Amerikaner ein Buch schreibt über den europäischen Traum. Das war damals die Zeit, in der uns vorgehalten wurde, der Sozialstaat hat sich eigentlich erledigt, soziale Politik erst recht. Das war der Höhepunkt der Marktideologie in Deutschland. Frau Merkel hat damals empfohlen, dass wir uns amerikanischen Wirtschaftsweisen möglichst schnell annähern müssen. Herr Westerwelle war der Meinung, dass das irische Modell das Beste für Deutschland sei. Das war die Zeit, in der dieses Buch erschienen ist "Der europäische Traum".
Und ich hab da reingeguckt, war fasziniert, weil, mit einem solchen Selbstbewusstsein reden wir in Europa nicht über uns selbst, wie der Amerikaner auf die Europäer schaut. Ja, und es war ein Abend, der uns noch mal die Augen neu geöffnet hat. Und seitdem bin ich mit Rifkin verbunden. Sein neues Buch über die dritte industrielle Revolution ist eine Fortentwicklung der empathischen Zivilisation.
Es ist ein verrücktes Buch, weil er sich im Grunde genommen die Geschichte der Energieproduktion und des Energieverbrauchs angeschaut hat und Zeitphasen schneidet, wo er sagt: Mit der Veränderung der Energieproduktion und der Veränderung der Energienutzung verändert sich auch die Gesellschaft als ganze. Ich weiß nicht, ob das so stimmt. Und ich weiß auch nicht, ob ein Historiker zu dem Ergebnis käme, dass das alles in jeder Hinsicht haltbar ist. Aber es ist ein ganz anderes Buch als das von Tony Judt, ein sehr geschichtsoptimistisches Buch, in dem er im Grunde genommen nicht den Fortschritt per se und naiv positiv würdigt, aber in dem er sagt: Unsere Aufgabe ist es doch, die positiven Potenziale, die in jedem Fortschritt liegen, zu suchen, zu definieren und die dann, die positiven Potenziale, zur Politik zu machen. – Das ist das, was Jeremy Rifkin in diesem Buch empfiehlt. Und es ist ein Buch, das beseelt ist von einer neuen Sicht auf eine sich ökologischem Bewusstsein öffnende Welt, indem er sieht, dass die Energieversorgung sich Richtung der regenerativen Energien entwickelt, die er sich nur entwickeln sieht, wenn sie einhergeht mit einer Vernetzung der Kommunikationsinfrastruktur – das, glaube ich, ist ganz richtig – und von da aus ein ganz neues, ein ganz optimistisches Weltbild beschreibt, in dem die Politik wieder zu ihrer ordnenden Rolle für Gesellschaft zurückfindet – gänzlich anders als Tony Judt.
Leggewie: Der Rifkin schöpft ja immer aus vielen Disziplinen. Ich hab immer bewundert, wie viel wissenschaftliche Mitarbeiter an seinen Büchern mitmachen dürfen. Eine Quelle ist der Chemie-Nobelpreisträger Frederick Soddy. Der hat Folgendes geschrieben: "Letztendlich entscheiden die thermodynamischen Gesetze über Aufstieg und Fall politischer Systeme, über Freiheit und Unfreiheit von Staaten, über die Vorgänge in Handel und Industrie, dem Ursprung von Reichtum und Armut und das allgemeine physische Wohlergehen unserer Spezies." Zitat Ende.
Wir könnten denken, wenn wir die Zeitungen aufschlagen, es sind die Märkte oder, wir haben eben gesagt, vielleicht sind es auch wieder die politischen Entscheidungsträger, die darüber mitentscheiden. Ich möchte Sie mal an so einem Zitat, das ja eigentlich von unseren Naturgrenzen spricht, testen, wie grün eigentlich auch eine soziale Demokratie heute ist, indem sie anerkennt, dass wir letztendlich auf den thermodynamischen Gesetzen, erster und zweiter Satz, rekurrieren müssen, um zu sehen, wie wir Politik, wie wir das Handeln von Ökonomie ansetzen.
Steinmeier: Ich weiß nicht, ob das notwendig ist. Ich meine, ich bin kein im Herzen Grüner – keine Missverständnisse aufkommen lassen. Aber ich zähle mich schon zu den Menschen, die wissen, dass unsere Naturvorräte endlich sind, und die wissen, dass wir unseren kommenden Generationen ein lebenswertes Leben auf dieser Erde übergeben müssen. Ich meine, ich gehöre zu denjenigen, die nicht die Energiewende 1 und nicht die Energiewende 2, sondern die richtige Energiewende im Jahre 2000 verhandelt haben.
Wie das jetzt in Zukunft wird, weiß ich nicht, weil wir eine Menge von Zielen vereinbart haben, wie schnell wir mit welchen Anteilen erneuerbare Energien schaffen wollen. Aber wir haben keine Infrastruktur, damit sind wir bei Jeremy Rifkin, um die regenerativ erzeugte Energie – meinetwegen in der Ostsee, meinetwegen in der Nordsee – dahin zu transportieren, wo sie gebraucht wird. Das ist ein bislang ungelöstes Problem. Insofern sage ich vollends ja zu der Notwendigkeit einer Politik mit Rücksicht auf knapper werdende Ressourcenvorkommen, mit Rücksicht auf die Veränderung des Weltklimas, mit Blick auf die Zukunft dieser Welt für unsere Kinder. Natürlich finde ich das notwendig, in unsere Politik zu integrieren. Ich finde, wenn man sich nur auf diesen Ansatz beschränkt, es zu knapp, weil die Menschen einfach mehr Erwartungen an uns, an die Politik haben. Und die versuche ich, in einen deutlich ganzheitlicheren Ansatz einzubringen.
Leggewie: Das Buch heißt ja "Die empathische Zivilisation". Viele werden nicht so genau wissen, was überhaupt mit dem Begriff Empathie gemeint ist. Deswegen zwei Fragen: Könnten Sie das ganz kurz skizzieren, was eigentlich Rifkin mit einer empathischen Zivilisation meint? Und wie wirkt das auf einen handelnden Politiker. Also, wenn hier jemand von Empathie spricht als eigentlich das Leitprinzip künftiger Vergemeinschaftung?
Steinmeier: Bei der Buchvorstellung haben wir genau über diesen Begriff gestritten. Und ich habe ihm auch gesagt, dass ich ihm in seiner Darstellung so nicht folgen kann. Empathie hat mehr als emotionale Befürwortung eines politischen Ziels. Bei ihm ist empathische Zivilisation ein Entwicklungsprozess, bei dem er unterstellt, dass wir durch die Veränderung von Produktionsformen und von Energienutzung sozusagen, wie er sagt, zur Kollaboration gezwungen sind, Menschen untereinander gezwungen sind oder sich freiwillig stärker miteinander zu vernetzen.
Es ist jemand, Sie merken, dass der ganz stark aus der Perspektive der Internetgeneration heraus denkt und die Umgangsformen der Internetgeneration sozusagen auf gesellschaftliche Demokratie überträgt. Ich hab ihm gesagt: Dieser Zwangsläufigkeit folge ich nicht. Meine Erfahrung als Politiker spricht eher dagegen, dass ohne Politik und ohne politischen Rahmen die Menschen sich einfach zusammenfinden und geradezu selbstlos nach den jeweils besten Lösungen suchen. Dazu stehen halt häufig genug – ich glaube, das ist fast banal –die Interessen von Menschen oder Menschengruppen oder Branchen oder was immer Sie nehmen im Alltag im Widerspruch zueinander. Und geregelte Formen der Konfliktschlichtung, mindestens das muss Politik anbieten, das geht meistens nicht ohne eine Zielrichtung, in der sich Gesellschaft entwickeln soll. Und dafür ist jedenfalls gewählte Politik auch verantwortlich – Orientierung zu geben, wenn Sie so wollen.
Leggewie: Ich glaube, das Buch lohnt sich gleichwohl, obwohl es so etwas Visionäres hat, zu lesen, weil es im Grunde genommen nicht wie die Märkte oder der rational choice, den uns die Ökonomen immer vorhalten, die rationale Wahl des Nutzenmaximierers, die von einer Wolfsnatur des Menschen ausgeht, wo jeder des anderen Feind ist und nur auf seinen Vorteil bedacht ist, sondern wo eigentlich die Anlagen im Menschen gefördert werden sollen, zum Beispiel durch Bildung, Sozialisation, aber auch Politik...
Steinmeier: Dagegen haben wir ja nichts.
Leggewie: ... die auf Empathie aus sind. Die schöne Übung in unserer Sendung, die damit leider schon so langsam zu Ende geht, ist, dass der Gast auch immer noch ein Buch zur Lektüre empfiehlt, das er oder sie zuletzt gelesen hat. Und das stammt auch von einem Amerikaner mit europäischer, in diesem Fall auch deutscher Affinität, einem großen Kollegen von Ihnen.
Steinmeier: In aller Bescheidenheit. Nein, das ist Absicht, dass es sich um ein drittes amerikanisches Buch handelt. Das hat etwas mit meinem Einleitungssatz zu tun, mit einem schwierigen Verhältnis, das wir in den letzten zehn Jahren mitunter, rund um den Irakkrieg, mit den Amerikanern hatten. Aber es hat viel Kraft und viel Konzentration auf dieses deutsch-amerikanische Verhältnis gekostet. Und manchmal denke ich mir, vielleicht hat die Konzentration darauf dazu geführt, dass wir etwas anderes nicht mit derselben Konzentration beachtet und beobachtet haben. Das ist das, was sich in Ostasien tut. Und deshalb empfehle ich Ihnen dringend zur Lektüre ein wunderbares, faszinierendes Buch von Henry Kissinger: "On China" heißt es.
Leggewie: Vielen Dank, Herr Steinmeier. Das war eine Lesart Spezial von Deutschlandradio Kultur, mit dem wir vom Kulturwissenschaftlichen Institut gemeinsam mit der Buchhandlung Proust diese Sendung produzieren. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag.
Literatur:
Tony Judt "Dem Land geht es schlecht. Ein Traktat über unsere Unzufriedenheit", Hanser 2011
Jeremy Rifkin "Die empathische Zivilisation. Wege zu einem globalen Bewusstsein", Campus 2011

Cover: Tony Judt "Dem Land geht es schlecht. Ein Traktat über unsere Unzufriedenheit".© Hanser Verlag
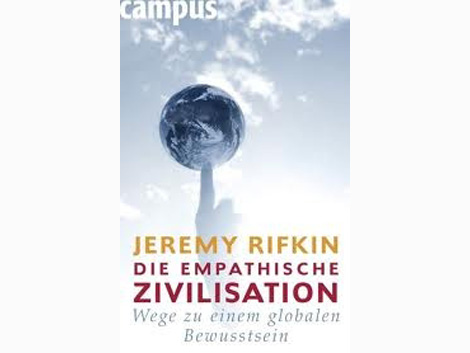
Cover: Jeremy Rifkin "Die empathische Zivilisation. Wege zu einem globalen Bewusstsein.© Campus Verlag
