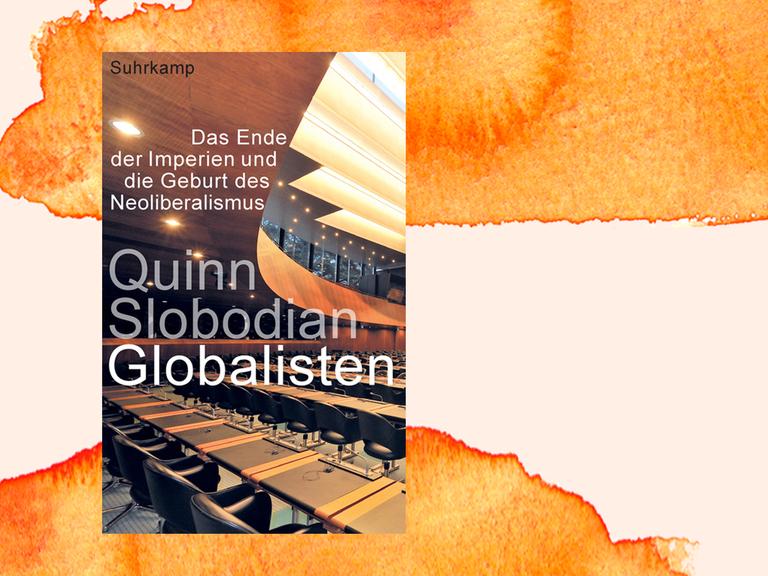Hartz IV, Klimakrise, Börsenspekulation: Werden die aktuellen Auswüchse des Kapitalismus kritisiert, fällt fast immer das Schlagwort "Neoliberalismus". Ein geradezu inflationär gebrauchter Kampfbegriff, dessen genaue Bestimmung meist ausbleibt. Zumal sich heute kaum jemand selbst als "neoliberal" bezeichnet.
Taugt der Begriff also überhaupt zur Kritik, geschweige denn zur sachlichen Analyse unserer Gegenwart? Unbedingt, meint der politische Theoretiker Thomas Biebricher von der Copenhagen Business School: Denn das neoliberale Denken sei in zahlreichen Netzwerken und Think Tanks immer noch weit verbreitet – und berühre nicht nur wirtschaftliche Fragen, sondern auch solche demokratischer Mitbestimmung.
In seinem neuen Buch "Die politische Theorie des Neoliberalismus" beschäftigt sich Biebricher vor allem mit den Ideen neoliberaler Denker zwischen den 1920er- und 1970er-Jahren, die sich zum Teil selbst als "neoliberal" bezeichnet haben: mit deutschen "Ordoliberalen" wie Alexander Rüstow, aber auch dem Österreicher August Friedrich Hayek oder US-Amerikanern wie Milton Friedman, einem Vertreter der sogenannten Chicago School. Heute lebe das neoliberale Denken vor allem in nationalen und internationalen Netzwerken weiter, wie der Mont-Pelerin-Society, dem Kronberger Kreis oder der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft.
So sehr sich die verschiedenen Ansätze im Detail unterscheiden, erkennt Biebricher doch eine Reihe an Gemeinsamkeiten, die ihm zufolge den Kern neoliberalen Denkens ausmachen. Anders als landläufig angenommen, gehe es dabei keineswegs um eine radikale Selbstregulierung des Marktes, ein bloßes "Laissez-Faire", wie es der klassische Liberalismus des 18. und 19. Jahrhunderts vertrat.
"Für die Neoliberalen ist vielmehr klar, dass Märkte von bestimmten Bedingungen abhängen, die sie selbst nicht reproduzieren können", so Biebricher. Diese Bedingungen zu gewährleisten, sei in den Augen der Neoliberalen deshalb Aufgabe des Staates.
Der Staat als gefesselter Schiedsrichter
"Ein Bild, das in allen Varianten des neoliberalen Denkens immer wieder vorkommt, ist das Bild des Staates als Schiedsrichter, der stoisch die Regeln durchsetzt, die es braucht, damit Märkte funktionieren", erklärt Biebricher. Bemerkenswert sei allerdings, dass dabei meist die Frage außer Acht gelassen werde, "wer eigentlich die Regeln macht, die durchgesetzt werden".
Ein anderes geläufiges Bild für die Rolle des Staates sei das des Odysseus, der sich der Sage nach an den Mast seines Schiffes fesseln ließ, um dem Gesang der Sirenen zu lauschen, ohne von ihnen in die Tiefe gelockt zu werden: "Und in ähnlicher Weise glauben alle Neoliberalen, dass der Staat sich in seiner Mächtigkeit selbst binden muss, durch bestimmte Gesetze und Regelordnungen, in denen bestimmte Handlungsweisen festgeschrieben und andere verboten sind. Sei das eine umfassende Wettbewerbsordnung oder einfach nur eine Schuldenbremse."
Auch in diesem Bild erkennt der Politiktheoretiker ein Problem: "Was bedeutet das demokratietheoretisch, wenn man sich Regeln gibt, die dann nicht mehr, von wem auch immer, geändert werden können sollen?"
Neoliberale Demokratieverachtung
Hierin liegt der Kern von Biebrichers Analyse: Das neoliberale Denken, so sein Ergebnis, hat ein mindestens angespanntes Verhältnis zur Demokratie. Dabei würden verschiedene Argumente ins Feld geführt: "Das reicht von klassisch liberal-konservativen Themen, wie die Furcht vor einer Tyrannei der Mehrheit. Dann gibt es technische Argumente, wo gesagt wird: Wenn Sie eine Partei wählen, dann vertritt die immer auch Positionen, die Sie nicht mögen und am Ende kriegt man was, das man gar nicht wollte."
Der politische Theoretiker Thomas Biebricher.© privat / Foto: Paula Winkler
Ein neoliberales Kernargument sieht Biebricher insbesondere in der "Sorge, dass die Masse sich nicht so gut zurechtfindet in wirtschaftspolitischen Zusammenhängen und eher den einfachen Lösungen zuneigt".
Die Konsequenz aus dieser Demokratieskepsis sei "nicht unbedingt, dass man Demokratie abschaffen will, aber doch, den möglicherweise schädlichen Einfluss von demokratischen Institutionen auf wirtschafts- und finanzpolitische Entscheidungen sehr stark einzugrenzen." Sei es durch den Vorrang von Expertenmeinungen vor Mehrheitsentscheiden oder durch die Begrenzung der staatlichen Finanzierungsmöglichkeiten, etwa mittels Schuldenbremsen.
Manch neoliberaler Denker scheute auch nicht vor Zusammenarbeit mit Diktatoren zurück, erwähnt Biebricher in seinem Buch: In den 1970er-Jahren beriet Hayek den chilenischen Militärputschisten Pinochet.
Selbstentmachtung der Politik in der EU-Krise
Eine Umsetzung neoliberaler Ideen erkennt Biebricher insbesondere auf der Ebene der Europäischen Union. Deren "Ordoliberalisierung" zeigt sich für ihn am Umgang mit der Finanz- und Eurokrise nach 2008. "Was sich letztlich durchgesetzt hat, ist eine Deutung der Krise als eine, die in der individuellen Verantwortung der diversen ‚Krisenländer‘ liegt, die vermeintlich über ihre Verhältnisse gelebt haben." Systemische Ursachen für die Krise werden also nicht in Betracht gezogen.
Auch die Reaktion auf die Krise habe "ordoliberalen" Vorstellungen vom Schutz einer Wettbewerbsordnung entsprochen, "die den Zudringlichkeiten demokratischer Institutionen ein Stück weit entzogen sein soll". Das Ergebnis seien umfassende Regelwerke zu Schulden und Steuerpolitik, deren Einhaltung von der demokratisch nur wenig legitimierten EU-Kommission überwacht werde. Deren Empfehlungen zielten meist auf die Einsparung von Sozialausgaben ab. Hinzu komme die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes, der dazu neige, der Wettbewerbsfreiheit einen Vorrang vor Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerrechten einzuräumen.
Die Abtretung von politischen Entscheidungskompetenzen an überstaatliche Institutionen sei also im Interesse des Neoliberalismus, weil dort, Stand jetzt, die demokratische Rechenschaftspflicht nicht stark ausgeprägt sei. "Das darf uns aber nicht zu dem Urteil führen, dass die Supranationalisierung an sich das Problem ist – denn wichtige Probleme wie der Klimawandel können auf Dauer vermutlich nur auf supranationaler Ebene angegangen werden", so Biebricher.
Informierte Kritik statt Dämonisierung
Wie aber umgehen mit den – auch hinsichtlich der Corona-Schulden wiederaufflammenden – neoliberalen Ideen? Biebricher warnt vor einer "Dämonisierung":
"Wenn man immer sagt, Neoliberalismus ist Marktradikalismus, dann macht man es den Neoliberalen eigentlich zu leicht. Denn dann sind alle Vorschläge, die nicht dieser Maximalforderung entsprechen – der Markt soll alles regeln – schon eine Abkehr vom Neoliberalismus." Und die sei noch lange nicht in Sicht.
Thomas Biebricher: "Die politische Theorie des Neoliberalismus"
Suhrkamp-Verlag, Frankfurt a.M. 2021
345 Seiten, 22 Euro