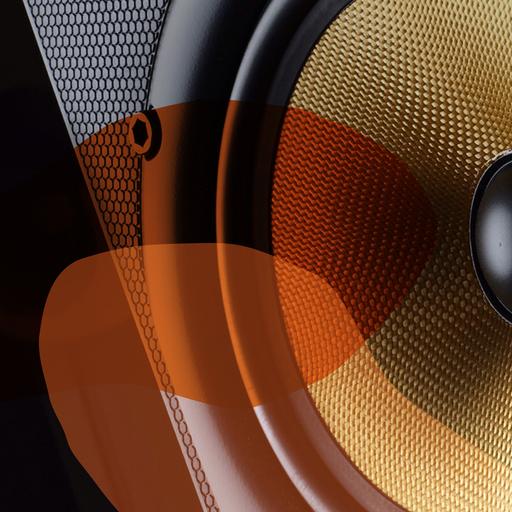Tod von Alexej Nawalny

Für den Autor Simon Strauss ist Alexej Nawalny ein Held wie aus einer anderen Zeit. © picture alliance/dpa/TASS | Moscow City Court Press Service
Kommentar: Ein Heroismus, der aus der Zeit gefallen wirkt

Alexej Nawalny hätte ins Exil gehen können – doch er leistete Widerstand. Sein Tod ist ein Zeichen für den unbeugsamen Willen eines Mannes, der bereit war, alles für seine Überzeugungen zu opfern. Am Ende sogar sich selbst, meint Autor Simon Strauß.
Es war ein sehr früher Morgen im Oktober 2020. Über dem Berliner Schlosspark war die Herbstsonne gerade aufgegangen. Ich war mit einem schlafenden Baby im Kinderwagen allein und setzte mich auf eine Bank. Da näherte sich auf einmal ein Tross von muskulösen Männern, langsam liefen sie auf der breiten Allee in meine Richtung. Richtige Stiernacken waren das, Türsteher-Typen, denen man besser nicht zu lange in die Augen schaut. Aber in ihrer Mitte, abgeschirmt und gestützt, lief ein dürrer, abgemagerter Mann mit gesenktem Kopf. Gerade in dem Moment, als die Gruppe an mir vorbeilief, schaute er kurz auf und sah mir in die Augen – mit einem eindringlichen, fast stechenden Blick.
Es war der dem Tod gerade so eben von der Klinge gesprungene russische Regimekritiker Alexej Nawalny. Jener Mann, der einen tödlichen Giftanschlag nur knapp überlebt hatte und nun ein paar erste Schritte an der frischen Luft machte.
Es war der dem Tod gerade so eben von der Klinge gesprungene russische Regimekritiker Alexej Nawalny. Jener Mann, der einen tödlichen Giftanschlag nur knapp überlebt hatte und nun ein paar erste Schritte an der frischen Luft machte.
Mit jedem Recht hätte sich Nawalny ins Exil begeben können
Ich weiß noch, wie ich damals dachte: ein Held wie aus einer anderen Zeit. Einer, der Opfer bringt, Widerstand leistet. Der unter größter Gefährdung seines eigenen Lebens für die gerechte Sache kämpft. Wie gut, dachte ich damals, dass er nun in Sicherheit ist. Hier bei uns in Europa – dem radikalen Gegenort zu Putins Russland. Nie hätte ich gedacht, dass dieser Mann freiwillig in die Hand seiner Mörder zurückkehren würde.
Nawalny hätte sich mit jedem Recht ins Exil begeben können, wäre eine einflussreiche, regimekritische Stimme geblieben, aus sicherer Entfernung, im Kreis seiner Familie und Unterstützer. So denkt man sich das aus einem Europa des 21. Jahrhunderts heraus. Dass ein Mensch zur selben Zeit noch immer in den alten Kategorien von Stolz und Mut, Vaterlandsliebe und Opferbereitschaft denkt, können wir uns hier, in unserer abgeklärt-aufgeklärten Gesellschaft nur schwer vorstellen. Als „postheroisch“ hat der Politikwissenschaftler Herfried Münkler unsere Zeit beschrieben. Und damit einen erleichternden Strich unter die blutige Rechnung der Gewaltgeschichte vergangener Jahrhunderte gezogen. Allerdings hat er damit auch die Idealvorstellung von politischem Heroismus ganz generell durchgestrichen.
Spätestens jetzt, mit dem Tod, nein, sagen wir lieber direkter: mit der Ermordung von Alexej Nawalny im Straflager „Polarwolf“, wird dieser Strich zweifelhaft. Denn der Mord an Nawalny ist auch als Zeichen zu lesen. Einerseits steht er für die fassungslos machende Stärke des russischen Machthabers, der sich alles Unrecht erlauben zu können scheint, ohne dass sein Volk aufbegehrt. Der mit seinem autokratisch-diktatorischen Stil offenbar gerade auf ganzer Linie siegt, unbeeindruckt vom diplomatischen westlichen Widerstand.
Nawalny wollte Freiheit für sein Land
Andererseits aber ist der ermordete Nawalny auch ein Zeichen für den unbeugsamen Willen eines Menschen, der bereit war, alles für seine Überzeugungen zu opfern. Am Ende sogar sich selbst. Ein Zeichen für etwas, das höher reicht als unsere Vernunft. Nawalny wollte keine Sicherheit. Er wollte Freiheit. Freiheit für sein Land. Für seine Gedanken. Er wollte Widerstand leisten. Nicht nur durch Interviews und Auftritte bei Friedensgalas, sondern durch die physische Präsenz seines Körpers. Vielleicht kann man sagen: Er wollte der Welt das brutale Unrecht in seiner Heimat aufzeigen, indem er es quasi stellvertretend für sie erlitt.
Wenn ich in diesen Tagen an meinen kurzen Blickkontakt mit Nawalny zurückdenke, damals im herbstlichen Schlosspark, dann fällt mir ein Satz von Pier Paolo Pasolini aus einem Interview 1973 ein: „Ich würde lieber zu Unrecht verurteilt als toleriert.“ Lieber zu Unrecht verurteilt als toleriert… Heute ist mir, als wollte Nawalnys stechender Blick damals genau das sagen.