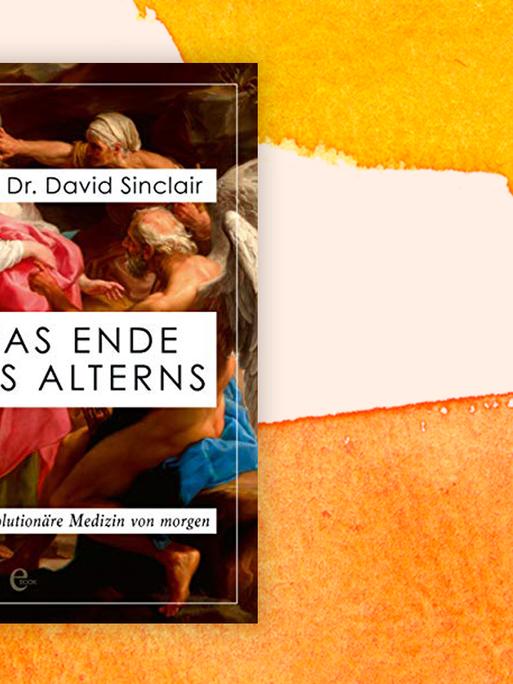Regie: Beatrix Ackers
Sprecherinnen: Frauke Poolmann und die Autorin
Ton: Andreas Krause
Redaktion: Jana Wuttke
Ist der Tod berechenbar?
27:17 Minuten

Wissenschaftler arbeiten an einer genaueren Berechnung des Sterberisikos: Könnte ein derartiger Test die Arbeit von Ärzten unterstützen, etwa in der Palliativmedizin? Hätten Menschen mit schweren Erkrankungen, wie etwa ALS, einen Nutzen davon?
Lukas Radbruch redet jeden Tag mit Menschen über ein Thema, das selbst in der Medizin nicht gerne besprochen wird: Das Sterben.
"Ich glaube", sagt er, "dass in vielen Bereichen, also in Pflegeeinrichtungen generell, in vielen Krankenhausabteilungen dieses Thema komplett ausgeblendet wird. Das eine ist, dass man schon auch als Arzt immer noch so ein bisschen sozialisiert ist, dass wenn ein Patient stirbt, ist das auch immer irgendwie Versagen."
Für Lukas Radbruch ist der Tod alltäglich. Er arbeitet am Malteser Krankenhaus und am Universitätsklinikum in Bonn als leitender Palliativmediziner: "Wir sind Sterbehelfer. Aber wir helfen halt beim Sterben und nicht zum Sterben."
Die Sterbenden sollen sich wohlfühlen
"Wir gehen mal runter auf die Station und ich hoffe", sagt Lukas Radbruch. "dass Sie da auch nicht sagen, dass es wie Krankenhaus aussieht. Das wäre die Idee."

Patientenzimmer einer Palliativstation: Hier gibt es immer auch einen Tisch, einen Stuhl, sagt Lukas Radbruch.© picture alliance / dpa / Uwe Zucchi
Auf der Palliativstation des Malteser-Krankenhauses in Bonn kann man leicht vergessen, dass man in einem Krankenhaus ist. Es gibt gerade einmal sechs Zimmer. Für acht Patienten. Früher hat Lukas Radbruch vor allem Krebspatienten betreut. Mittlerweile sind es auch immer mehr Menschen mit neurologischen Erkrankungen, wie beispielsweise Alzheimer.
"Wir haben also nicht nur hier im Flur zwischen den Zimmern, sondern auch in jedem Zimmer noch irgendwo einen Schrank, einen Tisch, einen Stuhl", sagt Lukas Radbruch. "Irgendetwas was nicht wie Krankenhausmöbel aussieht."
Selbst der typische Krankenhaus-Geruch nach Desinfektionsmittel liegt nur schwach in der Luft. Die Sterbenden sollen sich in jeder Hinsicht wohlfühlen, soweit das möglich ist. Daran wird ständig weiter gearbeitet.
"Da haben wir mit der Klinikleitung vereinbaren können, dass wir den Innenhof ausbauen können zu einem Palliativ-Garten", sagt der Mediziner. "Und auch ganz bewusst nicht abgegrenzt nach außen, also kein Ghetto für Sterbende, sondern da ist ein Kinderspielplatz am Rand."
Es ist nicht leicht, den Tod zu akzeptieren
Den Tod zu akzeptieren, ihn zu normalisieren - damit tun wir uns schwer. Dabei gehört es zur medizinischen Realität, dass es für manche Patienten vernünftiger ist, eine Therapie oder Behandlung einzustellen und sich auf das Sterben vorzubereiten.
"Wir überlegen immer wieder, ob sich eine Therapie noch lohnt, wobei es nicht ums Geld unbedingt geht. Sondern um Zeit und Energie und eben um die Bürde, die wir damit Patienten noch auftun mit Nebenwirkungen der Behandlung", sagt Lukas Radbruch.
Um bei so einer Entscheidung helfen zu können, muss der Palliativmediziner immer wissen: Wie viel Lebenszeit bleibt dem Patienten realistisch noch?
"Manchmal ist es für uns die beste Lösung", sagt Lukas Radbruch, "wenn wir einfach die Frage umdrehen und denken: 'Würde es uns wirklich sehr überraschen, wenn dieser Mensch in den nächsten vier Wochen, im nächsten Jahr oder was immer der Zeitraum ist, um den es geht, verstirbt?'."
Sich auf das Bauchgefühl zu verlassen und die Erfahrung mit einzubeziehen reicht oft nicht aus. Denn Ärzte sind meist zu optimistisch. Studien zeigen, dass sie die Lebenserwartung ihres Patienten immer besser einschätzen, als sie tatsächlich ist. Es gibt nur Behelfslösungen.
"Harte Kriterien gibt es nicht", sagt der Palliativmediziner. "Es gibt Scores, wie in der Intensivmedizin, wo man bestimmte Symptome, vielleicht sogar Blutwerte und ähnliche Dinge zusammennimmt. Die sind für Studien gut, aber für den einzelnen Menschen, für den wir das überlegen, nützt das gar nichts, weil da diese Einschätzungen oft himmelweit daneben liegen."
Schätzung der verbleibenden Lebensdauer
Das wollen internationale Forschungsteams nun ändern, um die Schätzung der Lebenserwartung auch für einzelne Menschen präziser zu machen.
"Immer, wenn etwas mit dem Gewebe nicht stimmt und es beschädigt ist, dann kann man das Resultat im Blut sehen", sagt Eline Slagboom. "Das bedeutet, im Blut kann man einen Indikator für die Gesundheit des Individuums finden."
Die Antworten zur verbleibenden Lebensdauer stecken also im Blut - daran glaubt zumindest die niederländische Biologin Eline Slagboom von der Universität in Leiden. Zusammen mit ihrem Team, darunter auch Kollegen vom Max-Planck-Institut für die Biologie des Alterns. Mit ihnen hat die Altersforscherin auffällige Biomarker im Blut gefunden.
Normalerweise können Wissenschaftler an solchen Biomarkern bestimmte Störungen und Krankheiten im Körper analysieren. Mit den 14 Biomarkern, die Eline Slagboom gefunden hat, lässt sich nun bestimmen, bei wem das Sterberisiko in den kommenden fünf bis zehn Jahren hoch ist.
"Wir nennen es noch nicht Test, es ist eine Messtechnik", erklärt Eline Slagboom. "So etwas wird erst ein Test, wenn man wirklich das individuelle Risiko eines einzigen Individuums genau bestimmen kann. Das ist jetzt noch nicht möglich."
14 Faktoren zur Bestimmung des Sterberisikos
Untersucht wurde das Blut von rund 44.000 Menschen - im Alter zwischen 18 und 109 Jahren. Die bis jetzt größte Untersuchung ihrer Art. 14 Faktoren sollen helfen, das Sterberisiko präziser vorherzusagen als bisher. Diese Faktoren ergeben sich unter anderem aus verschiedenen Aminosäuren - den Bausteinen der Eiweiße im Körper -, dem Gehalt an "gutem" und "schlechtem" Cholesterin, Entzündungswerten und dem Fettsäurehaushalt.
Angezeigt werden Wahrscheinlichkeiten. Allerdings können die Altersforscher das Risiko nur für den Augenblick der Blutabnahme berechnen.
"Also wenn die Menschen bis jetzt nicht wirklich gesund gelebt haben oder viel Stress hatten oder keinen Sport gemacht haben oder Gemüse gegessen haben, dann können wir das in diesem Moment im Blut ablesen", sagt die Biologin. "Aber wenn ab diesem Moment die Personen seine Gesundheit steigern würden, indem sie mehr Sport machen, gesünder leben, weniger Stress haben, dann wird die Berechnung des Risikos ungenau, weil sie ihr Sterberisiko verringert haben."

Blutprobe in einem Labor: Das Sterberisiko kann nur für den Augenblick der Blutabnahme berechnet werden.© imago images / Westend61 / Andrew Brookes
Die Messungen der 14 Faktoren wertet ein Algorithmus aus. Seine Treffsicherheit liegt bei 83 Prozent. Das bedeutet aber auch, dass er in 17 Prozent der Fälle noch falsch liegt. Deshalb brauche es auch noch gut fünf Jahre bis so ein Bluttest auf den Markt kommt. Aber die Genauigkeit der Messung und Vorhersage ist nicht das einzige Problem, das bei dieser neuen Methode bleibt.
Rechtliche, ethische und praktische Fragen
"Wie wollen wir es konkret in den klinischen Alltag unterbringen? Wie gehen wir mit dem Recht auf Nicht-Wissen von Patienten um? Wie können wir verhindern, dass solche Daten für andere Zwecke gebraucht werden", fragt die Neurologin und Palliativmedizinerin Annette Rogge. Sie ist Vorsitzende und Geschäftsführerin des Klinischen Ethikkomitees am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein.
Und sie gibt bei den datengetriebenen Sterberisiko-Analysen zu bedenken: "Vor einer Einführung in die klinische Routine sollte man eine gesellschaftliche Debatte darüber führen und auch überlegen, unter welchen juristischen Regularien und unter welchen Bedingungen es sinnvoll ist, solche Algorithmen tatsächlich in klinische Entscheidungsfindung mit einfließen zu lassen."
Denn worauf sich Ärzte vielleicht manchmal zu viel verlassen - auf ihr Bauchgefühl und die Erfahrung - beziehen Algorithmen bei ihrer Einschätzung gar nicht mit ein. Eline Slagboom hat aber auch schon andere Pläne im Sinn. Ist der Bluttest fertig entwickelt, soll er nicht nur in der Klinik eingesetzt werden, sondern auch für jedermann anwendbar sein. Zu Hause. Als Selbsttest. Wie hoch ist mein Sterberisiko heute?
"Ich würde niemals Menschen ohne Anleitung ausstatten", sagt Eline Slagboom. "Aber wenn man einen Test anbieten könnte mit der Aussage 'Mit deinem Profil könntest du deine Lebensspanne verlängern, wenn du deinen Lebensstil ändern würdest und mehr Proteine zu dir nehmen würdest, weil deine Muskeln schwach werden'. Dann hätte man eine personalisierte Lebensstilverbesserung."
Eine neue Stufe der Selbstoptimierung
Selbstoptimierung auf dem nächsten Level: Das eigene Sterberisiko wird zu einer Variablen, die man vermeintlich selbst beeinflussen kann. Die Unveränderlichkeit des Todes soll durch die sorgfältige Verwaltung des Körpers und die rechnerische Planung des Lebens kalkulierbar werden.
Das ist auch ein zutiefst ökonomisches Prinzip, bei dem Freiheit und Zwang zur Optimierung eng beieinander liegen.
Im Idealfall lässt sich der eigene Lebensstil steuern, das Leben dadurch verbessern und verlängern – durch die üblichen Verdächtigen wie gesunde Ernährung und Lebensstil, Sport und so weiter. Vielleicht könnte der Bluttest von Eline Slagboom und ihren Kollegen da wirklich helfen.
Doch der Palliativmediziner Lukas Radbruch ist skeptisch: "Ein interessanter Ansatz ist es schon, aber auch da wird es so sein, dass das einen statistischen Bereich angibt, der enorme Spannbreiten zulässt. Also für den einzelnen Menschen wird es noch immer so sein, dass er eine bestimmte Angabe kriegt, aber nicht weiß, was er damit anfängt. Ob das dann hilfreich ist, für mich zu wissen, bei mir ist es etwas kürzer, als bei anderen Menschen, weiß ich nicht."
Leben an sich bleibt unberechenbar
Aber selbst wenn Ärzte unsere Lebensdauer für den Moment messen und optimieren können – das Leben an sich bleibt unberechenbar.
"Die erste Ärztin, die diesen Verdacht äußerte, war eine Kinderärztin", sagt Wolfgang Bach. Sein Nachname ist geändert, ihm laufen Tränen über das Gesicht. Das Sprechen fällt ihm schwer, nicht nur wegen der künstlichen Beatmung. Er ist heute 70 und hat amyotrophe Lateralsklerose, kurz ALS.
Diese unheilbare Krankheit schädigt die sogenannten Motoneuronen. Die geben normalerweise Impulse vom Gehirn an die Muskeln weiter. Werden die aber nicht mehr aktiviert, werden sie so schwach, dass sie irgendwann ganz aufhören zu funktionieren.
"Den ersten Verdacht hatte unsere Tochter, die Kinderärztin ist, aufgrund meiner Schilderung. Wir haben dann lange gebraucht bis wir einen Neurologen gefunden haben, der uns ernst genommen hat", erzählt seine Frau Sylvia Bach. Die beiden wissen seit gut eineinhalb Jahren von Wolfgangs Krankheit - und der damit verbundenen Lebenserwartung.
ALS begrenzt die Lebenserwartung deutlich
"2014 waren wir auf einem Tanzfest und mein Mann konnte nicht mehr tanzen", erzählt Sylvia Bach, "also er konnte den Walzer-Takt nicht mehr halten, er konnte keinen Foxtrott mehr tanzen. Und da haben wir uns erst mal gar nichts bei gedacht."
Die Fußheberschwäche hielten die Ärzte erst für ein Symptom eines Bandscheibenvorfalls. Dann wurde er operiert. Seine Ohnmachtsanfälle interpretierten die Ärzte dann als Anzeichen für eine Herzschwäche. Die nächste OP. Zwei Jahre und viele Behandlungen später, dann die Gewissheit: Wolfgang hat ALS - und die Krankheit wird sein Leben verkürzen.
Ganz ähnlich erging es auch Friederike Kolster: "Ich habe beim ganz schnellen Gehen etwas gehört, was mit dem Fachwort Peroneus-Klatschen zu beschreiben ist. Das ist ein bestimmtes Gangbild, was macht, dass man hört, dass der eine Fuß so komisch aufklatscht, weil er nicht mehr richtig gehalten werden kann beim schnellen Laufen."
Auch bei Friederike Kolster dauerte es mehrere Jahre, bis die Ärzte schließlich ALS bei ihr erkannten: "Das Schlimme war, ein Versuchsballon von den Ärzten zu sein."
Jährlich erkranken gerade einmal ein bis zwei von 100.000 Menschen an ALS. Typischerweise meistens zwischen dem 55. und dem 75. Lebensjahr, Frauen häufiger als Männer. Nach den vielen Versuchen der Ärzte war also die Diagnose "amyotrophe Lateralsklerose" erst einmal eine Erleichterung. Auch für Wolfgang Bach. Doch sie bedeutet eben auch, dass die Lebenserwartung deutlich begrenzt ist.

Ein ALS-Patient schreibt mit seinen Augen auf einem Computer: Am Ende der Krankheit wartet keine Besserung mehr, sondern nur der Tod.© picture alliance / dpa / Klaus-Dietmar Gabbert
Carina Fron: "Hat der Arzt denn damals mit ihnen darüber gesprochen, wie viele Jahre ihr Mann wahrscheinlich noch hat?"
Sylvia Bach: "Also über Jahre wurde nie gesprochen. Das traut sich eigentlich auch niemand. Es gibt einen Mittelwert: Nach der Diagnose - ungefähr - kann es sein, noch drei bis fünf Jahre in dem Alter, in dem mein Mann ALS bekommen hat."
Wolfgang Bach: "Ich hatte mal so eine Planung von 95 Jahren gehabt und es ist mir jetzt klar, dass, wenn ich 72 werde, ich schon zufrieden sein kann."
Länger leben als nach der Diagnose erwartet
So dachten auch Friederike Kolster und ihre Lebensgefährtin. Sangha Schnee erinnert sich, welche Auswirkungen Friederikes Diagnose auf die beiden hatte.
"Das hat uns ziemlich durcheinander gewirbelt", erinnert sich Sangha Schnee, "und hat auch, ich sag mal, zu einigen Kurzschlussreaktionen geführt. Stichwort Lebensversicherung kündigen, um die drei Kröten noch auf den Kopf hauen können, um eine Reise zu machen."
Friederike Kolster bekam ihre ALS-Diagnose mit 38. Die Ärzte gaben ihr damals noch ein bis maximal fünf Jahre. Doch sie lebt bereits seit 19 Jahren mit ALS. Heute ist sie 57 Jahre alt.
Carina: "19 Jahre, Sie haben quasi eigentlich alle Erwartungen gesprengt, die man an Sie beziehungsweise an die Erkrankung hatte. Sehen Sie das als Segen oder ist das manchmal auch ein bisschen Fluch?"
Friederike Kolster: "Es ist deshalb ein Segen, weil ich noch lebendig bin und das was ich vielleicht nicht als Fluch bezeichnen würde, aber was schwierig ist, ist: Wenn ich von Anfang an gewusst hätte, dass ich so lange lebe, hätte ich etliche Entscheidungen anders getroffen."
Die heute 57-Jährige wäre zum Beispiel gerne noch mal aufs Land gezogen, als sie noch laufen konnte. Die Diagnose, das vermeintliche Wissen um die verbleibende Zeit hat ihre Entscheidungen beeinflusst. Sogar ihr Umfeld, Freunde und Familie, schien sich auf viel weniger Zeit mit Friederike Kolster eingestellt zu haben.
"Bin einfach nicht schnell genug gestorben"
Bei einigen Menschen hat sie sogar das Gefühl, dass sie die Geduld mit ihr verloren haben: "Dass sie sich darauf eingestellt haben, auch gerade weil ALS eben normalerweise diese kurze Lebensprognose hat, naja, ok, das halten wir jetzt fünf oder zehn Jahre aus. Jetzt bin ich schon 19 Jahre erkrankt. Manchmal denke ich dann dieses: Ok, ich bin einfach nicht schnell genug gestorben."
Friederike Kolster kann ihren Kopf, die Unterarme und Hände noch eingeschränkt bewegen und damit auch ihren elektrischen Rollstuhl alleine nach draußen steuern.
"Eine der Sachen, warum ich eine relativ hohe Lebensqualität habe ist", sagt sie, "weil ich weiter berufstätig sein kann, weil ich weiter im Freundeskreis angebunden bin, weil ich weiter mit meiner Freundin zusammenleben kann und weil ich sehr selbstbestimmt sein kann, in dem Rahmen, der da ist."
Wolfgang Bach lebt mittlerweile im Heim, seine Frau besucht ihn fast jeden Tag und macht kleine Ausflüge mit ihm. Der ehemalige Diplom-Ingenieur kann nur noch die Augen und den linken Daumen bewegen: "Ein Maßstab, ob die Krankheit weiter fortgeschritten ist oder nicht."
Den beiden ALS-Patienten ist klar, dass am Ende der Krankheit keine Besserung mehr wartet, sondern nur der Tod. Angst haben beide nicht davor. Das Schlucken wird ihnen immer schwerer fallen, auch der letzte Muskel im Körper wird verkümmern und ohne künstliche Beatmung können sie nicht überleben. Gewollt hat Wolfgang Bach die erst nicht.
"Ich habe meine Meinung geändert"
"Weil ich davor Angst hatte", sagt er, "und auch dachte, dass es mit dem Luftröhrenschnitt kein lebenswertes Leben mehr ist. Und ich habe meine Meinung, wie sie ja sehen, geändert."
Wolfgang Bach ist zwar auf Beatmung angewiesen, aber er konnte dadurch sein Leben verlängern. Er hat noch etwas mehr Zeit mit seiner Frau bekommen. Seine Vorstellung von einem lebenswerten Leben hat sich verändert, er kann mehr aushalten, als er früher gedacht hätte. Auch bei Friederike Kolster ist die Erkrankung so weit fortgeschritten, dass sie nachts beatmet werden muss.
Sie möchte sich für den Rest ihres Lebens trotzdem alles offen lassen, möglichst selbstbestimmt später entscheiden, wie ihr Leben endet: "Also das, was ich nicht gerne möchte ist, ewig lange zu liegen und sehr unglücklich zu sein und auch nicht kommunizieren zu können, das ist auch eine der Sachen, die ich in die Patientenverfügung geschrieben habe, dass großer Wert darauf gelegt wird, dass man immer mit mir kommuniziert und da immer versucht wird, meinen Willen wirklich festzustellen."
Prognosen für Koma-Patienten
Wenn der Patient seinen Willen nicht mehr äußern kann, weil er zum Beispiel im Koma liegt, kann ein Arzt nur noch mit den Angehörigen versuchen, herauszufinden, ob die lebenserhaltenden Maßnahmen gestoppt werden sollen oder nicht.
Auch hierfür muss dann ein Arzt eine Prognose geben können. Für Koma-Patienten nach einem Herzinfarkt könnte zukünftig Technologie bei der Prognoseerstellung helfen. Zumindest wenn es nach Frédérik Zubler geht. Er ist Neurologe am Universitätsklinikum 'Inselspital' in Bern.
"Es gibt feste Kriterien und für diese Fälle ist es klar", sagt Frédérik Zubler. "Also wenn sich jemand nach drei Tagen überhaupt nicht bewegt und das Enzephalogramm komplett flach ist. Das reicht schon. Wenn der Patient sich erholt und sitzt nach drei Tagen am Bettrand, dann ist es auch klar. Das Problem ist diese enorme Grauzone in der Mitte."
Für diese Grauzone hat das Team um Frédérik Zubler eine künstliche Intelligenz trainiert, mit Aufnahmen von Gehirnströmen von rund 300 Koma-Patienten nach einem Herzinfarkt. Das sind sogenannte Elektroenzephalogramme, kurz EEGs, die auch ein großer Bestandteil der Prognosen für die Neurologen sind.
"Das sind sehr komplizierte Signale", erklärt der Neurologe. "Also stellen Sie sich vor, wir haben 19 Elektroden, das heißt 19 Kurven, die sich bewegen. Und mit meinen Augen kann ich sagen, es gibt eine Asymmetrie zwischen links und rechts oder ja, das ist flach. Aber vielleicht gibt es Eigenschaften von diesen Kurven, die ich mit meinen menschlichen Augen nicht erkenne."
Ein neuronales Netz ist kein Neurologe
Das neuronale Netz soll dann aus diesen komplizierten Kurven selbstständig lernen, ob es eine Prognose erstellen kann. Um die Ergebnisse des maschinellen Lernens zu überprüfen, haben die Forscher sie mit den Prognosen der Ärzte verglichen. Jeden Fehler, den die Software gemacht hat, konnten die Forscher erklären.
"Es gibt zum Beispiel Muster im EEG, die sehr selten sind in der Frühphase vom Koma nach Herzstillstand und davon hat er einfach zu wenige gehabt und konnte die nicht lernen", sagt Frédérik Zubler. "Da ist natürlich auch der Unterschied zum Neurologen. Der weiß alles, was er auch schon in anderen Kontexten gelernt hat und fängt nicht von Null an."
Auch wenn der Neurologe die Künstliche Intelligenz nicht ganz alleine über Leben und Tod entscheiden lassen würde, ist er dennoch begeistert von den guten Ergebnissen. Rund 8 von 10 Fällen hat die KI richtig identifiziert. Frédérik Zubler glaubt daran, dass sie bald auch in den Alltag der Klinik einzieht und dort auch dringend gebraucht wird. Um die Lebenserwartung von Menschen besser einschätzen zu können.
"Ich bin wirklich konfrontiert mit den Grenzen, was wir kennen", sagt der Neurologe. "Wenn wir einen perfekten Job machen würden, dann würden wir das nicht brauchen."
Die Hoffnungen, die mit dem Einsatz von Technologie verknüpft sind, kann Medienwissenschaftler Roberto Simanowski durchaus nachvollziehen: "Ich denke, die Algorithmen sind schon zuverlässiger. Die ermüden ja nicht. Und die können viel schneller viel mehr Daten verarbeiten."

Algorithmen in der Medizin: Technologien beeinflussen, wie wir unser Leben gestalten, warnt Roberto Simanowski.© imago / Jochen Tack
Immerhin hätten Studien in der Vergangenheit gezeigt, dass zum Beispiel Algorithmen Röntgenbilder zuverlässiger und schneller auslesen können als Radiologen. Ihr Urteil sollte man nie außen vor lassen, meint Roberto Simanowski.
Warnung vor Bedeutung der Algorithmen
Doch er warnt auch vor dem wachsenden Einfluss der Algorithmen. "Wir formen zwar unsere Werkzeuge, aber dann beeinflussen diese Werkzeuge, wie wir leben oder diese Technologien beeinflussen, wie wir unser Leben gestalten. Und wir können uns dem kaum noch entziehen."
Vor allem ist die medizinische Versorgung noch nicht darauf vorbereitet. Ein Negativbeispiel war der "Liverpool Care Pathway for the Dying" in Großbritannien. Dieser Behandlungsansatz aus den 90ern sollte Ärzten eine Prognose erleichtern. Sie überprüften: Kann der Patient essen oder trinken, ist er bei Bewusstsein und kann er noch Medikamente schlucken? Trafen zwei von drei nicht zu, wurde der Patient auf die Palliativstation verlegt. Rasant stieg die Zahl der Patienten dort an.
Gleichzeitig behandelte das Krankenhauspersonal die Patienten nur noch halbherzig, gab ihnen nicht mehr die Aufmerksamkeit und Medikamente, die sie brauchten. Vor einigen Jahren wurde der "Liverpool Care Pathway for the Dying" deshalb wieder abgeschafft. Feste, allgemeine Kriterien machen die Einzelfallentscheidungen auf der Palliativstation nicht automatisch besser, findet Lukas Radbruch.
"Wenn es einfach wäre, könnte es jeder", sagt er. "Es ist komplex, ja. Und ich glaube, für mich wäre es auch wichtig, dass wir hier nicht nach Checklisten arbeiten. Also dass wir nur einen Score ausrechnen und nur danach Entscheidungen fällen, sondern immer den einzelnen Menschen vor uns sehen."
"Ich bin jetzt mehr im Moment"
Das wünschen sich auch die ALS-Patienten Friederike Kolster und Wolfgang Bach. Garantien gibt es für sie nicht, von keinem Arzt und keinem Algorithmus. Ihnen bleibt nur, von Tag zu Tag zu leben.
Carina Fron: "Und wie ist das bei Ihnen? Haben Sie das Gefühl, dass sie anders über das Leben nachdenken?"
Friederike Kolster: "Ich finde schon. Was sich auch bei mir besonders geändert hat ist dieses 'ich werde dann und dann zufrieden sein, wenn ich das und das gemacht haben werde.', sondern dass ich viel mehr jetzt im Moment bin."