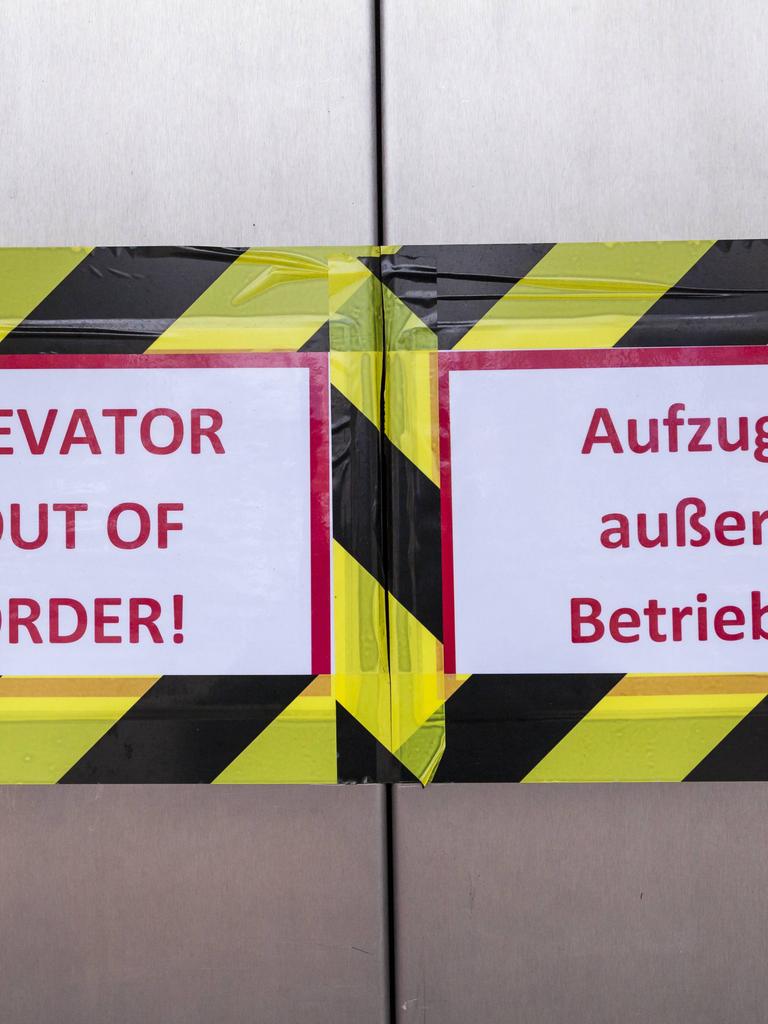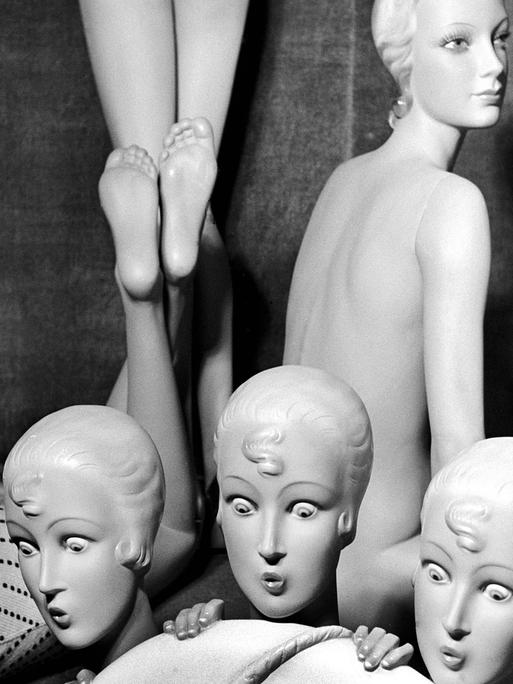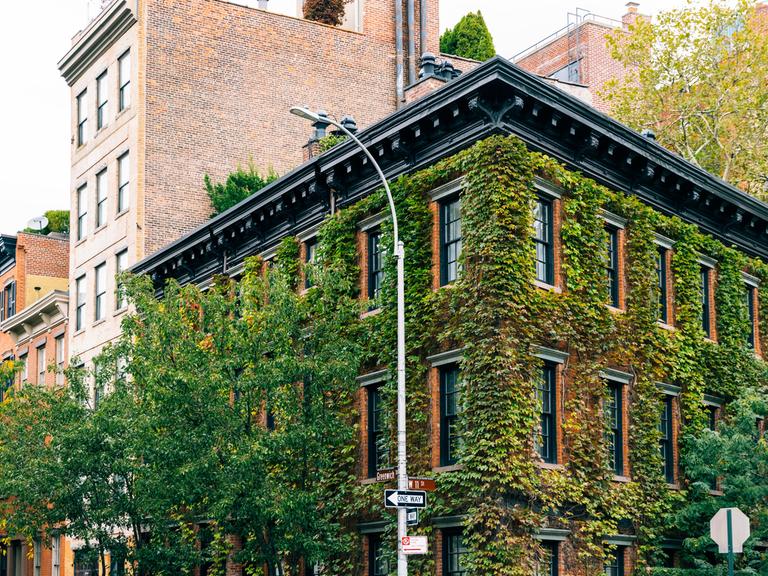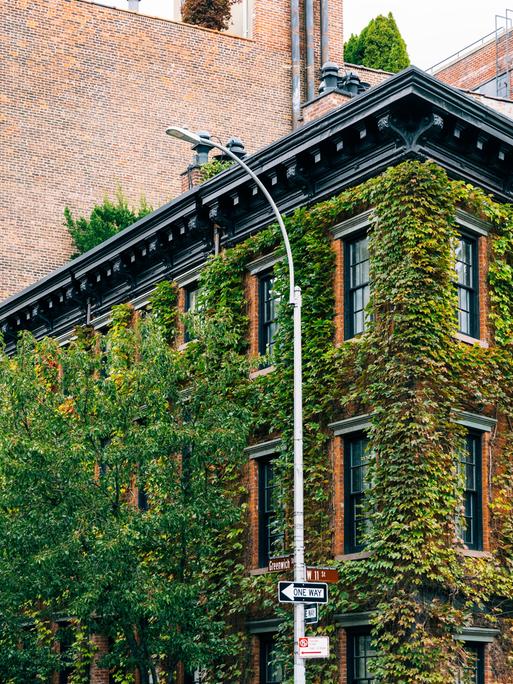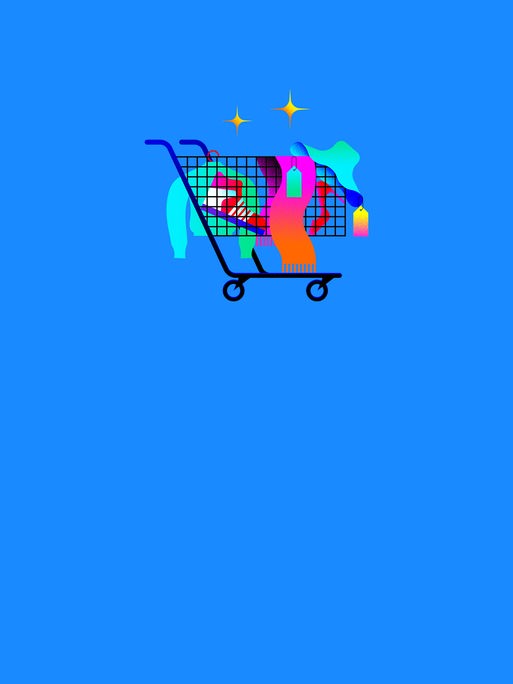Kommentar
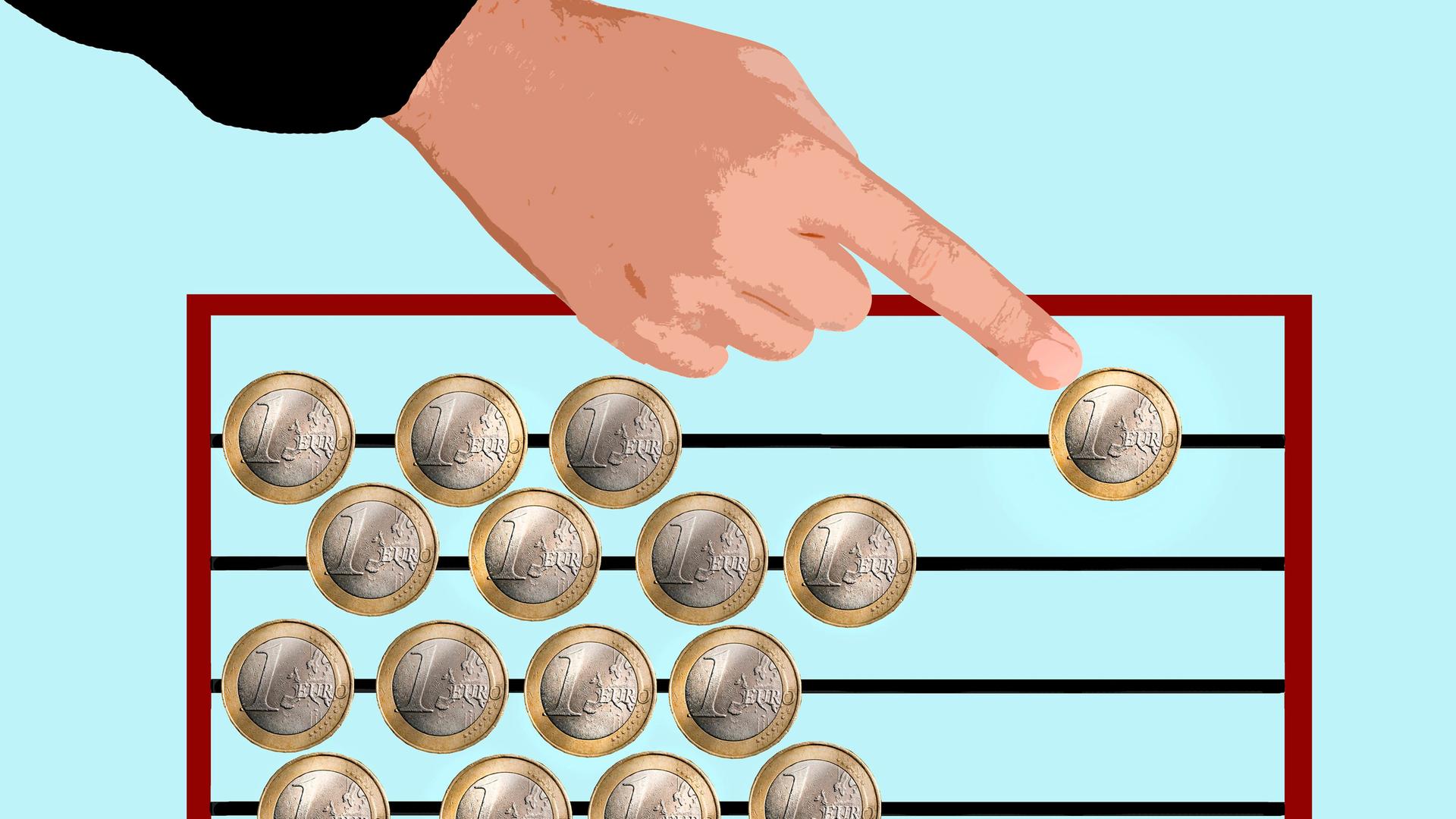
In Deutschland wächst die Schere zwischen Arm und Reich: Die reichsten fünf Prozent besitzen mittlerweile ganze 48 Prozent des Vermögens, während die gesamte ärmere Hälfte der Bevölkerung nahezu leer ausgeht. © IMAGO / Westend61 / IMAGO / Gary Waters
Wohlstand durch mehr Arbeit: ein leeres Versprechen
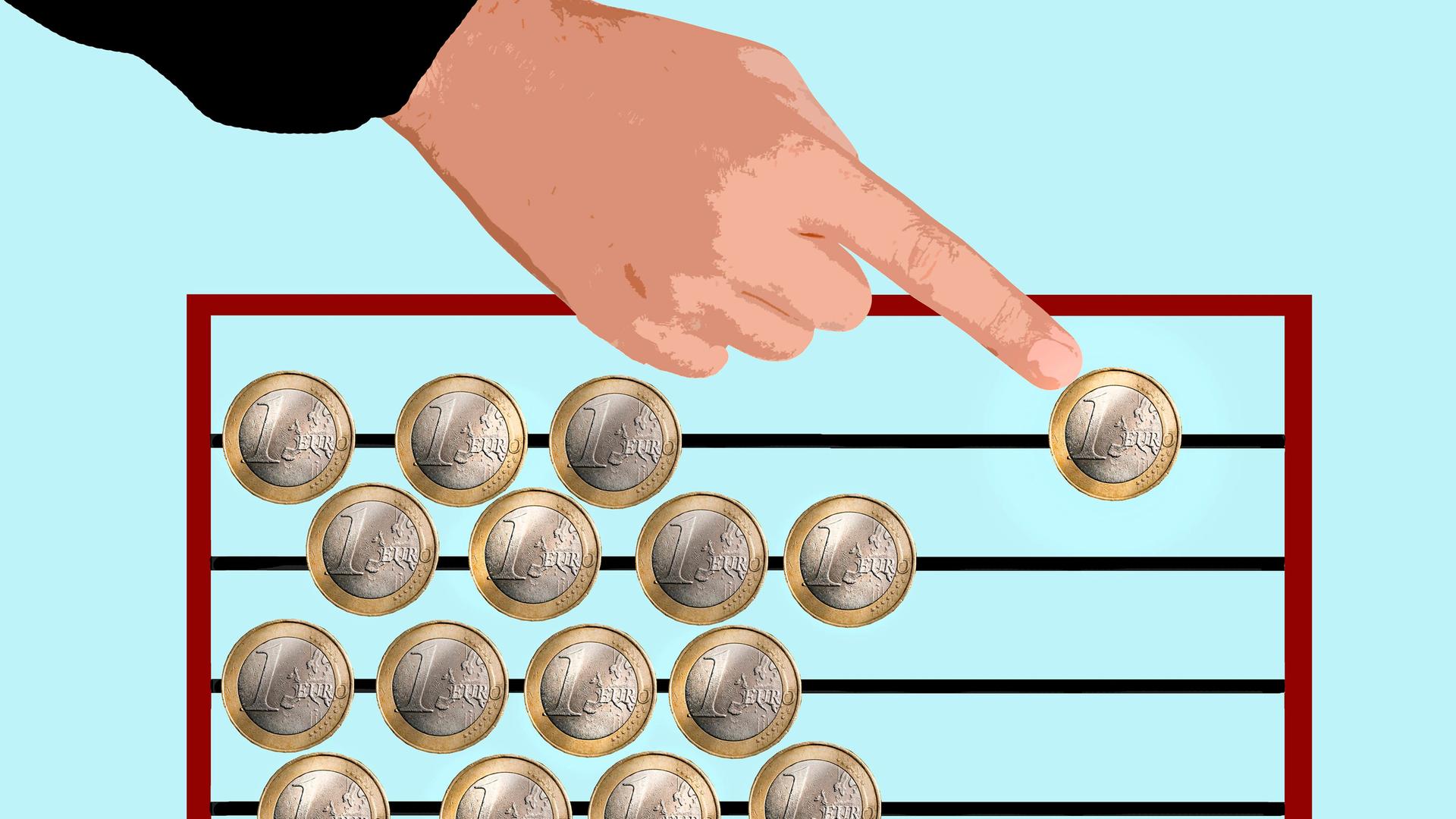
Friedrich Merz fordert mehr Einsatz für die Wirtschaft – doch viele Menschen arbeiten längst am Limit. Trotz gestiegener Beschäftigung wächst in Deutschland die soziale Ungleichheit. Anstatt auf Leistung zu setzen, braucht es einen Paradigmenwechsel.
Wenn Bundeskanzler Friedrich Merz behauptet, „Leistung muss sich wieder lohnen“, dreht sich mir der Magen um. Das Leistungsversprechen ist vielen in meiner Generation inzwischen höchst suspekt. Ich kenne immer mehr Menschen, die ausgebrannt sind oder nach einer 60-Stunden-Arbeitswoche und vor lauter mental Overload kaum noch Zeit für Verabredungen haben.
Trotzdem fordert Merz in seiner Regierungserklärung die Deutschen dazu auf, endlich wieder mehr zum Wohle der Nation zu arbeiten und somit das Wirtschaftswachstum anzukurbeln. Er kritisiert Bestrebungen nach einer Vier-Tage-Woche und den Wunsch nach mehr Work-Life-Balance. Merz löst damit eine kontroverse Debatte über Arbeitszeiten aus.
Dabei weisen Wirtschaftsexperten darauf hin, dass in Deutschland mehr Menschen als je zuvor arbeiten: Derzeit sind knapp 46 Millionen Menschen erwerbstätig, Ökonomen zufolge ist damit ein Rekordhoch erreicht. Doch sie hinterfragen auch die Annahme, dass mehr Arbeit automatisch zu mehr Wohlstand führt. Denn diese Vorstellung trifft in Deutschland längst nicht mehr ohne Weiteres zu.
Die „Working Class“ von heute: viel Arbeit, wenig Vermögen
Ohne Zweifel hat Wirtschaftswachstum die Grundlage für ein Leben in materiellem Wohlstand geschaffen. Doch die Frage ist heute längst nicht mehr, wie wir durch Wachstum zu Wohlstand kommen, sondern wie wir den Wohlstand erhalten und zugleich gerechter verteilen können.
Beschäftigte in Dienstleistungsberufen wie Gastronomen, Reinigungskräfte, Lieferanten, Taxifahrer oder Verkäufer haben am Wohlstandsgewinn der vergangenen Jahrzehnte kaum teilgehabt. Sie eint, dass sie in Vollzeit oder sogar darüber hinaus arbeiten. Trotzdem reicht ihr monatliches Nettoeinkommen gerade mal aus, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Viele von ihnen verdienen knapp 2000 Euro brutto und verfügen kaum über Rücklagen oder Vermögen.
Manche meiner Bekannten, die in Vollzeit arbeiten, haben jahrelang keinen Urlaub mehr gemacht oder spielen mit dem Gedanken, die Altersvorsorge zu kappen, weil ihnen Ende des Monats nicht genug Geld übrig bleibt. Sie gehören zu einer sozialen Klasse, welche die Autorin Julia Friedrichs als neue „Working Class“ bezeichnet. Diese schließt sehr verschiedene Berufsbilder ein, von der unqualifizierten Reinigungskraft im U-Bahnhof bis zum Musikschullehrer mit akademischem Abschluss.
Alle diese vereint: die prekären Arbeitsverhältnisse, etwa durch Jobs im Niedriglohnsektor, Zeitarbeitsverträge oder Beschäftigung in Teilzeit oder auf Minijob-Basis. Auch ich kenne Studienkollegen, die trotz herausragendem Abschluss lange Zeit nach einem Job gesucht haben oder sich in der Hochschullehre von einem Zeitarbeitsvertrag zum nächsten hangeln.
Es ist ein Phänomen, das Friedrichs als Wohlstandsillusion bezeichnet. Das heißt: Für diese Menschen ist das Versprechen, durch mehr Arbeit zu Wohlstand zu kommen, nicht aufgegangen.
Das bröckelnde Wohlstandsversprechen der Babyboomer
Sozialer Aufstieg und eine sichere Zukunft sind heute auch für junge Menschen nicht mehr garantiert, trotz wirtschaftlichen Wachstums. Eine Bertelsmann-Studie aus dem Jahr 2021 zeigt, dass es für jede nachfolgende Generation nach den Babyboomern schwieriger geworden ist, in die mittleren Einkommensgruppen aufzusteigen. Die Mittelschicht in Deutschland schrumpft trotz gesunkener Arbeitslosigkeit immer weiter, wie aus der Studie hervorgeht.
Gesellschaftliche Entwicklungen wie diese lösen in meiner Generation regelrechten Unmut über das herkömmliche Wohlstandsversprechen aus, das aus Zeiten der Babyboomer stammt. Die Themen, die uns Millennials oder die Gen Z umtreiben, sind dagegen: niedrige Rentenniveaus, steigende Mieten, mentale Überlastung und die Klimafrage. In meinem Umkreis kenne ich viele ambitionierte Menschen, die angesichts der Krisen unserer Zeit regelrecht desillusioniert auf ihre Zukunft blicken. Wer kann uns heute noch garantieren, dass wir im hohen Alter eine sichere Rente haben werden, von der wir leben können?
All dies sind Herausforderungen, welche für die Zukunft unserer Generation entscheidend sind. Unser Wirtschaftsmodell, welches das Bruttosozialprodukt als Indikator für den Wohlstand von Nationalstaaten festlegt und dafür Wachstum voraussetzt, hat keine Antwort auf diese Herausforderungen gegeben.
Im Gegenteil: Laut Oxfam besitzt das reichste Prozent der Weltbevölkerung mittlerweile 45 Prozent des weltweiten Vermögens, während die Schere zwischen Arm und Reich immer weiterwächst. Die Erzählung, mehr Wachstum führe zu Wohlstand, ist somit längst nicht mehr haltbar. Allein in Deutschland besitzen die reichsten fünf Prozent ganze 48 Prozent des Vermögens, während die gesamte ärmere Hälfte der Bevölkerung nahezu leer ausgeht. Unter diesen Bedingungen können Millennials wie ich und die Gen Z nur mit unguten Gefühlen auf die Aussage von Friedrich Merz reagieren.
Wohlstand neu denken: Vermögen umverteilen
Damit Wohlstand gerechter verteilt wird, braucht es eine erneuerte Definition des Begriffs. Ein solches kann als neues Leitbild dem politischen und ökonomischen Handeln eine andere Richtung geben. Dem Ökonomen Marcel Fratzscher zufolge sollten Politik und Wirtschaft sich von der engstirnigen Vorstellung fortbewegen, ausschließlich auf Wirtschaftswachstum zu setzen.
Stattdessen gehe es drum, eine bessere Qualität der Arbeit für Menschen, mehr Glück und Lebenszufriedenheit zu schaffen. Dazu tragen eine bessere Work-Life-Balance und auch eine flexiblere Arbeitszeitgestaltung bei – ein Luxus, den gerade Beschäftigte im Dienstleistungssektor sich aufgrund fehlender Rücklagen oft nicht gönnen können.
Bessere Qualität von Arbeit zu schaffen, geht auch damit einher, die neue „Working Class“ zu entlasten. Dazu stellt sich die Autorin Julia Friedrichs eine Umverteilung vor, wobei Kapitalbesitzer durch Beteiligung an der Finanzierung des Staates Menschen mit weniger Vermögen entlasten könnten. Ihre Recherchen zeigen: Mit 1900 Euro im Monat würden Ladenbesitzer, Gastronomen oder Freiberufler sich bereits sicherer fühlen und somit mehr am Wohlstand teilhaben.
Mehr als nur Bruttosozialprodukt
Die Philosophin Hannah Schragmann weist auf weitere Kriterien hin, die einer neuen Definition von Wohlstand dienen könnten. Ihr zufolge klammert das Bruttosozialprodukt viele Größen, welche die Gesellschaft aufrechterhalten und zu allgemeiner Lebensqualität beitragen, aus: ehrenamtliche Tätigkeiten, Care-Arbeit oder Maßnahmen, die zum Erhalt der Natur beitragen. All das sind Faktoren, die in der betriebswirtschaftlichen Rechnung nicht zum Tragen kommen und bislang nicht unter die volkswirtschaftliche Leistung fallen.
Rechnet man diese Faktoren mit ein, würde als Leistung nicht mehr nur reine Erwerbsarbeit zählen, sondern alle bislang unbezahlten Tätigkeiten, die zum Funktionieren der Gesellschaft beitragen: Dann würde sich Leistung wirklich wieder lohnen.