Wer ist die wahre Linke im ganzen Land?
Wäre Politik wie Musik und wären SPD und Linkspartei Sängerinnen, so könnte man im Rückblick auf die letzten Monate und in Ausblick auf die kommenden Wahlen von einem harmonischen Duett sprechen. Beide beherrschen, wie sonst keiner auf der politischen Bühne das, was die Musiklehre eine Parallelbewegung nennt. Bei unterschiedlicher Tonlage halten sie exakt den gleichen Abstand.
Wo die SPD im Vorfeld der Bundestagswahl erkennbar nach links gerückt ist, da ist die Linke linksradikal geworden. Ob Mindestlohn, Hartz- oder Spitzensteuersatz: Jedes Mal wenn die Sozialdemokratie sich sozial profiliert, legt die Linke eine sozialistische Schippe drauf. Wo die SPD ein Rettungspaket für Opel schnürt, packt "Die Linke" gleich noch ein paar Pleite-Unternehmen mit hinein. Und in dem Maße wie bei der SPD die Linken die Kandidatenlisten für die Bundestagswahl erobern, werden diese bei der Partei "Die Linke" von Jungkommunisten und Antikapitalisten besetzt.
Nun spielt man Politik anders als Musik und diese Art der Parallelbewegung zeugt eher von einer tief sitzenden Dissonanz, vor allem derjenigen, die in beiden Parteien den Ton angeben. Oskar Lafontaine hat "Die Linke" so groß gemacht, dass sie für die SPD als Konkurrentin unübersehbar wurde und er hat die SPD so klein gemacht, dass "Die Linke" als Bündnisoption unumgänglich wurde. Doch die, die in beiden Parteien derzeit noch den Ton angeben, können und wollen dieses Bündnis nicht eingehen.
Die SPD hat die Konkurrenz angenommen und in den letzten Jahren einen erkennbaren Linksschwenk vollzogen. Dass sie kleiner geworden ist, ignoriert sie beharrlich. Deshalb kann sie für die Bundestagswahl keine realistischen Machtoptionen benennen. Die FDP wird als Koalitionspartner umso virtueller, je mehr das bürgerliche Lager auf eine eigene Mehrheit hoffen kann. Auf dieses Dilemma gibt die SPD-Führung keine Antwort, weil diese allenfalls auf eine Fortsetzung der Großen Koalition hinausläuft. Eine Fortsetzung, die sich allein aus Münteferings Maxime speist, dass Opposition Mist ist.
Deshalb mehren sich die Stimmen, die die SPD zur Linken öffnen wollen, um diesem Dilemma zu entkommen. Diese Stimmen werden den Ton angeben, wenn nach der Bundestagswahl die SPD in die Opposition geht. Die Schröder-SPD wird dann Vergangenheit sein und Müntefering nur noch ein Vorsitzender des Übergangs.
Es ist eine Ironie der sozialdemokratischen Geschichte, dass dann als letzter Enkel Willy Brandts Oskar Lafontaine die Geschicke der SPD steuern wird – wenn auch nur von außen. Die SPD hat ihn nach seinen Weggang 1999 lange und erfolglos durch Ignorieren bekämpft, dabei war seit dem Erstarken der Linken die fällige Auseinandersetzung allenfalls eine Frage des Terrains: entweder in einer gemeinsamen Regierung oder in der Opposition. Lafontaines Stärke liegt in der Opposition, für ihn ist Regieren Mist. Deshalb hat er in den letzten Wochen frühere Überzeugungen über Bord geworfen und die Linkspartei radikalisiert.
Er will keine linke Koalition, er will eine linke Opposition in der er die Definitionshoheit darüber wieder erlangt, was sozialdemokratische Politik ist. Und eine SPD in der Opposition wird gezwungen sein, diese Debatte zu führen. Die beiden Parteien werden sich politisch annähern und im gleichen Maße von gesellschaftlichen Mehrheiten entfernen.
Als 1998 Rot-Grün an die Macht kam, war es ein verspätetes Projekt. Seine inhaltliche Formierung lag damals schon Jahre zurück. Schröders Politik der Mitte, die ihm die Machtperspektive eröffnete, war keine rot-grüne Philosophie.
Rot-Rot ist kein Projekt, es ist von Anfang an ein Kampf um die gleiche sozialdemokratische Substanz. Auch dieses Nicht-Projekt ist verspätet. Denn die entscheidende Frage für beide Parteien ist nicht, wer von ihnen die Deutungshoheit hat, sondern warum diese Substanz an Attraktivität verliert. Die Antwort liegt wie immer in der Mitte.
Dieter Rulff, Journalist: Jahrgang 1953, studierte Politikwissenschaft in Berlin und arbeitete zunächst in der Heroinberatung in Berlin. Danach wurde er freier Journalist und arbeitete im Hörfunk. Weitere Stationen waren die "taz" und die Ressortleitung Innenpolitik bei der Hamburger "Woche". Vom März 2002 bis Ende 2005 arbeitete Rulff als freier Journalist in Berlin. Er schreibt für überregionale Zeitungen und die Neue Gesellschaft/ Frankfurter Hefte. Seit 2006 Redakteur der Zeitschrift "Vorgänge".
Nun spielt man Politik anders als Musik und diese Art der Parallelbewegung zeugt eher von einer tief sitzenden Dissonanz, vor allem derjenigen, die in beiden Parteien den Ton angeben. Oskar Lafontaine hat "Die Linke" so groß gemacht, dass sie für die SPD als Konkurrentin unübersehbar wurde und er hat die SPD so klein gemacht, dass "Die Linke" als Bündnisoption unumgänglich wurde. Doch die, die in beiden Parteien derzeit noch den Ton angeben, können und wollen dieses Bündnis nicht eingehen.
Die SPD hat die Konkurrenz angenommen und in den letzten Jahren einen erkennbaren Linksschwenk vollzogen. Dass sie kleiner geworden ist, ignoriert sie beharrlich. Deshalb kann sie für die Bundestagswahl keine realistischen Machtoptionen benennen. Die FDP wird als Koalitionspartner umso virtueller, je mehr das bürgerliche Lager auf eine eigene Mehrheit hoffen kann. Auf dieses Dilemma gibt die SPD-Führung keine Antwort, weil diese allenfalls auf eine Fortsetzung der Großen Koalition hinausläuft. Eine Fortsetzung, die sich allein aus Münteferings Maxime speist, dass Opposition Mist ist.
Deshalb mehren sich die Stimmen, die die SPD zur Linken öffnen wollen, um diesem Dilemma zu entkommen. Diese Stimmen werden den Ton angeben, wenn nach der Bundestagswahl die SPD in die Opposition geht. Die Schröder-SPD wird dann Vergangenheit sein und Müntefering nur noch ein Vorsitzender des Übergangs.
Es ist eine Ironie der sozialdemokratischen Geschichte, dass dann als letzter Enkel Willy Brandts Oskar Lafontaine die Geschicke der SPD steuern wird – wenn auch nur von außen. Die SPD hat ihn nach seinen Weggang 1999 lange und erfolglos durch Ignorieren bekämpft, dabei war seit dem Erstarken der Linken die fällige Auseinandersetzung allenfalls eine Frage des Terrains: entweder in einer gemeinsamen Regierung oder in der Opposition. Lafontaines Stärke liegt in der Opposition, für ihn ist Regieren Mist. Deshalb hat er in den letzten Wochen frühere Überzeugungen über Bord geworfen und die Linkspartei radikalisiert.
Er will keine linke Koalition, er will eine linke Opposition in der er die Definitionshoheit darüber wieder erlangt, was sozialdemokratische Politik ist. Und eine SPD in der Opposition wird gezwungen sein, diese Debatte zu führen. Die beiden Parteien werden sich politisch annähern und im gleichen Maße von gesellschaftlichen Mehrheiten entfernen.
Als 1998 Rot-Grün an die Macht kam, war es ein verspätetes Projekt. Seine inhaltliche Formierung lag damals schon Jahre zurück. Schröders Politik der Mitte, die ihm die Machtperspektive eröffnete, war keine rot-grüne Philosophie.
Rot-Rot ist kein Projekt, es ist von Anfang an ein Kampf um die gleiche sozialdemokratische Substanz. Auch dieses Nicht-Projekt ist verspätet. Denn die entscheidende Frage für beide Parteien ist nicht, wer von ihnen die Deutungshoheit hat, sondern warum diese Substanz an Attraktivität verliert. Die Antwort liegt wie immer in der Mitte.
Dieter Rulff, Journalist: Jahrgang 1953, studierte Politikwissenschaft in Berlin und arbeitete zunächst in der Heroinberatung in Berlin. Danach wurde er freier Journalist und arbeitete im Hörfunk. Weitere Stationen waren die "taz" und die Ressortleitung Innenpolitik bei der Hamburger "Woche". Vom März 2002 bis Ende 2005 arbeitete Rulff als freier Journalist in Berlin. Er schreibt für überregionale Zeitungen und die Neue Gesellschaft/ Frankfurter Hefte. Seit 2006 Redakteur der Zeitschrift "Vorgänge".
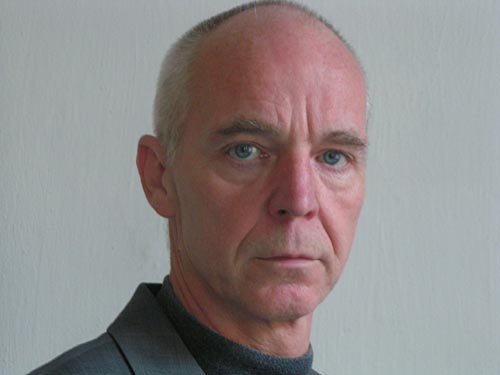
Dieter Rulff© privat