Wendezeiten
Ein politisches "Déjà-vu" - diesmal in Berlin. Vor exakt 25 Jahren wurde im beschaulichen Bonn, der damaligen Bundeshauptstadt, ein Machtwechsel inszeniert, zu dessen Dramaturgie auch die aktuellen Irrungen und Wirrungen in der Großen Koalition verdächtig parallel abzulaufen scheinen.
Der Sturz des Kanzlers der sozialliberalen Koalition, Helmut Schmidt, wurde damals allerdings in erster Linie vom kleineren Partner, der FDP organisiert. Diesmal scheint die Partei der Kanzlerin mit merkwürdigen Sollbruchstellen aufzuwarten. Ihre Architekten: Wolfgang Schäuble und Franz Josef Jung mit den abenteuerlichen Vorschlägen zur Vermischung von äußerer und innerer Sicherheit.
Als die damaligen politischen Schurken im Stück um die Kabinettskabale angesehen waren Graf Lambsdorff von der FDP und einige Helfershelfer der Sozialdemokraten, die ihren erfolgreichen Kanzler mit ihrem nachhaltigen Widerstand gegen den NATO-Doppelbeschluss entscheidend schwächten.
Doch wie sich die Bilder gleichen. Auch damals zur Mitte der Legislaturperiode krachte es an allen Ecken und Enden. Es kam schon bald nach der Wahl von 1980, die der Unionskanzlerkandidat Franz Josef Strauß verlor und die FDP mit einem sehr guten Ergebnis zum Retter von sozialliberal machte, zu einer faktischen unheiligen Allianz der Nachrüstungsgegner in der SPD und jenen Kräften in der FDP, die sich nun stark genug fühlten, ihre neoliberalen Wirtschaftsprinzipien anzumahnen. Gegenseitiges Misstrauen allerorten war an der Tagesordnung, ein wahres Lehrstück für den programmierten Machtwechsel.
Offene Kritik an Kanzler Schmidt: Hier tat sich besonders Oskar Lafontaine hervor, der in einem Stern-Interview dem Bundeskanzler bescheinigte, dieser fordere von seiner Partei lauter Sekundärtugenden ein, wie "Pflichtgefühl, Berechenbarkeit, Machbarkeit und Standhaftigkeit". Damit, so Lafontaine wörtlich, könne man "ganz präzise gesagt, ein KZ betreiben".
Keine Frage, es kriselte in der SPD an allen Ecken und Enden und die FDP machte sich daran, in Geheimgesprächen ihrer Spitzenleute wie Hans Dietrich Genscher, Otto Graf Lambsdorff und Josef Ertl in Geheimtreffen mit Unionsgranden wie Richard von Weizsäcker, Helmut Kohl, ja sogar durch Kontakte mit Franz Josef Strauß die damals so bezeichnete "Wende" einzuleiten. Später vereinnahmte die deutsche Einheit diesen Begriff.
Damals jedoch, es war im August 1981, also schon ein Jahr nach der Wahl und vor dem Bruch formulierte der offenbar schon damals vom Wechsel beseelte Hans Dietrich Genscher seinen so genannten Wende-Brief, der vor allem in der Wirtschafts- aber auch der Sicherheitspolitik von der SPD mehr Verlässlichkeit und Zugeständnisse einforderte. Hinzu kam das sogenannte Lambsdorff Papier, mit dem der Wirtschaftsminister eine Umkehr der Koalition hin zu einer marktliberalen Wirtschaftspolitik propagierte.
Seither lag das strenge Aroma des Kanzlersturzes über der Bonner Käseglocke, ein Dunst, den Schmidts letzter Regierungssprecher Klaus Bölling, als einen Verrat durch die FDP wertete.
Allerdings sollte auch nicht übersehen werden, dass der ehemalige Verteidigungsminister Helmut Schmidt, ein transatlantisch denkender und handelnder Stratege in dieser Schlussphase des kalten Krieges der Systeme die Nachrüstung des Westens vor allem im Bereich der atomaren Mittelstreckenraketen, Stichwort Pershing II, für unabdingbar hielt. Die von vielen auch und gerade in der SPD nicht nachzuvollziehende Formel lautete damals: Aufrüsten, um dann bei den Abrüstungsverhandlungen mehr Spielraum zu haben.
Während Schmidts sich dem Ende zuneigender Kanzlerschaft hielten sich viele Nachrüstungsgegner taktisch in Deckung und intrigierten im Verborgenen Bei dem denkwürdigen, sogenannten Kölner Raketenparteitag, als der schon abgewählte Kanzler noch einen letzten Versuch zugunsten der NATO-Nachrüstung unternahm, kamen sie aus der Deckung. Ex-Verteidigungsminister Hans Apel, der in Köln zu der Handvoll Genossen an Schmidts Seite zählte, resümierte später: "Ein schlimmer Parteitag mit Fernwirkungen"
Herbert Wehner hatte seinerzeit vor einem Bruch der Koalition gewarnt und im Spätsommer 1982 ein Ende des Genossenzwists angemahnt. Denn, so Wehner seherisch, käme Kohl dran, wäre die SPD für mindestens 15 Jahre weg vom Fenster. Es wurden dann 16, doch Helmut Kohl setzte die NATO-Nachrüstung durch. Ironie der Geschichte, dass er die Idee seines Vorgängers mit Genscher verwirklichte und damit dazu beitrug, dass Michail Gorbatschow mit Glasnost und Perestroika eine welthistorische Wende einleiten konnte.
Für Helmut Schmidt mag der stille Triumph geblieben sein, mit seiner Politik die richtige Richtung eingeschlagen zu haben. Er muss sich allerdings auch in Stich gelassen gefühlt haben. Von den eigenen Genossen und jenen, die sehr schnell mit Aussicht auf Besseres den Koalitionsvertrag durch ein, wie Schmidt es formulierte, Scheidungspapier ersetzten, Das Intrigenspiel war allzu durchsichtig - wie gesagt, man darf heute ein Déjà-vu konstatieren.
Prof. Rainer Burchardt lehrt an der Hochschule Kiel im Bereich Medien- und Kommunikationsstrukturen. Er hat zudem seit längerer Zeit eine Honorarprofessur an der Hochschule Bremen inne. Rainer Burchardt war zuvor seit Juli 1994 Deutschlandfunk-Chefredakteur.
Vor seiner fast zwölfjährigen Tätigkeit beim Deutschlandfunk war Burchardt langjähriger ARD-Korrespondent in Brüssel, Bonn, Genf und London. Unter anderem schrieb er für DIE ZEIT, Sonntagsblatt und andere Zeitungen und ist Vorstandmitglied der Journalistenvereinigung "Netzwerk Recherche".
Als die damaligen politischen Schurken im Stück um die Kabinettskabale angesehen waren Graf Lambsdorff von der FDP und einige Helfershelfer der Sozialdemokraten, die ihren erfolgreichen Kanzler mit ihrem nachhaltigen Widerstand gegen den NATO-Doppelbeschluss entscheidend schwächten.
Doch wie sich die Bilder gleichen. Auch damals zur Mitte der Legislaturperiode krachte es an allen Ecken und Enden. Es kam schon bald nach der Wahl von 1980, die der Unionskanzlerkandidat Franz Josef Strauß verlor und die FDP mit einem sehr guten Ergebnis zum Retter von sozialliberal machte, zu einer faktischen unheiligen Allianz der Nachrüstungsgegner in der SPD und jenen Kräften in der FDP, die sich nun stark genug fühlten, ihre neoliberalen Wirtschaftsprinzipien anzumahnen. Gegenseitiges Misstrauen allerorten war an der Tagesordnung, ein wahres Lehrstück für den programmierten Machtwechsel.
Offene Kritik an Kanzler Schmidt: Hier tat sich besonders Oskar Lafontaine hervor, der in einem Stern-Interview dem Bundeskanzler bescheinigte, dieser fordere von seiner Partei lauter Sekundärtugenden ein, wie "Pflichtgefühl, Berechenbarkeit, Machbarkeit und Standhaftigkeit". Damit, so Lafontaine wörtlich, könne man "ganz präzise gesagt, ein KZ betreiben".
Keine Frage, es kriselte in der SPD an allen Ecken und Enden und die FDP machte sich daran, in Geheimgesprächen ihrer Spitzenleute wie Hans Dietrich Genscher, Otto Graf Lambsdorff und Josef Ertl in Geheimtreffen mit Unionsgranden wie Richard von Weizsäcker, Helmut Kohl, ja sogar durch Kontakte mit Franz Josef Strauß die damals so bezeichnete "Wende" einzuleiten. Später vereinnahmte die deutsche Einheit diesen Begriff.
Damals jedoch, es war im August 1981, also schon ein Jahr nach der Wahl und vor dem Bruch formulierte der offenbar schon damals vom Wechsel beseelte Hans Dietrich Genscher seinen so genannten Wende-Brief, der vor allem in der Wirtschafts- aber auch der Sicherheitspolitik von der SPD mehr Verlässlichkeit und Zugeständnisse einforderte. Hinzu kam das sogenannte Lambsdorff Papier, mit dem der Wirtschaftsminister eine Umkehr der Koalition hin zu einer marktliberalen Wirtschaftspolitik propagierte.
Seither lag das strenge Aroma des Kanzlersturzes über der Bonner Käseglocke, ein Dunst, den Schmidts letzter Regierungssprecher Klaus Bölling, als einen Verrat durch die FDP wertete.
Allerdings sollte auch nicht übersehen werden, dass der ehemalige Verteidigungsminister Helmut Schmidt, ein transatlantisch denkender und handelnder Stratege in dieser Schlussphase des kalten Krieges der Systeme die Nachrüstung des Westens vor allem im Bereich der atomaren Mittelstreckenraketen, Stichwort Pershing II, für unabdingbar hielt. Die von vielen auch und gerade in der SPD nicht nachzuvollziehende Formel lautete damals: Aufrüsten, um dann bei den Abrüstungsverhandlungen mehr Spielraum zu haben.
Während Schmidts sich dem Ende zuneigender Kanzlerschaft hielten sich viele Nachrüstungsgegner taktisch in Deckung und intrigierten im Verborgenen Bei dem denkwürdigen, sogenannten Kölner Raketenparteitag, als der schon abgewählte Kanzler noch einen letzten Versuch zugunsten der NATO-Nachrüstung unternahm, kamen sie aus der Deckung. Ex-Verteidigungsminister Hans Apel, der in Köln zu der Handvoll Genossen an Schmidts Seite zählte, resümierte später: "Ein schlimmer Parteitag mit Fernwirkungen"
Herbert Wehner hatte seinerzeit vor einem Bruch der Koalition gewarnt und im Spätsommer 1982 ein Ende des Genossenzwists angemahnt. Denn, so Wehner seherisch, käme Kohl dran, wäre die SPD für mindestens 15 Jahre weg vom Fenster. Es wurden dann 16, doch Helmut Kohl setzte die NATO-Nachrüstung durch. Ironie der Geschichte, dass er die Idee seines Vorgängers mit Genscher verwirklichte und damit dazu beitrug, dass Michail Gorbatschow mit Glasnost und Perestroika eine welthistorische Wende einleiten konnte.
Für Helmut Schmidt mag der stille Triumph geblieben sein, mit seiner Politik die richtige Richtung eingeschlagen zu haben. Er muss sich allerdings auch in Stich gelassen gefühlt haben. Von den eigenen Genossen und jenen, die sehr schnell mit Aussicht auf Besseres den Koalitionsvertrag durch ein, wie Schmidt es formulierte, Scheidungspapier ersetzten, Das Intrigenspiel war allzu durchsichtig - wie gesagt, man darf heute ein Déjà-vu konstatieren.
Prof. Rainer Burchardt lehrt an der Hochschule Kiel im Bereich Medien- und Kommunikationsstrukturen. Er hat zudem seit längerer Zeit eine Honorarprofessur an der Hochschule Bremen inne. Rainer Burchardt war zuvor seit Juli 1994 Deutschlandfunk-Chefredakteur.
Vor seiner fast zwölfjährigen Tätigkeit beim Deutschlandfunk war Burchardt langjähriger ARD-Korrespondent in Brüssel, Bonn, Genf und London. Unter anderem schrieb er für DIE ZEIT, Sonntagsblatt und andere Zeitungen und ist Vorstandmitglied der Journalistenvereinigung "Netzwerk Recherche".
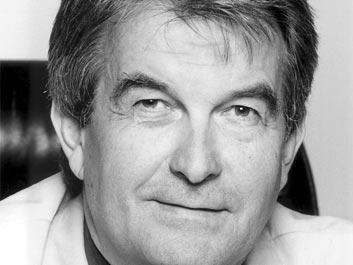
Rainer Burchardt© Deutschlandradio