Wechselbeziehung von Religion und Politik in USA
Die gläubigen Amerikaner sind politischer geworden. Seit Jahrzehnten tendieren sie zur Partei der Republikaner: aber nie war ihr Einfluss auf eine Wahlentscheidung so groß wie im vergangenen Herbst, als sich dreiviertel derjenigen, die sich zur "christlichen Rechten" der USA zählen, für George W. Bush entschieden.
Sie entschieden sich für einen Präsidenten, der immer wieder den Glauben anspricht, will er Politik erklären, z.B. in der Rede, mit der er am 20. Januar zum zweiten Mal ins Weiße Haus einzog:
"Amerikas wichtigste Interessen und unsere Überzeugung sind eins. Seit dem Tag, an dem die Vereinigten Staaten gegründet wurden, bestehen wir darauf, dass jeder Mensch Rechte und Würde hat. Jeder ist unersetzbar, weil jeder Mensch das Antlitz des Schöpfers von Himmel und Erde trägt."
Josef Braml verweist auf die Quellen der Politisierung gläubiger Amerikaner:
"Es ist nicht so, dass hier ein neues "Awakening" stattgefunden hätte, dass eben hier mehr Amerikaner religiös würden. Es ist das Gegenteil der Fall. Viele Amerikaner sind säkularer geworden. Amerika hat sich liberalisiert. Aber eben genau diese gesellschaftliche Bewegung hat die politische Bewegung der christlichen Rechten verursacht. Man kann es einigermaßen genau datieren auf den Anfang der 70er Jahre, als eben hier auch politische Entscheidungen in die Lebenswelt christlicher Rechter eingegriffen haben, z.B. Roe vs. Wade, das Abtreibungsurteil 1973. Hier wurden viele Evangelikale und bis dato apolitische Christen politisiert und zum politischen Engagement bewogen."
Geschickt werden Fragen der "Lebenskultur" immer wieder mit dem Abtreibungsthema verknüpft. Darüber hinaus setzte Präsident Bush für die christliche Rechte Zeichen, als er sich jüngst im "Fall Schiavo" eindeutig an die Seite derer stellte, die das Leben der Frau unter keinen Umständen beenden wollten.
Dabei müssen Bush und seine Mitarbeiter aufpassen, dass ihnen inmitten der Woge christlicher Zustimmung nicht Mehrheiten abhanden kommen. Der Autor schreibt:
"Für die Strategen für eine umfassende Republikanische Wählerkoalition war und bleibt es eine besondere Herausforderung, die christlichen Rechte zu integrieren, ohne dabei andere Wähler zu verlieren. Denn es gilt ein breites Spektrum von Republikanern - vom wirtschafts- und wertelibertären bis hin zum wertkonservativen, christlich rechten Pol - unter einem Dach zu halten. Strategen der christlichen Rechten und der Republikanischen Partei konzentrieren sich deshalb auf einige wirtschafts- und außen-, dabei vor allem sicherheitspolitische Themen im Kampf gegen den Terrorismus. Innenpolitische Auseinandersetzungen um heikle Themen wie Abtreibung werden abgeschwächt und in die Außenpolitik verlagert, zumal außenpolitische Auseinandersetzungen und Erfolge viel versprechender und weniger riskant für den Zusammenhalt des eigenen Lagers sind. "
Braml glaubt nicht, dass die christlichen Ideologen die innenpolitische Agenda der kommenden Jahre dominieren werden.
"In innenpolitischen Bereichen wird es, denke ich, Kollateralschäden geben im Zuge nach dem Kulturkampf. Sie werden das beobachten können, wenn es demnächst gilt Richterämter zu besetzen. Hier denke ich, wird die republikanische Basis Schwierigkeiten haben, die Vielartigkeit der Republikaner unter einem Parteizelt halten zu können. Aber in der Außenpolitik muss man doch zusammen stehen gegen den gemeinsamen Feind, der eben hier auch mit religiösen Motiven stigmatisiert wird. "
In der Außenpolitik will die christliche Rechte vor allem dann mitreden, wenn es um Israel geht, für sie das im Wortsinn "gelobte Land". Eine Unterstützung der "Road Map" verbunden mit Forderungen an Israel, sich aus den besetzten Gebieten zurückzuziehen, wird Bush nach Ansicht des Autors in Schwierigkeiten bringen.
"George W. Bush hat nicht zuletzt auch seine Wiederwahl erreicht, indem er nicht nur in der Innenpolitik moralisch argumentiert hat, religiös moralisch, sondern auch im außenpolitischen Kampf gegen den Terrorismus auf "moral clarity", auf diese moralische Klarheit gesetzt hat und hier eben auch böse Regime stigmatisiert hat. Und er würde sicher diese moralische Klarheit preisgeben, er würde hier Doppelmoral praktizieren in den Augen christlich Rechter, wenn er hier sich mit diesen Regimen an einen Verhandlungstisch setzte."
Schlechte Aussichten also für die, die einen Ausgleich suchen, etwa mit den Palästinensern oder dem Iran. Schlechte Aussichten auch für die Beziehungen des säkularen Europa, das mit außenpolitischem Rigorismus wenig anfangen kann, zu den Vereinigten Staaten. Braml schreibt:
"Der Kampf gegen den Terrorismus könnte neue Macht und Wertestrukturen etablieren, die langfristig wirkmächtig bleiben. Ein gefestigtes religiöses Establishment würde nicht nur weiterhin versuchen, das Weltbild und den Kurs amerikanischer Außenpolitik zu beeinflussen, sondern auch für den innenpolitischen Rückhalt zur militärischen Durchsetzung seiner Werte sorgen. Das würde zur weiteren inneren Polarisierung Amerikas beitragen und Divergenzen in den transatlantischen Beziehungen produzieren. "
Josef Braml hat dennoch Trost für Diejenigen, die in der Wiederwahl Bushs das Ende jeglicher transatlantischer Gemeinsamkeit sehen. Der Pragmatismus, so sein abschließendes Urteil, wird sich letztlich durchsetzen:
"Er ist nicht dieser religiöse Spinner, für den ihn viele Kommentatoren hierzulande und auch in Amerika fälschlicherweise halten. Ich denke, dass George W. Bushs sehr rational kalkuliert, um seine Politik durchzusetzen."
Braml hat ein informatives Buch über die Wechselbeziehung von Religion und Politik in den Vereinigten Staaten vorgelegt. Wer seine mitunter wissenschaftlich komplizierte Sprache gut verdaut, der liest es mit Gewinn.
"Amerikas wichtigste Interessen und unsere Überzeugung sind eins. Seit dem Tag, an dem die Vereinigten Staaten gegründet wurden, bestehen wir darauf, dass jeder Mensch Rechte und Würde hat. Jeder ist unersetzbar, weil jeder Mensch das Antlitz des Schöpfers von Himmel und Erde trägt."
Josef Braml verweist auf die Quellen der Politisierung gläubiger Amerikaner:
"Es ist nicht so, dass hier ein neues "Awakening" stattgefunden hätte, dass eben hier mehr Amerikaner religiös würden. Es ist das Gegenteil der Fall. Viele Amerikaner sind säkularer geworden. Amerika hat sich liberalisiert. Aber eben genau diese gesellschaftliche Bewegung hat die politische Bewegung der christlichen Rechten verursacht. Man kann es einigermaßen genau datieren auf den Anfang der 70er Jahre, als eben hier auch politische Entscheidungen in die Lebenswelt christlicher Rechter eingegriffen haben, z.B. Roe vs. Wade, das Abtreibungsurteil 1973. Hier wurden viele Evangelikale und bis dato apolitische Christen politisiert und zum politischen Engagement bewogen."
Geschickt werden Fragen der "Lebenskultur" immer wieder mit dem Abtreibungsthema verknüpft. Darüber hinaus setzte Präsident Bush für die christliche Rechte Zeichen, als er sich jüngst im "Fall Schiavo" eindeutig an die Seite derer stellte, die das Leben der Frau unter keinen Umständen beenden wollten.
Dabei müssen Bush und seine Mitarbeiter aufpassen, dass ihnen inmitten der Woge christlicher Zustimmung nicht Mehrheiten abhanden kommen. Der Autor schreibt:
"Für die Strategen für eine umfassende Republikanische Wählerkoalition war und bleibt es eine besondere Herausforderung, die christlichen Rechte zu integrieren, ohne dabei andere Wähler zu verlieren. Denn es gilt ein breites Spektrum von Republikanern - vom wirtschafts- und wertelibertären bis hin zum wertkonservativen, christlich rechten Pol - unter einem Dach zu halten. Strategen der christlichen Rechten und der Republikanischen Partei konzentrieren sich deshalb auf einige wirtschafts- und außen-, dabei vor allem sicherheitspolitische Themen im Kampf gegen den Terrorismus. Innenpolitische Auseinandersetzungen um heikle Themen wie Abtreibung werden abgeschwächt und in die Außenpolitik verlagert, zumal außenpolitische Auseinandersetzungen und Erfolge viel versprechender und weniger riskant für den Zusammenhalt des eigenen Lagers sind. "
Braml glaubt nicht, dass die christlichen Ideologen die innenpolitische Agenda der kommenden Jahre dominieren werden.
"In innenpolitischen Bereichen wird es, denke ich, Kollateralschäden geben im Zuge nach dem Kulturkampf. Sie werden das beobachten können, wenn es demnächst gilt Richterämter zu besetzen. Hier denke ich, wird die republikanische Basis Schwierigkeiten haben, die Vielartigkeit der Republikaner unter einem Parteizelt halten zu können. Aber in der Außenpolitik muss man doch zusammen stehen gegen den gemeinsamen Feind, der eben hier auch mit religiösen Motiven stigmatisiert wird. "
In der Außenpolitik will die christliche Rechte vor allem dann mitreden, wenn es um Israel geht, für sie das im Wortsinn "gelobte Land". Eine Unterstützung der "Road Map" verbunden mit Forderungen an Israel, sich aus den besetzten Gebieten zurückzuziehen, wird Bush nach Ansicht des Autors in Schwierigkeiten bringen.
"George W. Bush hat nicht zuletzt auch seine Wiederwahl erreicht, indem er nicht nur in der Innenpolitik moralisch argumentiert hat, religiös moralisch, sondern auch im außenpolitischen Kampf gegen den Terrorismus auf "moral clarity", auf diese moralische Klarheit gesetzt hat und hier eben auch böse Regime stigmatisiert hat. Und er würde sicher diese moralische Klarheit preisgeben, er würde hier Doppelmoral praktizieren in den Augen christlich Rechter, wenn er hier sich mit diesen Regimen an einen Verhandlungstisch setzte."
Schlechte Aussichten also für die, die einen Ausgleich suchen, etwa mit den Palästinensern oder dem Iran. Schlechte Aussichten auch für die Beziehungen des säkularen Europa, das mit außenpolitischem Rigorismus wenig anfangen kann, zu den Vereinigten Staaten. Braml schreibt:
"Der Kampf gegen den Terrorismus könnte neue Macht und Wertestrukturen etablieren, die langfristig wirkmächtig bleiben. Ein gefestigtes religiöses Establishment würde nicht nur weiterhin versuchen, das Weltbild und den Kurs amerikanischer Außenpolitik zu beeinflussen, sondern auch für den innenpolitischen Rückhalt zur militärischen Durchsetzung seiner Werte sorgen. Das würde zur weiteren inneren Polarisierung Amerikas beitragen und Divergenzen in den transatlantischen Beziehungen produzieren. "
Josef Braml hat dennoch Trost für Diejenigen, die in der Wiederwahl Bushs das Ende jeglicher transatlantischer Gemeinsamkeit sehen. Der Pragmatismus, so sein abschließendes Urteil, wird sich letztlich durchsetzen:
"Er ist nicht dieser religiöse Spinner, für den ihn viele Kommentatoren hierzulande und auch in Amerika fälschlicherweise halten. Ich denke, dass George W. Bushs sehr rational kalkuliert, um seine Politik durchzusetzen."
Braml hat ein informatives Buch über die Wechselbeziehung von Religion und Politik in den Vereinigten Staaten vorgelegt. Wer seine mitunter wissenschaftlich komplizierte Sprache gut verdaut, der liest es mit Gewinn.
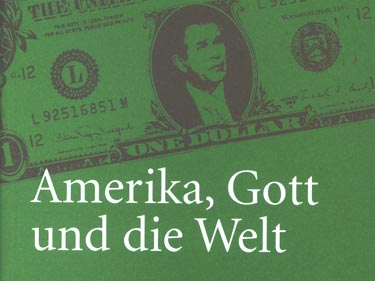
Josef Braml: Amerika, Gott und die Welt© Matthes & Seitz Berlin