Was zur Wahl steht - und was nicht
Seit Sonntag ist Klaus Wowereit der Sonnenkönig von Berlin. Es gelang ihm, das Ergebnis der SPD um 1,1 Prozent zu steigern und kein Mensch – selbst Friedberg Pflüger nicht – widerspricht, wenn er aus diesem Ergebnis den Schluss zieht, dass sich seine Politik in der Berliner Bevölkerung beständigen, wenn nicht gar wachsenden Zuspruchs erfreut.
Doch was da so hell in den Medien erstrahlt, wirft einen erkennbaren Schatten, der eigentlich auch Klaus Wowereit bedenklich stimmen müsste. Denn in Wahrheit ist die Zahl derer, die ihre Stimme für seine Politik geben in den letzten fünf Jahren gesunken. 426.000 Berliner stimmten am Sonntag für ihn, das sind 56.000 weniger als 2001 – und dass, obwohl die Zahl der Wahlberechtigten seitdem leicht gestiegen ist.
Dass sich Wowereit am Sonntag feiern lassen konnte, ist allein dem Umstand geschuldet, dass es um die Konkurrenz noch schlechter bestellt ist. Und die Relation untereinander ist nun mal die für Politiker entscheidende Größe. Sie verdeckt, dass alle Parteien mittlerweile recht erbärmlich dastehen, wenn ihr Zuspruch an der Zahl der Wahlberechtigten gemessen würde. Auf ganze 17,5 Prozent käme dann die SPD in Berlin, gefolgt von einer CDU, die bei zwölf Prozent dümpelt. Grüne und Linkspartei würden sich unter acht Prozent bewegen. Da tröstet es wenig, wenn in diesem Licht betrachtet die NPD in Mecklenburg- Vorpommern knapp über vier Prozent erzielte.
Es gehört schon seit Jahren zu den stehenden Übungen der Wahlsonntage, dass kurz bevor die erste Hochrechung auf den Bildschirmen erscheint, die geringe Wahlbeteiligung beklagt wird – um wenige Minuten später von der Frage, wer regiert und mit wem koaliert, verdrängt zu werden. Allenfalls wird allseitig und pflichtschuldig wahlweise auf das Wetter, den allgemeinen Politikverdruss oder die soziale Lage verwiesen. So sorgenzerfurcht sich Politiker in solchen Augenblicken geben, ihre Analysen bestechen meist dadurch, dass sie keine Konsequenzen zeitigen.
Dabei ist das Problem der massenhaften Wahlenthaltung vielleicht nicht allein eines des schlechten Politikangebots, sondern eines der falschen, weil überzogenen Politiknachfrage. Damit würde sich allerdings die Frage stellen, wer die weckt.
Die sinkende Wahlbeteiligung – darauf weist der Datenreport des Statistischen Bundesamtes hin – geht einher mit einer nachlassenden Akzeptanz der Demokratie. Beide Tendenzen sind vor allem in den ostdeutschen Bundesländern verbreitet. Dort halten nur noch 38 Prozent der Bevölkerung die Demokratie in Deutschland für die beste Staatsform, 41 Prozent finden, dass es andere Staatsformen gebe, die besser sind. Welche das sein sollen erschließt sich aus einer weiteren Frage, die in den ostdeutschen Ländern von einem konstant hohen Anteil der Bevölkerung bejaht wird. Dreiviertel von ihr hält den Sozialismus für eine gute Idee, die nur schlecht ausgeführt wurde.
Man mag nun an dem Erinnerungsvermögen dieser Dreiviertel zweifeln. Entscheidender ist, dass sie sich den demokratischen Staat anscheinend eher als homogene Gemeinschaft und nicht ohne ein gerüttelt Maß an sozialer Gerechtigkeit und sozialstaatlichen Zuwendungen vorstellen können.
Diese Erwartung, wurde in den vergangenen 15 Jahren immer wieder nachhaltig enttäuscht. Und wurde doch zugleich von Politikern aller Parteien immer wieder kräftig geschürt. Ihre Rhetorik der Zuversicht lebt von der Vorstellung, dass der Einzelne immer auch Produkt seiner Umstände ist und dass sich durch staatliche Steuerung dieser Umstände dessen Schicksal zum Besseren wenden lässt. Gemessen an dieser eigenen Rhetorik muss sich jedoch Politik, vor allem wenn sie Landespolitik ist und erst recht, wenn sie in den ostdeutschen Ländern betrieben wird, als zunehmend ohnmächtig, arm und in Sachzwänge verstrickt erweisen. Und was mal Wählererwartung war, schlägt in Skepsis, bisweilen Wut um. Dann kommt der Moment der Parteien, die mit einfachen Schritten in Springerstiefeln Besserung versprechen, auch wenn sich diese als nicht gangbar, unmoralisch und undemokratisch erweisen.
Erst allmählich macht sich in der politischen Rhetorik Ernüchterung breit. Doch es wird noch einige Jahre dauern, bis Erwartungen und Enttäuschungen zu einem neuen Realismus abkühlen, der den Eigenwert demokratischer Verfahren nicht mehr an den Zuwendungen misst, die mit ihnen verbunden sind. Als soziale hat die Demokratie in Deutschland, wie das ganze Modell Deutschland, einstweilen ihre Blütezeit hinter sich. Dies nüchtern anzuerkennen, muss nicht in wieder steigende Wählerzahlen umschlagen, zumal dann nicht, wenn mit den Wahlen wenig entschieden wird, was die Lebensumstände des Einzelnen tatsächlich beeinflusst. Doch eröffnet es den Blick für das Eigentliche der Demokratie, das es Wert genug ist, genutzt und gepflegt zu werden. Der Philosoph Karl Popper hat es mit den knappen Worten umschrieben: Machtwechsel auf unblutige Weise herbeizuführen.
Dieter Rulff, Jahrgang 1953, studierte Politikwissenschaft in Berlin und arbeitete zunächst in der Heroinberatung in Berlin. Danach wurde er freier Journalist und arbeitete im Hörfunk. Weitere Stationen waren die "taz" und die Ressortleitung Innenpolitik bei der Hamburger "Woche". Vom März 2002 bis Ende 2005 arbeitete Rulff als freier Journalist in Berlin. Er schreibt für überregionale Zeitungen und die Neue Gesellschaft/ Frankfurter Hefte. Ab 1. Januar 2006 Redakteur der Zeitschrift "Vorgänge".
Dass sich Wowereit am Sonntag feiern lassen konnte, ist allein dem Umstand geschuldet, dass es um die Konkurrenz noch schlechter bestellt ist. Und die Relation untereinander ist nun mal die für Politiker entscheidende Größe. Sie verdeckt, dass alle Parteien mittlerweile recht erbärmlich dastehen, wenn ihr Zuspruch an der Zahl der Wahlberechtigten gemessen würde. Auf ganze 17,5 Prozent käme dann die SPD in Berlin, gefolgt von einer CDU, die bei zwölf Prozent dümpelt. Grüne und Linkspartei würden sich unter acht Prozent bewegen. Da tröstet es wenig, wenn in diesem Licht betrachtet die NPD in Mecklenburg- Vorpommern knapp über vier Prozent erzielte.
Es gehört schon seit Jahren zu den stehenden Übungen der Wahlsonntage, dass kurz bevor die erste Hochrechung auf den Bildschirmen erscheint, die geringe Wahlbeteiligung beklagt wird – um wenige Minuten später von der Frage, wer regiert und mit wem koaliert, verdrängt zu werden. Allenfalls wird allseitig und pflichtschuldig wahlweise auf das Wetter, den allgemeinen Politikverdruss oder die soziale Lage verwiesen. So sorgenzerfurcht sich Politiker in solchen Augenblicken geben, ihre Analysen bestechen meist dadurch, dass sie keine Konsequenzen zeitigen.
Dabei ist das Problem der massenhaften Wahlenthaltung vielleicht nicht allein eines des schlechten Politikangebots, sondern eines der falschen, weil überzogenen Politiknachfrage. Damit würde sich allerdings die Frage stellen, wer die weckt.
Die sinkende Wahlbeteiligung – darauf weist der Datenreport des Statistischen Bundesamtes hin – geht einher mit einer nachlassenden Akzeptanz der Demokratie. Beide Tendenzen sind vor allem in den ostdeutschen Bundesländern verbreitet. Dort halten nur noch 38 Prozent der Bevölkerung die Demokratie in Deutschland für die beste Staatsform, 41 Prozent finden, dass es andere Staatsformen gebe, die besser sind. Welche das sein sollen erschließt sich aus einer weiteren Frage, die in den ostdeutschen Ländern von einem konstant hohen Anteil der Bevölkerung bejaht wird. Dreiviertel von ihr hält den Sozialismus für eine gute Idee, die nur schlecht ausgeführt wurde.
Man mag nun an dem Erinnerungsvermögen dieser Dreiviertel zweifeln. Entscheidender ist, dass sie sich den demokratischen Staat anscheinend eher als homogene Gemeinschaft und nicht ohne ein gerüttelt Maß an sozialer Gerechtigkeit und sozialstaatlichen Zuwendungen vorstellen können.
Diese Erwartung, wurde in den vergangenen 15 Jahren immer wieder nachhaltig enttäuscht. Und wurde doch zugleich von Politikern aller Parteien immer wieder kräftig geschürt. Ihre Rhetorik der Zuversicht lebt von der Vorstellung, dass der Einzelne immer auch Produkt seiner Umstände ist und dass sich durch staatliche Steuerung dieser Umstände dessen Schicksal zum Besseren wenden lässt. Gemessen an dieser eigenen Rhetorik muss sich jedoch Politik, vor allem wenn sie Landespolitik ist und erst recht, wenn sie in den ostdeutschen Ländern betrieben wird, als zunehmend ohnmächtig, arm und in Sachzwänge verstrickt erweisen. Und was mal Wählererwartung war, schlägt in Skepsis, bisweilen Wut um. Dann kommt der Moment der Parteien, die mit einfachen Schritten in Springerstiefeln Besserung versprechen, auch wenn sich diese als nicht gangbar, unmoralisch und undemokratisch erweisen.
Erst allmählich macht sich in der politischen Rhetorik Ernüchterung breit. Doch es wird noch einige Jahre dauern, bis Erwartungen und Enttäuschungen zu einem neuen Realismus abkühlen, der den Eigenwert demokratischer Verfahren nicht mehr an den Zuwendungen misst, die mit ihnen verbunden sind. Als soziale hat die Demokratie in Deutschland, wie das ganze Modell Deutschland, einstweilen ihre Blütezeit hinter sich. Dies nüchtern anzuerkennen, muss nicht in wieder steigende Wählerzahlen umschlagen, zumal dann nicht, wenn mit den Wahlen wenig entschieden wird, was die Lebensumstände des Einzelnen tatsächlich beeinflusst. Doch eröffnet es den Blick für das Eigentliche der Demokratie, das es Wert genug ist, genutzt und gepflegt zu werden. Der Philosoph Karl Popper hat es mit den knappen Worten umschrieben: Machtwechsel auf unblutige Weise herbeizuführen.
Dieter Rulff, Jahrgang 1953, studierte Politikwissenschaft in Berlin und arbeitete zunächst in der Heroinberatung in Berlin. Danach wurde er freier Journalist und arbeitete im Hörfunk. Weitere Stationen waren die "taz" und die Ressortleitung Innenpolitik bei der Hamburger "Woche". Vom März 2002 bis Ende 2005 arbeitete Rulff als freier Journalist in Berlin. Er schreibt für überregionale Zeitungen und die Neue Gesellschaft/ Frankfurter Hefte. Ab 1. Januar 2006 Redakteur der Zeitschrift "Vorgänge".
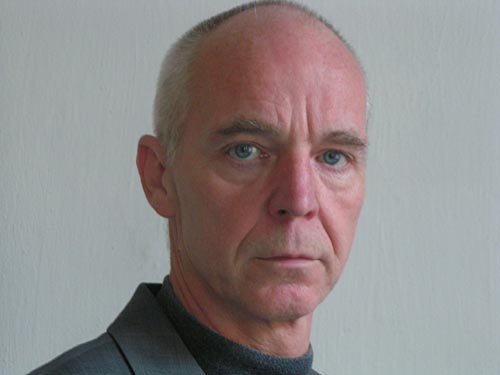
Dieter Rulff© privat