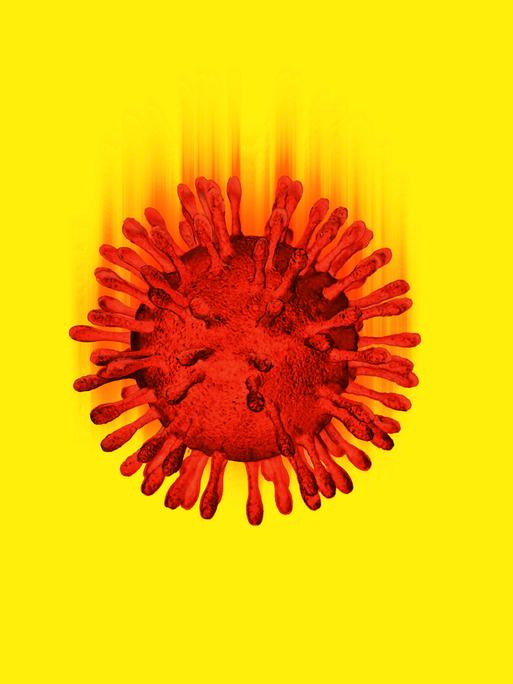Kommentar zum Corona-Ursprung

Altötting - Coronavirus © picture alliance / dpa / Felix Hörhager
Es geht um den Ruf der Wissenschaft
04:59 Minuten

Die gängige Annahme ist, dass SARS-CoV-2 vom Tier auf dem Mensch übergesprungen ist. Einige Behörden sehen hingegen auch klare Indizien für einen Laborunfall. Der Molekularbiologe Jens Schwachtje glaubt, dass es keine eindeutige Klärung geben wird.
Die Untersuchungen zur Natur des neuen Coronavirus begannen Anfang 2020 mit einem Stochern im Nebel. Während die einen versuchten, die Entwicklung von Virusvarianten zu verstehen und zukünftige Varianten vorauszusehen, richteten andere den Blick in die Vergangenheit und suchten nach dem möglichen Ursprung. Die damalige Hypothese lautete, es müsse von einer Fledermaus auf einen tierischen Zwischenwirt gesprungen sein und von dort zum Menschen. So kannte man es von älteren Corona-Viren und orientierte sich daran.
Wenige dachten an das Undenkbare: Ein Coronavirus kam aus Wuhan, wo auch an Coronaviren geforscht wurde. Gab es da etwa einen Zusammenhang? Man kannte aus der Vergangenheit auch schon Laborunfälle mit Corona-Viren.
Lässt sich überhaupt wissenschaftlich klären, wie das Coronavirus SARS-CoV-2 in die Welt kam?
Die Antwort auf eine Ja-oder-Nein-Frage
In der Wissenschaft geht es oft um Wahrscheinlichkeiten. Experimentelle Ergebnisse werden statistisch ausgewertet und müssen strengen Kriterien genügen, um signifikant zu sein. Dann gilt eine Therapie als wirksam oder ein Pflanzenschutzmittel als ertragssteigernd.
Wie kann man aber zu einem eindeutigen Ergebnis kommen, wenn es um die Herkunft eines Virus geht? Und wenn man nicht alle notwendigen Daten zur Hand hat? Denn am Ende handelt es sich hier ja um eine Wahrheit, die Antwort auf eine einfache Ja-oder-Nein-Frage.
Zu den wichtigsten Eigenschaften guter Forschung gehören Unvoreingenommenheit, Zweifel und insbesondere Ergebnisoffenheit. Oft bedarf es langen Analysierens und Abwägens, bis eine fundierte Aussage getroffen werden kann. So lange bewegt sich der Erkenntnisprozess in einer bisweilen sogar unangenehmen Unbestimmtheit, mitunter jahrelang.
Auch muss man sich eingestehen können, wenn man einer falschen Fährte gefolgt ist. Und alternative Hypothesen müssen anerkannt werden, wenn sie plausibel erscheinen.
„Laborthese“ ist keine abwegige Verschwörungstheorie mehr
Die Berichte über die Erkenntnisse des Bundesnachrichtendienstes sowie britischer und amerikanischer Geheimdienste, die die Laborherkunft für das Coronavirus als bis zu 95 prozentiger wahrscheinlich beurteilen, sind ein solches Signal. Selbst die WHO betrachtet die Herkunft des Virus weiterhin als ungeklärt. In der Welt der Fachjournale gibt es zunehmend Veröffentlichungen, die zu einer der beiden Sichtweisen tendieren, oft mit großer Vehemenz, ebenso in der journalistischen Berichterstattung.

Foto von Dezember 2022: Eine Martkhalle in Wuhan wurde nach dem Ausbruch des Coronavirus geschlossen. © picture alliance / Kyodo
Die „Laborthese“ ist jedenfalls nicht mehr die abwegige Verschwörungstheorie, als die sie heftig diffamiert und von Behörden, prominenten Virologen und Faktencheckerportalen über Jahre hinweg eingeordnet wurde. Selbst Lothar Wieler, ehemals Chef des Robert Koch-Instituts, sieht heute ein Labor als die wahrscheinlichere Quelle an - ebenso die renommierte französische Akademie für Medizin.
In diesem Fall aber müssten Journalisten und Wissenschaftler auch kriminalistisch denken. Und sie müssten es aushalten, Kritik dafür zu ernten, den rein biologisch-natürlichen Forschungsansatz zu verlassen. Aber das müssen sie bleiben: unvoreingenommen und ergebnisoffen.
Dazu gehören neue Fragen. Stecken vielleicht im Virus selbst Informationen, die man bisher übersehen hat oder einfach nicht wahrhaben wollte? Was wurde in der Forschung mit Coronaviren bisher alles schon gemacht? Welche risikobehafteten Manipulationen wurden an SARS-CoV-2 mutmaßlich durchgeführt?
Herkunftsfrage könnte Ringen um Wahrscheinlichkeiten bleiben
Die Aufklärungsarbeit zur Herkunft von Corona steht zunehmend auch in einem möglichen Konflikt mit politischen Konsequenzen. China hat bereits den Zugang zu Daten und Proben des SARS-CoV-2-Virus eingeschränkt. Politische Spannungen wären absehbar, wenn ein chinesisches Labor zweifelsfrei als Ursprungsort von Corona überführt würde. Aber auch US-amerikanische Forscher stehen dazu in einer möglichen Verbindung.
Wir müssen uns daher darauf einstellen, dass die Herkunftsfrage nie zufriedenstellend geklärt wird und viel mehr ein Ringen um Wahrscheinlichkeiten bleibt.
Denn solange kein finaler Beweis oder gar ein Geständnis vorliegen, gibt es nur die Sprache der Indizien. Also bleibt auch ein natürlicher Ursprung noch denkbar, wenn auch mit zunehmend sinkender Wahrscheinlichkeit. Zu einer ehrlichen Aufarbeitung gehört es jedenfalls, auch unangenehme Evidenzen zu akzeptieren. Die Wissenschaft hat schließlich einen Ruf zu verlieren.