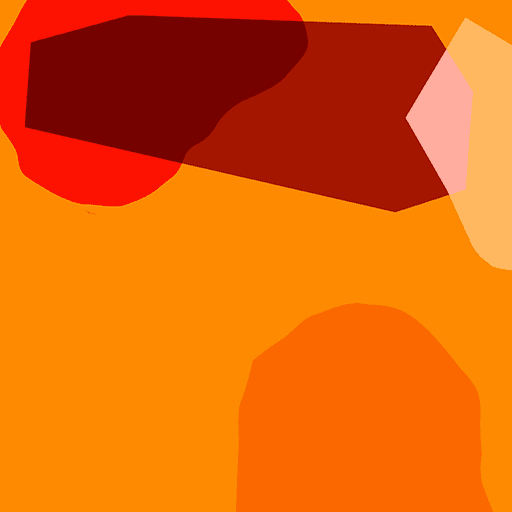Von der hohen Kunst, bis drei zu zählen
Es ist das wahrscheinlich populärste Klassik-Ereignis der Welt. Zuletzt saßen gut 40 Millionen Menschen vor dem Fernseher, als die Wiener Philharmoniker am 1. Januar 2008 im Goldenen Saal des Wiener Musikvereins zum traditionellen Neujahrskonzert aufspielten. Pizzicato-Polka, Donauwalzer, Radetzkymarsch: Sonderlich überraschend sind die Programme selten – aber der Teufel steckt im Detail!
Eigentlich ist die Sache ja ganz einfach: Eins, zwei, drei. Aber nicht in Wien. Im Walzertakt zählt man: Eins, zwei… und vielleicht drei. Wobei auch diese Rechnung nicht aufgeht, denn die Zwei muss im Gegenzug etwas früher als andernorts kommen. Aber bitte nicht zu sehr, sonst ist das Ganze ein Imitat. Für das Original garantieren die Wiener Philharmoniker, aber selbst diese unvergleichliche Edelkapelle hat es mit der Musik der Strauß-Dynastie nicht leicht: Je nach Dirigent tanzt der "Kaiserwalzer" in die unterschiedlichsten Himmelsrichtungen.
Das Erfolgsrezept ist nicht geheim – im Gegensatz zu dem der originalen Sachertorte, die nur einen Steinwurf vom Wiener Musikverein entfernt produziert wird. Nikolaus Harnoncourt fasst es so zusammen: "Eine raffinierte Schlamperei". Aber wie spielt man schlampig, ohne schlampig zu klingen? Die "Interpretationen" suchen nach musikalischen Antworten und nehmen Aufnahmen von Erich und Carlos Kleiber, von Clemens Krauss und Herbert von Karajan unter die Lupe – bis hin zu den amtierenden Großmeistern Nikolaus Harnoncourt und Georges Prêtre. Für welche Lesart des Dreivierteltakts man auch immer sich entscheidet, eins ist sicher: Die Wiener Neujahrskonzerte sind trotz der "Sisi"-artigen Verkitschung durch die Medien eine der größten interpretatorischen Herausforderungen des Musiklebens.
Das Erfolgsrezept ist nicht geheim – im Gegensatz zu dem der originalen Sachertorte, die nur einen Steinwurf vom Wiener Musikverein entfernt produziert wird. Nikolaus Harnoncourt fasst es so zusammen: "Eine raffinierte Schlamperei". Aber wie spielt man schlampig, ohne schlampig zu klingen? Die "Interpretationen" suchen nach musikalischen Antworten und nehmen Aufnahmen von Erich und Carlos Kleiber, von Clemens Krauss und Herbert von Karajan unter die Lupe – bis hin zu den amtierenden Großmeistern Nikolaus Harnoncourt und Georges Prêtre. Für welche Lesart des Dreivierteltakts man auch immer sich entscheidet, eins ist sicher: Die Wiener Neujahrskonzerte sind trotz der "Sisi"-artigen Verkitschung durch die Medien eine der größten interpretatorischen Herausforderungen des Musiklebens.