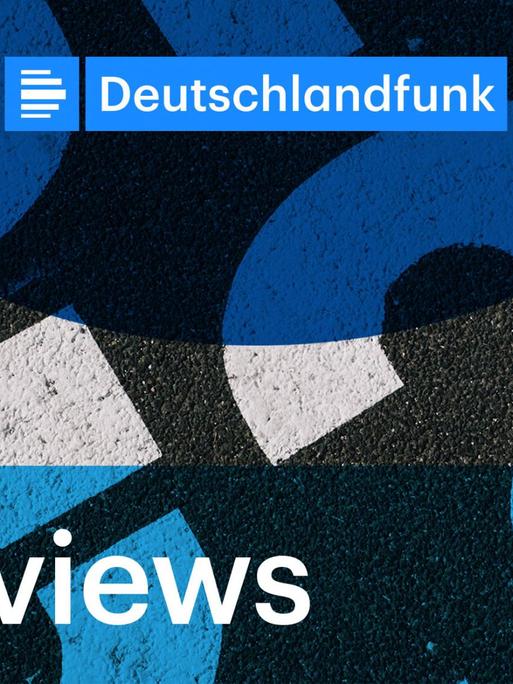Vom Idol zum Idioten
Mit seiner Enthüllungsplattform Wikileaks betrat Julian Assange die Bühne der Pop-Idole, doch inzwischen sind seine Fans ziemlich kleinlaut geworden. Wer andere bloßstellt, gehört nicht auf ein Heldenpodest, sondern gerechterweise selbst an den Pranger, meint Florian Felix Weyh.
Er ist ein Mann der Tat, nicht des Gedankens: der Freiheitsheld. Darum errichtet man ihm Denkmäler, auch wenn er nur kurzzeitig Wirksamkeit entfaltet. Als Julian Assange – Freiheitsheld 2.0 – die Bühne der Pop-Idole betrat, begannen in meinem Umfeld Menschen zu jubeln, die jetzt ziemlich kleinlaut geworden sind. Dabei war das Debakel so oder so vorhersehbar: Wer 200 Jahre Demokratiedebatte einfach ignoriert, muss sich nicht wundern, wenn er vom Idol zum Idioten mutiert. Das ging schon vielen Revolutionären so.
Die zentrale Debatte, die Assange und Konsorten hätten studieren müssen, ist die vehement ausgefochtene Kontroverse um öffentliches versus geheimes Stimmrecht bei Wahlen. Verfechter totaler Transparenz beriefen sich im späten 18. Jahrhundert – wie heute! – auf die unabdingbare Verknüpfung von Demokratie und schrankenloser Öffentlichkeit.
Noch 1984 schrieb der Radikaldemokrat Benjamin Barber, die geheime Stimmabgabe sei "wie ein Gang zur öffentlichen Bedürfnisanstalt”: Wenn niemand wisse, wie sein Nachbar abstimme, forciere das die Privatisierung politischer Präferenzen und untergrabe die Gemeinwohlorientierung der Bürger.
Genauso denken die Leakianer heute noch, allerdings weitaus aggressiver: Hinter jedem Geheimnis stecke ein potenzieller Angriff aufs Gemeinwohl; in der Wirtschaft noch mehr als in der Politik. Dass Unternehmen eben nicht aufs Gemeinwohl verpflichtet sind, sondern ihm im Regelfall durch Eigennutz dienen, will die kryptosozialistische Bewegung mit ihrer Vergesellschaftung von Privatheit nicht wahrhaben. Sie folgt damit den historischen Vorgängern.
"Bei der offenen Stimmabgabe agieren Wähler in einem System mit vollständiger Information”, beschreibt der Greifswalder Politikhistoriker Hubertus Buchstein die Transparenz-Utopie. "Die Parteiorientierung des Wählers ist bekannt, und es kommt nolens volens zu einer permanenten Wechselwirkung zwischen den politischen und den übrigen Momenten seines sozialen Lebens.”
Nolens volens: Politik und Leben verschmelzen zu einem einzigen, hochmoralischen, diktatorischen Substrat, dem gegenüber ein Wahlgeheimnis schmutzig erscheint. Denn es errichtet, so Buchstein, "ein System der Trennungen. Selbst wenn der Wähler es wollte, könnte er sein Stimmverhalten nicht nach außen dokumentieren, sondern müsste sich damit begnügen, dass ihm geglaubt wird." – Das ist die Welt der Lüge und des Misstrauens, von der uns die Kämpfer für eine totale Transparenz befreien wollen.
Nun aber kommt das Entscheidende: Ihre Position hat sich schon beim Wahlrecht nirgendwo durchgesetzt. Die Menschen wollten überall auf der Welt geheime Wahlen haben, keine offenen. Und wenn schon in diesem Mikrobereich die Mehrheit so deutlich Nein sagt – woher nehmen Assange und Konsorten dann die Chuzpe, sich als universale Freiheitshelden aufzuspielen? Sie basiert wohl auf ihrer eigenen Freiheit von Erkenntnissen.
"Würde es Sie nervös machen oder beruhigen, wenn das Haus Ihres Nachbarn durchsichtig wäre, und Sie ihm zusehen könnten, wie er seine Waffensammlung poliert?”, fragte kurz vor dem ersten Wikileaks-Anschlag der amerikanische Publizist Joshua Cooper Ramo und führte dann eine Studie auf, derzufolge Konflikte zwischen Staaten umso schneller eskalieren, je mehr Informationen die beiden Seiten voneinander besitzen: Wissen macht nicht gelassener, sondern unberechenbar.
Wem das unglaubwürdig erscheint, der bekommt die gleiche Botschaft in kleiner Münze noch deutlicher ausgezahlt: Britische Psychologen stellten in einer Neubausiedlung fest, dass Bewohner von Erdgeschosswohnungen überdurchschnittlich oft psychisch erkrankten. Als man die Fußwege in der Siedlung sperrte und nur noch enge Nachbarn an den Fenstern vorbeikamen, sank die Rate um 25 Prozent.
Wir lernen: Erzwungene Öffentlichkeit bedeutet Stress. Wer andere bloßstellt, gehört demnach nicht aufs Heldenpodest, sondern gerechterweise selbst an den Pranger. Und damit wäre er noch milde behandelt.
Florian Felix Weyh, geboren 1963, lebt als Autor und Publizist in Berlin. Preise und Stipendien für Drama, Prosa und Essay; seit 1988 arbeitet er regelmäßig als Literaturkritiker für den Deutschlandfunk. Sein jüngstes Buch "Die letzte Wahl – Therapien für die leidende Demokratie" erschien 2007 in der Anderen Bibliothek. Verstreute Texte und weitere Informationen zur Person sind auf www.weyh.info zu finden.
Die zentrale Debatte, die Assange und Konsorten hätten studieren müssen, ist die vehement ausgefochtene Kontroverse um öffentliches versus geheimes Stimmrecht bei Wahlen. Verfechter totaler Transparenz beriefen sich im späten 18. Jahrhundert – wie heute! – auf die unabdingbare Verknüpfung von Demokratie und schrankenloser Öffentlichkeit.
Noch 1984 schrieb der Radikaldemokrat Benjamin Barber, die geheime Stimmabgabe sei "wie ein Gang zur öffentlichen Bedürfnisanstalt”: Wenn niemand wisse, wie sein Nachbar abstimme, forciere das die Privatisierung politischer Präferenzen und untergrabe die Gemeinwohlorientierung der Bürger.
Genauso denken die Leakianer heute noch, allerdings weitaus aggressiver: Hinter jedem Geheimnis stecke ein potenzieller Angriff aufs Gemeinwohl; in der Wirtschaft noch mehr als in der Politik. Dass Unternehmen eben nicht aufs Gemeinwohl verpflichtet sind, sondern ihm im Regelfall durch Eigennutz dienen, will die kryptosozialistische Bewegung mit ihrer Vergesellschaftung von Privatheit nicht wahrhaben. Sie folgt damit den historischen Vorgängern.
"Bei der offenen Stimmabgabe agieren Wähler in einem System mit vollständiger Information”, beschreibt der Greifswalder Politikhistoriker Hubertus Buchstein die Transparenz-Utopie. "Die Parteiorientierung des Wählers ist bekannt, und es kommt nolens volens zu einer permanenten Wechselwirkung zwischen den politischen und den übrigen Momenten seines sozialen Lebens.”
Nolens volens: Politik und Leben verschmelzen zu einem einzigen, hochmoralischen, diktatorischen Substrat, dem gegenüber ein Wahlgeheimnis schmutzig erscheint. Denn es errichtet, so Buchstein, "ein System der Trennungen. Selbst wenn der Wähler es wollte, könnte er sein Stimmverhalten nicht nach außen dokumentieren, sondern müsste sich damit begnügen, dass ihm geglaubt wird." – Das ist die Welt der Lüge und des Misstrauens, von der uns die Kämpfer für eine totale Transparenz befreien wollen.
Nun aber kommt das Entscheidende: Ihre Position hat sich schon beim Wahlrecht nirgendwo durchgesetzt. Die Menschen wollten überall auf der Welt geheime Wahlen haben, keine offenen. Und wenn schon in diesem Mikrobereich die Mehrheit so deutlich Nein sagt – woher nehmen Assange und Konsorten dann die Chuzpe, sich als universale Freiheitshelden aufzuspielen? Sie basiert wohl auf ihrer eigenen Freiheit von Erkenntnissen.
"Würde es Sie nervös machen oder beruhigen, wenn das Haus Ihres Nachbarn durchsichtig wäre, und Sie ihm zusehen könnten, wie er seine Waffensammlung poliert?”, fragte kurz vor dem ersten Wikileaks-Anschlag der amerikanische Publizist Joshua Cooper Ramo und führte dann eine Studie auf, derzufolge Konflikte zwischen Staaten umso schneller eskalieren, je mehr Informationen die beiden Seiten voneinander besitzen: Wissen macht nicht gelassener, sondern unberechenbar.
Wem das unglaubwürdig erscheint, der bekommt die gleiche Botschaft in kleiner Münze noch deutlicher ausgezahlt: Britische Psychologen stellten in einer Neubausiedlung fest, dass Bewohner von Erdgeschosswohnungen überdurchschnittlich oft psychisch erkrankten. Als man die Fußwege in der Siedlung sperrte und nur noch enge Nachbarn an den Fenstern vorbeikamen, sank die Rate um 25 Prozent.
Wir lernen: Erzwungene Öffentlichkeit bedeutet Stress. Wer andere bloßstellt, gehört demnach nicht aufs Heldenpodest, sondern gerechterweise selbst an den Pranger. Und damit wäre er noch milde behandelt.
Florian Felix Weyh, geboren 1963, lebt als Autor und Publizist in Berlin. Preise und Stipendien für Drama, Prosa und Essay; seit 1988 arbeitet er regelmäßig als Literaturkritiker für den Deutschlandfunk. Sein jüngstes Buch "Die letzte Wahl – Therapien für die leidende Demokratie" erschien 2007 in der Anderen Bibliothek. Verstreute Texte und weitere Informationen zur Person sind auf www.weyh.info zu finden.

Florian Felix Weyh, Schriftsteller und freier Journalist in Berlin© Katharina Meinel