Vom Einserjuristen zum Staatsoberhaupt
Rezensiert von Wolfgang Herles · 02.03.2007
Roman Herzog blickt in seinen Erinnerungen auf eine steile Karriere zurück: Seine Laufbahn führte ihn bis in das höchste politische Amt Deutschlands. Als Bundespräsident bleibt er vor allem wegen seiner "Ruck-Rede" in Erinnerung. In seinen Memoiren bietet Herzog zahlreiche Anekdoten und Erzählungen, ein Blick hinter die Kulissen der großen Politik gewährt er dem Leser jedoch nicht.
Roman Herzogs Erinnerungen sind wie ein Hybridfahrzeug – also sehr modern. Das Buch besitzt sowohl einen Verbrennungs- wie einen Elektromotor. Reflexion und Essay sind das eine, Erzählung und Anekdote das andere. Sie wechseln sich einander ergänzend ab. Hybridmotoren sind sparsam. Bei Autos ist das ein Vorzug, bei Memoiren hingegen eher ein Nachteil. Denn keiner der beiden Antriebsarten kommt voll auf Touren. Um es gleich vorweg zu sagen: Als Selbstporträt eines eigenwilligen, geistreichen und sympathischen Charakters in der Politik besitzt das Buch Stärken. Als historisches Quellenwerk, als genauer Blick hinter die Kulissen hingegen zeigt es Schwächen. Zu vieles wird nicht ausgesprochen. Herzog fühlt sich, wie er selber einräumt, "in den interessantesten Fragen zur Vertraulichkeit" verpflichtet.
Er ist auch nicht bereit, die Figuren der Weltgeschichte zu porträtieren, denen er begegnet. Sein zu spöttischer Abschätzung fähiger Blick bleibt leider ungenutzt. Weder Königin Elisabeth, die er "für eine absolut singuläre Erscheinung unter den Staatsoberhäuptern" hält, noch Präsident Clinton werden ausführlich geschildert, obwohl er mit ihm eine "ernsthafte Meinungsverschiedenheit" über den EU-Beitritt der Türkei austrug.
"Man kann sich vorstellen, dass die Diskussion rasch hohe Wellen schlug. Zur Übereinstimmung kamen wir nicht, aber die Gesprächspartner respektierten immerhin meine Schlussbemerkung: ‚Sie können sagen, was Sie wollen, aber über das Schicksal meiner Kinder und Enkel entscheidet in Brüssel keiner mit, der nicht einmal im Stande ist, seine Gefängnisse in Ordnung zu halten.’"
Solche Stellen sind die Ausnahme. Häufiger ist Herzogs Zurückhaltung ärgerlich. Sein akademischer Lehrer Theodor Maunz, Mentor seiner rasanten wissenschaftlichen Karriere, Co-Autor als Grundgesetz-Kommentator, Bayerns Kultusminister, entpuppte sich als Nazi und Unterstützer der rechtsradikalen Szene. Herzog, seinerzeit empört, blendet das Thema in seinen Erinnerungen aus.
Kein Wort mehr als unbedingt nötig fällt auch über Helmut Kohl. Dabei ist es Kohl, der den jungen Professor an der Verwaltungshochschule in Speyer in die Politik holt, so wie Kohl damals eine ganze Reihe exzellenter Seiteneinsteiger akquirierte, auch Herzogs Vorgänger Richard von Weizsäcker. Das "System Kohl" – Herzog hätte es gewiss treffend beschreiben können. Aber er mag nicht. Unkonventionell und doch zugleich auch anpassungsfähig zu sein – erklärt das die seltsam geradlinige, niederlagenfreie politische Karriere Herzogs? Sie ist gewissermaßen eine dreistufige Torte. Den eher trockenen, aber soliden Boden bilden die drei landespolitischen Ämter: Rheinland-pfälzischer Landesbevollmächtigter in Bonn, Kultus- und Innenminister in Baden-Württemberg. Dann kommt schon die Schokolade: Präsident des Bundesverfassungsgerichts. Schließlich ganz oben die dicke Sahne: Bundespräsident. Es wäre vermessen, abzustreiten, dass Herzog eine Extraportion Glück gehabt hat im Leben. Aber eben nicht mehr Glück als Verstand, sondern zum Glück kommt immer auch eine Extraportion Verstand hinzu. Sein Ehrgeiz wird gebändigt von einer Vielfalt intellektueller Interessen. Seine innere Unabhängigkeit prädestiniert ihn für die höchsten überparteilichen Ämter. Er habe, erzählt Herzog gern, wie ein Geißeltierchen gehandelt, das im warmen Wasser liegt und seine Fangarme spielen lässt. Wenn etwas Interessantes vorbeikommt, schlägt es zu. Im Elternhaus scheint dieser tatkräftige Eigensinn angelegt worden zu sein. Der Vater Herzogs war leitender Angestellten einer Schnupftabakfabrik im niederbayerischen Landshut, der es mit autodidaktischer Dickköpfigkeit zum Museumsdirektor und Stadtarchivar brachte.
In welches Amt er auch immer gehoben wird: Herzog kann es nicht mit dem in Deutschland üblichen Bierernst ausüben. Das ist sein Vorzug. Er bleibt, auch als Parteipolitiker Wissenschaftler. Er selbst sieht die Jahre am Bundesverfassungsgericht als erfolgreichen Versuch, von der Politik wieder loszukommen. Und als er zwölf Jahre später zum Staatsoberhaupt gewählt wird, ist sein Ehrgeiz mehr als gestillt, wie er schreibt. Er kommt zum Zug, weil der zuerst nominierte Kandidat der Union, der sächsische Justizminister Heitmann, die anschwellende Kritik an seiner Person nicht länger aushält und zurückzieht. Wie immer, gerät auch diesmal die Wahl des Bundespräsidenten zum parteipolitischen Schauspiel. Und siehe da: Der davon angeblich so unberührbare Herzog führt darüber ein eigenes Tagebuch. Er erläutert genau, in welchem Wahlgang er warum wie viele Stimmen bekommen, beziehungsweise nicht bekommen hat. Selbst eine Bemerkung wie die, totale Siege möge er nicht, selbst, wenn er sie selbst einfahre, verrät dann doch etwas von der ganz eigenen Selbstgefälligkeit des erfolgsverwöhnten Einserjuristen.
"Unverkrampft" lautet eines seiner Schlüsselworte. Unverkrampft, aber durchaus entschieden, widmet sich Herzog dem zentralen Thema seiner nur vierjährigen Präsidentschaft: der Verkrampftheit seines Landes. Er hält nicht nur die eine berühmte "Ruckrede". Die Jahre im Amt sind eine einzige, und auch seine Erinnerungen wollen dem Land noch Beine machen.
"Wenn man aber sieht, dass das Parteiensystem des Landes (und übrigens auch die Wehleidigkeit der Nation) das rechtzeitige und intensive Aufgreifen absehbarer Probleme verhindern, muss man sich als Staatsoberhaupt doch wirklich die Frage stellen, ob man dann nicht – gewissermaßen als letzter Rufer – verpflichtet ist, an die Glocke zu schlagen."
In diesem Sinne geht es Herzog, dem früheren Kultusminister, stets auch um die Moderne als ein Großprojekt der Volksbildung. Früher, durchaus zum Missvergnügen der Berufspädagogen, vertrat er die Ansicht, es komme nicht darauf an, was in der Schule gelernt werde, sondern darauf, was die Schüler davon beim Verlassen der Schule noch wüssten. Jetzt, als Präsident, hält er die Popularisierung der Technik für eine Voraussetzung des ökonomischen Aufbruchs. Aber die Deutschen kennen ja nicht einmal den Erfinder des Computers, wie Herzog beklagt, obwohl der ein Deutscher ist: Konrad Zuse.
"Als ich ihm kurz vor seinem Tod wenigstens noch das Große Bundesverdienstkreuz mit Stern und Schulterband verlieh, war das nur wenigen Zeitungen eine kurze Notiz wert. Wenn aber eine Jodel-Prinzessin aus Hollywood in einem beliebigen Wettbewerb den fünften Platz belegt, dann sind die Gazetten voll davon. Schon daran sieht man den Unterschied zwischen den Völkern, und daran erkennt man schlaglichtartig auch, warum Deutschland im internationalen Wettbewerb immer weiter in Rückstand gerät: Weder das Volk noch seine Medien haben begriffen, worauf es in dieser auf Konkurrenz angelegten Welt ankommt."
Ausführlich kommentiert Herzog die wesentlichen Konfliktstoffe der Gegenwart. Religiosität und Fundamentalismus, die Notwendigkeit einer Weltinnenpolitik, der Kampf ums Öl. Er skizziert Überlebensstrategien Deutschlands. Dabei kommt er immer wieder auf die Kernfrage. Wie können Mut- und Antriebslosigkeit der Deutschen überwunden werden. Seine Antwort lautet: "Freiheit und Initiative". Hier erweist sich der konservative Staatsrechtsprofessor als echter Liberaler. Nicht der Staat kann das Defizit beseitigen, sondern nur eine offene Gesellschaft, in der sich möglichst viele am Aufspüren der Bedürfnisse wie an ihrer Befriedigung beteiligen. Für Marktwirtschaft und Dezentralisierung plädiert Herzog, nicht für den vorsorgenden Sozialstaat. Man darf diese "Erinnerungen" durchaus auch als Kritik an der Großen Koalition lesen.
Ein herzoglicher Erinnerungsband ohne witzige Anekdoten wäre wahrlich unvollständig. Der Autor baut sie nicht in die Erzählung seiner politischen Laufbahn ein. Vielmehr dienen zahlreiche kurze Abschnitte der unterhaltsamen Unterbrechung. "Apropos" heißt es insgesamt siebzehn Mal, immer am Ende eines größeren Kapitels.
Zum Beispiel: "Apropos. Mordwaffe Orden".
"Aber dann geschah es: Als er mir den Stern an die Brust heften musste, tat er das mit besonderer Intensität. Er stach die Nadel, die den Stern halten sollte, durch den Stoff meines Fracks, der nicht gerade dünn war, dann durch das Frackhemd. Auch das hätte sich noch durchaus im Rahmen des Üblichen gehalten, aber damit ließ er es nicht bewenden, sondern stach weiter – durch die Brusthaut. Während dieser Prozedur hatte ich keinen Gesichtsmuskel verzogen und mich wohl auch sonst nicht erkennbar bewegt. Nur begann ich nunmehr immer öfter zwischen Frack und Frackhemd zu schielen – schließlich musste ich ja wissen, ob sich da nicht allmählich ein Blutfleck zeigte; denn wenn dieser durch den Stoff des Fracks gedrungen wäre, hätte die Sache peinlich werden können. Gott sei Dank war aber kein Blutfleck zu sehen – um die Durchblutung der männlichen Brust scheint es nicht allzu gut bestellt zu sein."
Aber auch hier verrät uns Herzog nicht, von wem und wo seine Schmerzempfindlichkeit derart auf die Probe gestellt wurde.
Roman Herzog: Jahre der Politik - Die Erinnerungen
Siedler Verlag, München 2007
Er ist auch nicht bereit, die Figuren der Weltgeschichte zu porträtieren, denen er begegnet. Sein zu spöttischer Abschätzung fähiger Blick bleibt leider ungenutzt. Weder Königin Elisabeth, die er "für eine absolut singuläre Erscheinung unter den Staatsoberhäuptern" hält, noch Präsident Clinton werden ausführlich geschildert, obwohl er mit ihm eine "ernsthafte Meinungsverschiedenheit" über den EU-Beitritt der Türkei austrug.
"Man kann sich vorstellen, dass die Diskussion rasch hohe Wellen schlug. Zur Übereinstimmung kamen wir nicht, aber die Gesprächspartner respektierten immerhin meine Schlussbemerkung: ‚Sie können sagen, was Sie wollen, aber über das Schicksal meiner Kinder und Enkel entscheidet in Brüssel keiner mit, der nicht einmal im Stande ist, seine Gefängnisse in Ordnung zu halten.’"
Solche Stellen sind die Ausnahme. Häufiger ist Herzogs Zurückhaltung ärgerlich. Sein akademischer Lehrer Theodor Maunz, Mentor seiner rasanten wissenschaftlichen Karriere, Co-Autor als Grundgesetz-Kommentator, Bayerns Kultusminister, entpuppte sich als Nazi und Unterstützer der rechtsradikalen Szene. Herzog, seinerzeit empört, blendet das Thema in seinen Erinnerungen aus.
Kein Wort mehr als unbedingt nötig fällt auch über Helmut Kohl. Dabei ist es Kohl, der den jungen Professor an der Verwaltungshochschule in Speyer in die Politik holt, so wie Kohl damals eine ganze Reihe exzellenter Seiteneinsteiger akquirierte, auch Herzogs Vorgänger Richard von Weizsäcker. Das "System Kohl" – Herzog hätte es gewiss treffend beschreiben können. Aber er mag nicht. Unkonventionell und doch zugleich auch anpassungsfähig zu sein – erklärt das die seltsam geradlinige, niederlagenfreie politische Karriere Herzogs? Sie ist gewissermaßen eine dreistufige Torte. Den eher trockenen, aber soliden Boden bilden die drei landespolitischen Ämter: Rheinland-pfälzischer Landesbevollmächtigter in Bonn, Kultus- und Innenminister in Baden-Württemberg. Dann kommt schon die Schokolade: Präsident des Bundesverfassungsgerichts. Schließlich ganz oben die dicke Sahne: Bundespräsident. Es wäre vermessen, abzustreiten, dass Herzog eine Extraportion Glück gehabt hat im Leben. Aber eben nicht mehr Glück als Verstand, sondern zum Glück kommt immer auch eine Extraportion Verstand hinzu. Sein Ehrgeiz wird gebändigt von einer Vielfalt intellektueller Interessen. Seine innere Unabhängigkeit prädestiniert ihn für die höchsten überparteilichen Ämter. Er habe, erzählt Herzog gern, wie ein Geißeltierchen gehandelt, das im warmen Wasser liegt und seine Fangarme spielen lässt. Wenn etwas Interessantes vorbeikommt, schlägt es zu. Im Elternhaus scheint dieser tatkräftige Eigensinn angelegt worden zu sein. Der Vater Herzogs war leitender Angestellten einer Schnupftabakfabrik im niederbayerischen Landshut, der es mit autodidaktischer Dickköpfigkeit zum Museumsdirektor und Stadtarchivar brachte.
In welches Amt er auch immer gehoben wird: Herzog kann es nicht mit dem in Deutschland üblichen Bierernst ausüben. Das ist sein Vorzug. Er bleibt, auch als Parteipolitiker Wissenschaftler. Er selbst sieht die Jahre am Bundesverfassungsgericht als erfolgreichen Versuch, von der Politik wieder loszukommen. Und als er zwölf Jahre später zum Staatsoberhaupt gewählt wird, ist sein Ehrgeiz mehr als gestillt, wie er schreibt. Er kommt zum Zug, weil der zuerst nominierte Kandidat der Union, der sächsische Justizminister Heitmann, die anschwellende Kritik an seiner Person nicht länger aushält und zurückzieht. Wie immer, gerät auch diesmal die Wahl des Bundespräsidenten zum parteipolitischen Schauspiel. Und siehe da: Der davon angeblich so unberührbare Herzog führt darüber ein eigenes Tagebuch. Er erläutert genau, in welchem Wahlgang er warum wie viele Stimmen bekommen, beziehungsweise nicht bekommen hat. Selbst eine Bemerkung wie die, totale Siege möge er nicht, selbst, wenn er sie selbst einfahre, verrät dann doch etwas von der ganz eigenen Selbstgefälligkeit des erfolgsverwöhnten Einserjuristen.
"Unverkrampft" lautet eines seiner Schlüsselworte. Unverkrampft, aber durchaus entschieden, widmet sich Herzog dem zentralen Thema seiner nur vierjährigen Präsidentschaft: der Verkrampftheit seines Landes. Er hält nicht nur die eine berühmte "Ruckrede". Die Jahre im Amt sind eine einzige, und auch seine Erinnerungen wollen dem Land noch Beine machen.
"Wenn man aber sieht, dass das Parteiensystem des Landes (und übrigens auch die Wehleidigkeit der Nation) das rechtzeitige und intensive Aufgreifen absehbarer Probleme verhindern, muss man sich als Staatsoberhaupt doch wirklich die Frage stellen, ob man dann nicht – gewissermaßen als letzter Rufer – verpflichtet ist, an die Glocke zu schlagen."
In diesem Sinne geht es Herzog, dem früheren Kultusminister, stets auch um die Moderne als ein Großprojekt der Volksbildung. Früher, durchaus zum Missvergnügen der Berufspädagogen, vertrat er die Ansicht, es komme nicht darauf an, was in der Schule gelernt werde, sondern darauf, was die Schüler davon beim Verlassen der Schule noch wüssten. Jetzt, als Präsident, hält er die Popularisierung der Technik für eine Voraussetzung des ökonomischen Aufbruchs. Aber die Deutschen kennen ja nicht einmal den Erfinder des Computers, wie Herzog beklagt, obwohl der ein Deutscher ist: Konrad Zuse.
"Als ich ihm kurz vor seinem Tod wenigstens noch das Große Bundesverdienstkreuz mit Stern und Schulterband verlieh, war das nur wenigen Zeitungen eine kurze Notiz wert. Wenn aber eine Jodel-Prinzessin aus Hollywood in einem beliebigen Wettbewerb den fünften Platz belegt, dann sind die Gazetten voll davon. Schon daran sieht man den Unterschied zwischen den Völkern, und daran erkennt man schlaglichtartig auch, warum Deutschland im internationalen Wettbewerb immer weiter in Rückstand gerät: Weder das Volk noch seine Medien haben begriffen, worauf es in dieser auf Konkurrenz angelegten Welt ankommt."
Ausführlich kommentiert Herzog die wesentlichen Konfliktstoffe der Gegenwart. Religiosität und Fundamentalismus, die Notwendigkeit einer Weltinnenpolitik, der Kampf ums Öl. Er skizziert Überlebensstrategien Deutschlands. Dabei kommt er immer wieder auf die Kernfrage. Wie können Mut- und Antriebslosigkeit der Deutschen überwunden werden. Seine Antwort lautet: "Freiheit und Initiative". Hier erweist sich der konservative Staatsrechtsprofessor als echter Liberaler. Nicht der Staat kann das Defizit beseitigen, sondern nur eine offene Gesellschaft, in der sich möglichst viele am Aufspüren der Bedürfnisse wie an ihrer Befriedigung beteiligen. Für Marktwirtschaft und Dezentralisierung plädiert Herzog, nicht für den vorsorgenden Sozialstaat. Man darf diese "Erinnerungen" durchaus auch als Kritik an der Großen Koalition lesen.
Ein herzoglicher Erinnerungsband ohne witzige Anekdoten wäre wahrlich unvollständig. Der Autor baut sie nicht in die Erzählung seiner politischen Laufbahn ein. Vielmehr dienen zahlreiche kurze Abschnitte der unterhaltsamen Unterbrechung. "Apropos" heißt es insgesamt siebzehn Mal, immer am Ende eines größeren Kapitels.
Zum Beispiel: "Apropos. Mordwaffe Orden".
"Aber dann geschah es: Als er mir den Stern an die Brust heften musste, tat er das mit besonderer Intensität. Er stach die Nadel, die den Stern halten sollte, durch den Stoff meines Fracks, der nicht gerade dünn war, dann durch das Frackhemd. Auch das hätte sich noch durchaus im Rahmen des Üblichen gehalten, aber damit ließ er es nicht bewenden, sondern stach weiter – durch die Brusthaut. Während dieser Prozedur hatte ich keinen Gesichtsmuskel verzogen und mich wohl auch sonst nicht erkennbar bewegt. Nur begann ich nunmehr immer öfter zwischen Frack und Frackhemd zu schielen – schließlich musste ich ja wissen, ob sich da nicht allmählich ein Blutfleck zeigte; denn wenn dieser durch den Stoff des Fracks gedrungen wäre, hätte die Sache peinlich werden können. Gott sei Dank war aber kein Blutfleck zu sehen – um die Durchblutung der männlichen Brust scheint es nicht allzu gut bestellt zu sein."
Aber auch hier verrät uns Herzog nicht, von wem und wo seine Schmerzempfindlichkeit derart auf die Probe gestellt wurde.
Roman Herzog: Jahre der Politik - Die Erinnerungen
Siedler Verlag, München 2007
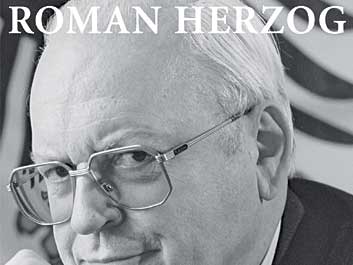
Roman Herzog: Jahre der Politik© Siedler Verlag