Vermeintliches Enthüllungsbuch
James Risens "State of War" besteht, wie sämtliche Sensationsbücher angeblich investigativer amerikanischer Journalisten, zu 90 Prozent aus Geschichten, wie sie jeder Zeitungsleser kennt. Für die restlichen zehn Prozent greift der Autor auf ausschließlich namenlose Informanten zurück und nimmt damit seinen Lesern jede Möglichkeit, die Wahrheit dessen, was sie lesen, zu überprüfen.
"Geheimdienste heißen Geheimdienste, weil ihre Arbeit geheim ist", meint George W. Bush. Der Präsident irrt. Geheimdienste heißen Geheimdienste, weil ihre Mitarbeiter ständig Dienstgeheimnisse ausplaudern. Diesen Eindruck muss man jedenfalls bekommen, wenn man das Buch des "New York Times"-Reporters James Risen liest.
Natürlich besteht auch dieses, wie alle Sensationsbücher angeblich investigativer amerikanischer Journalisten, zu 90 Prozent und mehr eben nicht aus geheimer Geschichte, sondern aus Geschichten, wie sie jeder Zeitungsleser kennt. Risen schildert, wie die CIA vor den Anschlägen des 11. September, vor dem Irak-Krieg, bei der Jagd auf Osama bin Laden in Afghanistan und beim Ausspionieren des iranischen Atomprogramms schlicht und einfach versagt hat. Die CIA ist offensichtlich eine schrecklich unfähige Organisation.
"So what else is new?" möchte man fragen. Schließlich hat es die CIA schon unter John F. Kennedy weder geschafft, Kuba durch die Invasion in der Schweinebucht zu befreien, noch Fidel Castro durch explodierende Zigarren zu ermorden; sie wurde 1989 vom Fall der Berliner Mauer ebenso überrascht wie 1998 von der indischen Atombombe.
Um das zu wissen, muss man kein Enthüllungsbuch kaufen. Wenden wir uns also den zehn Prozent zu, die man nicht in der Zeitung lesen kann, zum Beispiel dieser Szene aus dem Weißen Haus:
"Präsident George W. Bush legte wütend den Hörer auf und beendete kurzerhand ein unerfreuliches Gespräch mit seinem Vater George Herbert Walker Bush, dem ehemaligen Präsidenten der USA. Man schrieb das Jahr 2003, und der Streit zwischen dem einundvierzigsten und dem dreiundvierzigsten Präsidenten der Vereinigten Staaten bildete den Höhepunkt eines seit langem schwelenden Konflikts zwischen Vater und Sohn, eines Konflikts, über den sie strengstes Stillschweigen wahrten."
Woher weiß also Risen von dieser Unterhaltung? Er weiß eben nichts. Und etwas später räumt er ein:
"Die genauen Einzelheiten des Gesprächs sind natürlich nur den beiden Beteiligten bekannt..."
Eben. Aber das hindert Risen nicht, solche angeblichen Gespräche immer wieder als Beweismittel für bestimmte Thesen anzuführen. Ein weiteres Beispiel: Risen will nachweisen, dass George W. Bush persönlich den Befehl zum Foltern gefangener Al-Quaida-Mitglieder gegeben habe. Als Beweis führt Risen ein vertrauliches Gespräch zwischen dem Präsidenten und dem damaligen CIA-Direktor George Tenet an. Es geht dabei um das Verhör des Terroristen Abu Subaida.
"Tenet sagte, man habe noch nichts erfahren, weil Abu Subaida so schwer verwundet sei, dass er mit starken Medikamenten behandelt werde. Er sei durch die Schmerzmittel zu benommen und spreche keine zusammenhängenden Sätze. Bush wandte sich an Tenet und fragte: "Wer hat denn genehmigt, dass er Schmerzmittel bekommt?"... Ermutigte der Präsident der Vereinigten Staaten den CIA-Chef auf verkappte Weise, eine Misshandlung des Gefangenen anzuordnen? Wenn ja, dann wäre das die direkteste Verbindung zwischen Bush und der Misshandlung von Gefangenen durch die CIA und das amerikanische Militär."
Das kann man so sehen. Doch eine Seite später lesen wir:
"Dass überhaupt ein derartiges Gespräch zwischen Bush und Tenet stattfand, wird von einigen ranghohen Mitarbeitern Tenets angezweifelt... Mehrere ehemalige CIA-Beamte betonen auch, dass Abu Subaida eine erstklassige medizinische Betreuung erhielt..."
Man beachte jedoch: Das Gespräch, für das es ebenso wenige Zeugen gibt wie für das Telefongespräch zwischen Bush Vater und Bush Sohn, wird im Indikativ wiedergegeben: als Tatsache.
Semper aliquod haeret, wussten die Römer schon. Man schmeiße nur mit Dreck: Etwas bleibt immer hängen.
Und hier wird reichlich mit Dreck geworfen. Das Ziel sind die üblichen Verdächtigen, die Buhmänner des linksliberalen Kommentariats: Neben Bush vor allem Rumsfeld und Cheney, Wolfowitz und Perle – die konservativen Hardliner und ihre jüdisch-neokonservativen Einflüsterer, die auf die wahnwitzige Idee gekommen sind, auch Amerikas Feinden die Demokratie zu bringen. Die da schmeißen, sind – ja, wer eigentlich? Erst auf der vorletzten Seite lässt Risen für Eingeweihte die Katze aus dem Sack. Da heißt es:
"Der Aufstieg der Neokonservativen zur Macht war sicherlich die überraschendste Entwicklung der Bush-Administration. Er verblüffte und peinigte die Gemäßigten unter den Republikanern. ... Während des Präsidentschaftswahlkampfs 2004 war von den meisten dieser moderaten Republikaner allerdings nichts zu hören. Brent Scowcroft war die einzige nennenswerte Ausnahme. Er war Sicherheitsberater von Bush Senior gewesen..."
Scowcroft hatte eine jüdische Verschwörung entdeckt:
"Er befürchte, sagte er, George Bush sei vom israelischen Premier Ariel Scharon "eingelullt" worden. ... Für diese Offenheit wurde er vom Weißen Haus geächtet und verlor den einzigen kleinen Posten, den er in der Regierung besessen hatte: den Vorsitz über die Beratungsstelle für Außenerklärung."
Dieses Buch ist Scowcrofts Rache. Dagegen ist nichts zu sagen. Viel ist dagegen zu sagen, dass Scowcroft nirgends als Risens wichtigste, vielleicht einzige Quelle genannt wird. Stattdessen müssen wir uns auf anonyme Insider verlassen und auf die Aufrichtigkeit eines Reporters, der sich als Ghostwriter eines beleidigten Politikers verdingt hat.
Wie sagt Risen:
"In letzter Zeit wird immer öfter die Verwendung von anonymen Quellen kritisiert. Doch jeder Journalist weiß, dass man für die besten Geschichten, die brisantesten und vertraulichsten Themen auf anonyme Informanten angewiesen ist."
Jeder Journalist lernt aber auch, dass man anonymen Quellen nicht trauen darf. Dass man Informationen, die man anonym erhält, durch Nachfragen bei legitimen Quellen verifizieren muss. Das ist das ABC der Journalistenschule. Welchen Wert zum Beispiel hat eine Abrechnung mit der CIA-Arbeit im Irak, wenn man weiß, dass die Quelle ein Mann ist, der wegen seiner Verbindung zum Abu-Ghraib-Skandal von seinem Posten abgelöst wurde?
Ein Autor, der ausschließlich mit namenlosen Informanten arbeitet, nimmt seinen Lesern jede Möglichkeit, die Wahrheit dessen, was sie lesen, zu überprüfen. Der Leser wird entmündigt, manipuliert, für dumm verkauft.
Solches Vorgehen galt der Linken in Deutschland immer als Kennzeichen der BILD-Zeitung und der politischen Rechten. Dass heute ein seriöser Verlag wie Hoffmann und Campe in der Hoffnung auf ein unkritisches, in erster Linie linkes Leserpotential ein derart fragwürdiges Machwerk druckt, sagt einiges darüber aus, wie die politische Kultur in Deutschland auf den Hund gekommen ist.
James Risen: State of War
Die geheime Geschichte der CIA und der Bush-Administration
Aus dem Amerikanischen von Norbert Juraschitz, Friedrich Pflüger, Heike Schlatterer
Hoffmann und Campe Verlag. Hamburg 2006
Natürlich besteht auch dieses, wie alle Sensationsbücher angeblich investigativer amerikanischer Journalisten, zu 90 Prozent und mehr eben nicht aus geheimer Geschichte, sondern aus Geschichten, wie sie jeder Zeitungsleser kennt. Risen schildert, wie die CIA vor den Anschlägen des 11. September, vor dem Irak-Krieg, bei der Jagd auf Osama bin Laden in Afghanistan und beim Ausspionieren des iranischen Atomprogramms schlicht und einfach versagt hat. Die CIA ist offensichtlich eine schrecklich unfähige Organisation.
"So what else is new?" möchte man fragen. Schließlich hat es die CIA schon unter John F. Kennedy weder geschafft, Kuba durch die Invasion in der Schweinebucht zu befreien, noch Fidel Castro durch explodierende Zigarren zu ermorden; sie wurde 1989 vom Fall der Berliner Mauer ebenso überrascht wie 1998 von der indischen Atombombe.
Um das zu wissen, muss man kein Enthüllungsbuch kaufen. Wenden wir uns also den zehn Prozent zu, die man nicht in der Zeitung lesen kann, zum Beispiel dieser Szene aus dem Weißen Haus:
"Präsident George W. Bush legte wütend den Hörer auf und beendete kurzerhand ein unerfreuliches Gespräch mit seinem Vater George Herbert Walker Bush, dem ehemaligen Präsidenten der USA. Man schrieb das Jahr 2003, und der Streit zwischen dem einundvierzigsten und dem dreiundvierzigsten Präsidenten der Vereinigten Staaten bildete den Höhepunkt eines seit langem schwelenden Konflikts zwischen Vater und Sohn, eines Konflikts, über den sie strengstes Stillschweigen wahrten."
Woher weiß also Risen von dieser Unterhaltung? Er weiß eben nichts. Und etwas später räumt er ein:
"Die genauen Einzelheiten des Gesprächs sind natürlich nur den beiden Beteiligten bekannt..."
Eben. Aber das hindert Risen nicht, solche angeblichen Gespräche immer wieder als Beweismittel für bestimmte Thesen anzuführen. Ein weiteres Beispiel: Risen will nachweisen, dass George W. Bush persönlich den Befehl zum Foltern gefangener Al-Quaida-Mitglieder gegeben habe. Als Beweis führt Risen ein vertrauliches Gespräch zwischen dem Präsidenten und dem damaligen CIA-Direktor George Tenet an. Es geht dabei um das Verhör des Terroristen Abu Subaida.
"Tenet sagte, man habe noch nichts erfahren, weil Abu Subaida so schwer verwundet sei, dass er mit starken Medikamenten behandelt werde. Er sei durch die Schmerzmittel zu benommen und spreche keine zusammenhängenden Sätze. Bush wandte sich an Tenet und fragte: "Wer hat denn genehmigt, dass er Schmerzmittel bekommt?"... Ermutigte der Präsident der Vereinigten Staaten den CIA-Chef auf verkappte Weise, eine Misshandlung des Gefangenen anzuordnen? Wenn ja, dann wäre das die direkteste Verbindung zwischen Bush und der Misshandlung von Gefangenen durch die CIA und das amerikanische Militär."
Das kann man so sehen. Doch eine Seite später lesen wir:
"Dass überhaupt ein derartiges Gespräch zwischen Bush und Tenet stattfand, wird von einigen ranghohen Mitarbeitern Tenets angezweifelt... Mehrere ehemalige CIA-Beamte betonen auch, dass Abu Subaida eine erstklassige medizinische Betreuung erhielt..."
Man beachte jedoch: Das Gespräch, für das es ebenso wenige Zeugen gibt wie für das Telefongespräch zwischen Bush Vater und Bush Sohn, wird im Indikativ wiedergegeben: als Tatsache.
Semper aliquod haeret, wussten die Römer schon. Man schmeiße nur mit Dreck: Etwas bleibt immer hängen.
Und hier wird reichlich mit Dreck geworfen. Das Ziel sind die üblichen Verdächtigen, die Buhmänner des linksliberalen Kommentariats: Neben Bush vor allem Rumsfeld und Cheney, Wolfowitz und Perle – die konservativen Hardliner und ihre jüdisch-neokonservativen Einflüsterer, die auf die wahnwitzige Idee gekommen sind, auch Amerikas Feinden die Demokratie zu bringen. Die da schmeißen, sind – ja, wer eigentlich? Erst auf der vorletzten Seite lässt Risen für Eingeweihte die Katze aus dem Sack. Da heißt es:
"Der Aufstieg der Neokonservativen zur Macht war sicherlich die überraschendste Entwicklung der Bush-Administration. Er verblüffte und peinigte die Gemäßigten unter den Republikanern. ... Während des Präsidentschaftswahlkampfs 2004 war von den meisten dieser moderaten Republikaner allerdings nichts zu hören. Brent Scowcroft war die einzige nennenswerte Ausnahme. Er war Sicherheitsberater von Bush Senior gewesen..."
Scowcroft hatte eine jüdische Verschwörung entdeckt:
"Er befürchte, sagte er, George Bush sei vom israelischen Premier Ariel Scharon "eingelullt" worden. ... Für diese Offenheit wurde er vom Weißen Haus geächtet und verlor den einzigen kleinen Posten, den er in der Regierung besessen hatte: den Vorsitz über die Beratungsstelle für Außenerklärung."
Dieses Buch ist Scowcrofts Rache. Dagegen ist nichts zu sagen. Viel ist dagegen zu sagen, dass Scowcroft nirgends als Risens wichtigste, vielleicht einzige Quelle genannt wird. Stattdessen müssen wir uns auf anonyme Insider verlassen und auf die Aufrichtigkeit eines Reporters, der sich als Ghostwriter eines beleidigten Politikers verdingt hat.
Wie sagt Risen:
"In letzter Zeit wird immer öfter die Verwendung von anonymen Quellen kritisiert. Doch jeder Journalist weiß, dass man für die besten Geschichten, die brisantesten und vertraulichsten Themen auf anonyme Informanten angewiesen ist."
Jeder Journalist lernt aber auch, dass man anonymen Quellen nicht trauen darf. Dass man Informationen, die man anonym erhält, durch Nachfragen bei legitimen Quellen verifizieren muss. Das ist das ABC der Journalistenschule. Welchen Wert zum Beispiel hat eine Abrechnung mit der CIA-Arbeit im Irak, wenn man weiß, dass die Quelle ein Mann ist, der wegen seiner Verbindung zum Abu-Ghraib-Skandal von seinem Posten abgelöst wurde?
Ein Autor, der ausschließlich mit namenlosen Informanten arbeitet, nimmt seinen Lesern jede Möglichkeit, die Wahrheit dessen, was sie lesen, zu überprüfen. Der Leser wird entmündigt, manipuliert, für dumm verkauft.
Solches Vorgehen galt der Linken in Deutschland immer als Kennzeichen der BILD-Zeitung und der politischen Rechten. Dass heute ein seriöser Verlag wie Hoffmann und Campe in der Hoffnung auf ein unkritisches, in erster Linie linkes Leserpotential ein derart fragwürdiges Machwerk druckt, sagt einiges darüber aus, wie die politische Kultur in Deutschland auf den Hund gekommen ist.
James Risen: State of War
Die geheime Geschichte der CIA und der Bush-Administration
Aus dem Amerikanischen von Norbert Juraschitz, Friedrich Pflüger, Heike Schlatterer
Hoffmann und Campe Verlag. Hamburg 2006
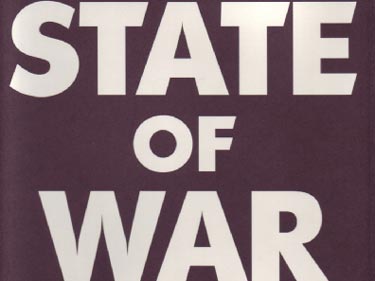
James Risen: "State of War" (Coverausschnitt)© Hoffmann und Campe Verlag