"Verbrechen war seine Rache an der Gesellschaft"
Jürgen Ritte, Literaturwissenschaftler an der Sorbonne, würdigt den französischen Schriftsteller Jean Genet. "Heute ist er im Pantheon der Klassiker angelangt", sagt Ritte.
Joachim Scholl: Susanne Burkhardt über Jean Genet, am kommenden Sonntag ist sein 100. Geburtstag. Aus einem Studio in Paris ist uns jetzt Jürgen Ritte zugeschaltet, er lehrt an der Sorbonne. Guten Tag, Herr Ritte!
Jürgen Ritte: Guten Tag, Herr Scholl!
Scholl: "Ich will den Mord besingen, da ich die Mörder liebe" heißt es in Jean Genets erstem Roman "Notre-Dames-des-Fleurs". Woher kommt eigentlich dieser Hang zum Verbrechertum bei Jean Genet?
Ritte: Na, woher kommt der, darüber kann man nur spekulieren. Wir wissen ja, dass Genet schon als Junge, als 14-Jähriger spätestens, Bekanntschaft mit der Kriminalität gemacht hat, kriminell geworden ist, das allerdings in Anführungszeichen, es geht ja immer nur um kleine Diebstähle.
Er hat das hinterher so erklärt, dass das seine Rache an der französischen Gesellschaft war, und über die französische Gesellschaft hinaus am Schicksal. Als Verlassener - als von den Eltern Ausgesetzter, der nie wusste, wie sein Vater hieß, den Namen seiner Mutter hatte er - hat er sich entschieden, sich auf die andere Seite zu schlagen, daher überhaupt seine Faszination für das Verbrechen. Das Verbrechen war seine Rache an der Gesellschaft.
Scholl: Er selbst wurde zig mal eingebuchtet, selbst als er schon berühmt war, ließ er das Mausen nicht. Wie wurde denn überhaupt aus diesem Kleinkriminellen ein Schriftsteller?
Ritte: Auch das ist ein Mysterium, war lange Zeit ein Mysterium. Man glaubte, Sartre, der in seinem großen Vorwort Genet als die Figur feierte, die sich selbst erfunden hat, geradezu spontan selbst geboren hat als Schriftsteller, wo also der Kleinkriminelle zum großen Autor wird.
Wir wissen inzwischen natürlich, dass Genet ein sehr guter Schüler war bis zu seinem 14. Lebensjahr, er war sogar Klassenbester, und er war ein gieriger Leser. Viele der Diebstähle, für die er eingebuchtet wurde, waren ja Bücherdiebstähle, Bücher, die er dann hinterher weiter vertickt hat. Jedenfalls war er ein permanenter Leser. Er hat vor allen Dingen in seinen frühen Jahren schon André Gide gelesen, das war in den 20er- und 30er-Jahren der große Star in der französischen Literatur, und war ja auch selbst ein bekennender Homosexueller.
Auch das wird ihn möglicherweise mit Gide in Verbindung gebracht haben. Auf jeden Fall haben wir dann auch Briefe, die sehr spät entdeckt worden sind, von Jean Genet, die er in den Jahren 36, 37 geschrieben hat, da war er kurzfristig so eine Art Hauslehrer in Brünn in der Tschechoslowakei. Wie er dorthin gekommen ist, ist auch wieder eine kleine Geschichte. Und diese Briefe sind von einer literarisch ganz hochwertigen Qualität und zeigen auch, wie informiert Genet über literarische Gegenwart war damals.
Scholl: Seine Romane werden beherrscht von einer offensiven Homosexualität. Es war damals unerhört, skandalös und machte ihn später auch zu einem Kultautor der Schwulenbewegung. Heute liest man das natürlich weitaus gelassener. Der amerikanische Biograf Edmund White hat mal geschrieben, Jean Genets Romane halten dem Leser ein Schwert vors Gesicht, keinen Spiegel. Trifft es das Ihrer Ansicht nach?
Ritte: Ja, so halb. Das Schwert, das er vors Gesicht hält, ist natürlich, dass von Genet nach wie vor gewisse Aggression ausgeht. Natürlich leben wir heute anders mit einem Autor, der sich auch in aggressiver Weise als Homosexueller bekennt. Das war damals übrigens, zu seiner Zeit, ja noch ein Verbrechen. Er ist ja eingebuchtet gewesen zuletzt während des Vichy-Regimes, das nicht sehr viel Verständnis hatte für Homosexuelle, wenn man es mal vornehm ausdrücken will.
Also es geht immer noch eine gewisse Aggressivität davon aus, weil es ja auch ganz deutliche Pornografie ist, und eine Pornografie, die häufig als Metapher benutzt wird. Er hat auch Hitler pornografisiert, wenn ich so sagen darf. Das ist die Seite Schwert, Aggression. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch durch die vielen Brechungen, metaphorischen Brechungen hindurch ein Spiegel unseres Gesellschaftszustands, der sich vielleicht allzu sehr, allzu schnell abfindet, arrangiert mit den Machtverhältnissen, in denen wir leben und von denen wir alle profitieren.
Scholl: Ganz wichtig für Jean Genets Ruhm war die Bekanntschaft mit Jean-Paul Sartre und Simon de Beauvoir. Was sahen denn diese hochgeistigen Intellektuellen in ihm?
Ritte: Na, ich glaube, sie haben vor allen Dingen – das ist bei Intellektuellen ja so üblich – etwas in ihn hineinprojiziert. Wie ich eben sagte, für Sartre war Genet ein geradezu Fallbeispiel für seine eigene Theorie von der Selbsterfindung des Menschen, von einem Akt der Freiheit. Das war das, was genau in die Zeit passte, ins existenzialistische Kolorit der 40er- und 50er-Jahre in Paris. Andere sahen in ihm einen Vertreter, einen hochrangigen Vertreter, einen Fortsetzer der doch sehr spezifisch französischen Tradition der (…), der verdammten Dichter.
Die geht ja weit zurück, das geht bis auf François Villon zurück, der Briefe sozusagen vom Galgenbaum hinunter schrieb, und es ging bis näher an Genet heran, bis zu (…) oder auch (…) - alles Autoren, die am Rande der Gesellschaft lebten, zum Teil gegen die Gesellschaft lebten, sich irgendwelcher Verbrechen – damals als Verbrechen geltender Vergehen – schuldig gemacht hatten. Also die französische literarische Öffentlichkeit hat seit jeher ein gewisses Faible für diese radikalen Außenseiter.
Scholl: Politisch hat Jean Genet in den Fünfzigern mit dem Kommunismus geliebäugelt, dann hat er die amerikanischen Black Panther unterstützt, später sich für die Palästinenser eingesetzt. Wie ist dieses politische Engagement des Schriftstellers einzuschätzen?
Ritte: Ähnlich zweischneidig wie manche Aspekte seines literarischen Werks. Er hat ja selbst gesagt, ich bin so lange auf der Seite der Black Panther, ich bin so lange auf der Seite der Palästinenser, solange sie unterdrückt werden, solange sie in Unterdrückung leben. In dem Moment, wo sie nun wirklich befreit wären und Macht bekämen, würde er sich desolidarisieren.
Das hat Genet sehr konsequent durchgeführt, er hat mit vielen politischen Oppositionsbewegungen sympathisiert, Sie haben gerade gesagt, in Frankreich waren es die Kommunisten, er unterstützte auch den Aufruf zum zivilen Ungehorsam, also zur Wehrdienstverweigerung unter anderem während des Algerienkriegs.
Da haben 121 Intellektuelle in einem berühmten Manifest zum Ungehorsam aufgerufen. Dem hat Genet damals nur seine mündliche Unterstützung gegeben, obwohl er eigentlich der Erste hätte sein müssen, die so etwas unterschreiben, aber das tat er nicht. Er hielt sich dann zuletzt immer raus. Für ihn war die Revolte eben auch eine, ja, eine ästhetische Revolte und eine Revolte, die sich nicht in irgendeiner Weise organisieren lässt.
Scholl: Freiheit, die sich vor nichts fürchtet und der Abscheu vor allem, was ihr Fesseln anlegt – so hat Simon de Beauvoir einmal so das Naturell von Jean Genet umrissen. Welchen Rang misst man heute Jean Genet zu in Frankreich?
Ritte: Heute ist er im Pantheon der Klassiker angelangt, das sieht man, wenn man jetzt in die Buchhandlungen geht in Paris, viele Neuerscheinungen, viele neue Biografien, Neuauflagen seiner Werke, Briefausgaben, die jetzt so nach und nach erst an die Oberfläche kommen. Viel ist anfangs nicht erhalten geblieben, manchmal findet man was mit etwas Glück. Alles das wird sehr (…) ediert und herausgegeben, Sonderausgaben von literarischen Zeitschriften, und Genet ist natürlich immer noch auf dem Spielplan französischer Bühnen, und vor allen Dingen, wenn man das als besonderes Kriterium des Angekommenseins werten will, ein Angekommensein, das Genet vielleicht gar nicht so gefallen hätte: Er ist natürlich auch an der Universität längst angekommen, Doktorarbeiten, Kolloquien, Sammelbände und so weiter.
Genet ist wirklich in den Kanon der französischen Literatur aufgenommen. Ich habe heute noch versucht, mich zu informieren über die Schulprogramme. Da findet man allerdings die Romane nicht, die homosexuelle Pornografie, die aggressive Form der Pornografie will man offenbar den Schülern noch nicht zumuten, aber seine Theaterstücke schon.
Scholl: Der französische Schriftsteller Jean Genet, am kommenden Sonntag jährt sich sein Geburtstag zum 100. Mal. Das war aus Paris Jürgen Ritte, er lehrt Literatur an der Sorbonne. Herzlichen Dank für das Gespräch!
Ritte: Bitte sehr!
Jürgen Ritte: Guten Tag, Herr Scholl!
Scholl: "Ich will den Mord besingen, da ich die Mörder liebe" heißt es in Jean Genets erstem Roman "Notre-Dames-des-Fleurs". Woher kommt eigentlich dieser Hang zum Verbrechertum bei Jean Genet?
Ritte: Na, woher kommt der, darüber kann man nur spekulieren. Wir wissen ja, dass Genet schon als Junge, als 14-Jähriger spätestens, Bekanntschaft mit der Kriminalität gemacht hat, kriminell geworden ist, das allerdings in Anführungszeichen, es geht ja immer nur um kleine Diebstähle.
Er hat das hinterher so erklärt, dass das seine Rache an der französischen Gesellschaft war, und über die französische Gesellschaft hinaus am Schicksal. Als Verlassener - als von den Eltern Ausgesetzter, der nie wusste, wie sein Vater hieß, den Namen seiner Mutter hatte er - hat er sich entschieden, sich auf die andere Seite zu schlagen, daher überhaupt seine Faszination für das Verbrechen. Das Verbrechen war seine Rache an der Gesellschaft.
Scholl: Er selbst wurde zig mal eingebuchtet, selbst als er schon berühmt war, ließ er das Mausen nicht. Wie wurde denn überhaupt aus diesem Kleinkriminellen ein Schriftsteller?
Ritte: Auch das ist ein Mysterium, war lange Zeit ein Mysterium. Man glaubte, Sartre, der in seinem großen Vorwort Genet als die Figur feierte, die sich selbst erfunden hat, geradezu spontan selbst geboren hat als Schriftsteller, wo also der Kleinkriminelle zum großen Autor wird.
Wir wissen inzwischen natürlich, dass Genet ein sehr guter Schüler war bis zu seinem 14. Lebensjahr, er war sogar Klassenbester, und er war ein gieriger Leser. Viele der Diebstähle, für die er eingebuchtet wurde, waren ja Bücherdiebstähle, Bücher, die er dann hinterher weiter vertickt hat. Jedenfalls war er ein permanenter Leser. Er hat vor allen Dingen in seinen frühen Jahren schon André Gide gelesen, das war in den 20er- und 30er-Jahren der große Star in der französischen Literatur, und war ja auch selbst ein bekennender Homosexueller.
Auch das wird ihn möglicherweise mit Gide in Verbindung gebracht haben. Auf jeden Fall haben wir dann auch Briefe, die sehr spät entdeckt worden sind, von Jean Genet, die er in den Jahren 36, 37 geschrieben hat, da war er kurzfristig so eine Art Hauslehrer in Brünn in der Tschechoslowakei. Wie er dorthin gekommen ist, ist auch wieder eine kleine Geschichte. Und diese Briefe sind von einer literarisch ganz hochwertigen Qualität und zeigen auch, wie informiert Genet über literarische Gegenwart war damals.
Scholl: Seine Romane werden beherrscht von einer offensiven Homosexualität. Es war damals unerhört, skandalös und machte ihn später auch zu einem Kultautor der Schwulenbewegung. Heute liest man das natürlich weitaus gelassener. Der amerikanische Biograf Edmund White hat mal geschrieben, Jean Genets Romane halten dem Leser ein Schwert vors Gesicht, keinen Spiegel. Trifft es das Ihrer Ansicht nach?
Ritte: Ja, so halb. Das Schwert, das er vors Gesicht hält, ist natürlich, dass von Genet nach wie vor gewisse Aggression ausgeht. Natürlich leben wir heute anders mit einem Autor, der sich auch in aggressiver Weise als Homosexueller bekennt. Das war damals übrigens, zu seiner Zeit, ja noch ein Verbrechen. Er ist ja eingebuchtet gewesen zuletzt während des Vichy-Regimes, das nicht sehr viel Verständnis hatte für Homosexuelle, wenn man es mal vornehm ausdrücken will.
Also es geht immer noch eine gewisse Aggressivität davon aus, weil es ja auch ganz deutliche Pornografie ist, und eine Pornografie, die häufig als Metapher benutzt wird. Er hat auch Hitler pornografisiert, wenn ich so sagen darf. Das ist die Seite Schwert, Aggression. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch durch die vielen Brechungen, metaphorischen Brechungen hindurch ein Spiegel unseres Gesellschaftszustands, der sich vielleicht allzu sehr, allzu schnell abfindet, arrangiert mit den Machtverhältnissen, in denen wir leben und von denen wir alle profitieren.
Scholl: Ganz wichtig für Jean Genets Ruhm war die Bekanntschaft mit Jean-Paul Sartre und Simon de Beauvoir. Was sahen denn diese hochgeistigen Intellektuellen in ihm?
Ritte: Na, ich glaube, sie haben vor allen Dingen – das ist bei Intellektuellen ja so üblich – etwas in ihn hineinprojiziert. Wie ich eben sagte, für Sartre war Genet ein geradezu Fallbeispiel für seine eigene Theorie von der Selbsterfindung des Menschen, von einem Akt der Freiheit. Das war das, was genau in die Zeit passte, ins existenzialistische Kolorit der 40er- und 50er-Jahre in Paris. Andere sahen in ihm einen Vertreter, einen hochrangigen Vertreter, einen Fortsetzer der doch sehr spezifisch französischen Tradition der (…), der verdammten Dichter.
Die geht ja weit zurück, das geht bis auf François Villon zurück, der Briefe sozusagen vom Galgenbaum hinunter schrieb, und es ging bis näher an Genet heran, bis zu (…) oder auch (…) - alles Autoren, die am Rande der Gesellschaft lebten, zum Teil gegen die Gesellschaft lebten, sich irgendwelcher Verbrechen – damals als Verbrechen geltender Vergehen – schuldig gemacht hatten. Also die französische literarische Öffentlichkeit hat seit jeher ein gewisses Faible für diese radikalen Außenseiter.
Scholl: Politisch hat Jean Genet in den Fünfzigern mit dem Kommunismus geliebäugelt, dann hat er die amerikanischen Black Panther unterstützt, später sich für die Palästinenser eingesetzt. Wie ist dieses politische Engagement des Schriftstellers einzuschätzen?
Ritte: Ähnlich zweischneidig wie manche Aspekte seines literarischen Werks. Er hat ja selbst gesagt, ich bin so lange auf der Seite der Black Panther, ich bin so lange auf der Seite der Palästinenser, solange sie unterdrückt werden, solange sie in Unterdrückung leben. In dem Moment, wo sie nun wirklich befreit wären und Macht bekämen, würde er sich desolidarisieren.
Das hat Genet sehr konsequent durchgeführt, er hat mit vielen politischen Oppositionsbewegungen sympathisiert, Sie haben gerade gesagt, in Frankreich waren es die Kommunisten, er unterstützte auch den Aufruf zum zivilen Ungehorsam, also zur Wehrdienstverweigerung unter anderem während des Algerienkriegs.
Da haben 121 Intellektuelle in einem berühmten Manifest zum Ungehorsam aufgerufen. Dem hat Genet damals nur seine mündliche Unterstützung gegeben, obwohl er eigentlich der Erste hätte sein müssen, die so etwas unterschreiben, aber das tat er nicht. Er hielt sich dann zuletzt immer raus. Für ihn war die Revolte eben auch eine, ja, eine ästhetische Revolte und eine Revolte, die sich nicht in irgendeiner Weise organisieren lässt.
Scholl: Freiheit, die sich vor nichts fürchtet und der Abscheu vor allem, was ihr Fesseln anlegt – so hat Simon de Beauvoir einmal so das Naturell von Jean Genet umrissen. Welchen Rang misst man heute Jean Genet zu in Frankreich?
Ritte: Heute ist er im Pantheon der Klassiker angelangt, das sieht man, wenn man jetzt in die Buchhandlungen geht in Paris, viele Neuerscheinungen, viele neue Biografien, Neuauflagen seiner Werke, Briefausgaben, die jetzt so nach und nach erst an die Oberfläche kommen. Viel ist anfangs nicht erhalten geblieben, manchmal findet man was mit etwas Glück. Alles das wird sehr (…) ediert und herausgegeben, Sonderausgaben von literarischen Zeitschriften, und Genet ist natürlich immer noch auf dem Spielplan französischer Bühnen, und vor allen Dingen, wenn man das als besonderes Kriterium des Angekommenseins werten will, ein Angekommensein, das Genet vielleicht gar nicht so gefallen hätte: Er ist natürlich auch an der Universität längst angekommen, Doktorarbeiten, Kolloquien, Sammelbände und so weiter.
Genet ist wirklich in den Kanon der französischen Literatur aufgenommen. Ich habe heute noch versucht, mich zu informieren über die Schulprogramme. Da findet man allerdings die Romane nicht, die homosexuelle Pornografie, die aggressive Form der Pornografie will man offenbar den Schülern noch nicht zumuten, aber seine Theaterstücke schon.
Scholl: Der französische Schriftsteller Jean Genet, am kommenden Sonntag jährt sich sein Geburtstag zum 100. Mal. Das war aus Paris Jürgen Ritte, er lehrt Literatur an der Sorbonne. Herzlichen Dank für das Gespräch!
Ritte: Bitte sehr!
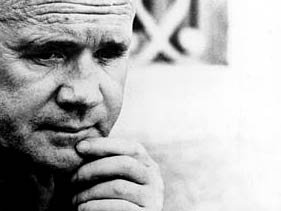
Jean Genet, 1968© AP