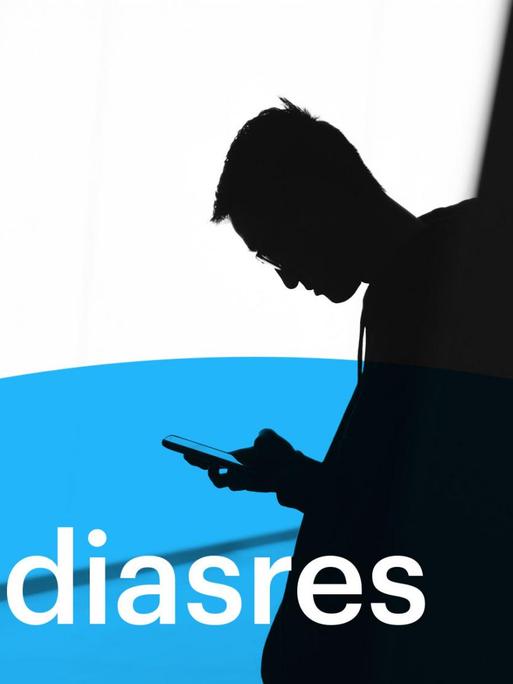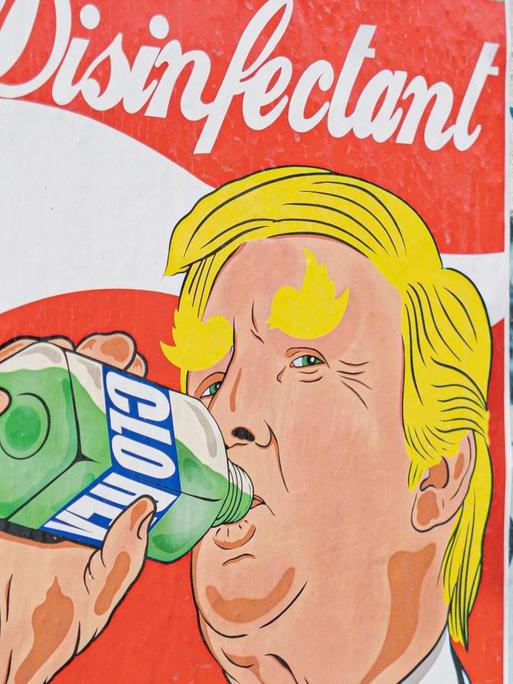Steffen Mau ist Soziologe und Professor für Makrosoziologie am Institut für Sozialwissenschaften der Humboldt-Universität Berlin. Er forscht vor allem zu den Themen soziale Ungleichheit, Transnationalisierung, europäische Integration und Migration. Sein Buch „Lütten Klein. Leben in der ostdeutschen Transformationsgesellschaft“ ist ein Bestseller. Mau, geboren 1968, wuchs selbst in der Rostocker Neubausiedlung auf. Sein neuestes Buch heißt: „Sortiermaschinen. Die Neuerfindung der Grenze im 21. Jahrhundert“.
Steffen Mau zur Impfdebatte

Man sollte das Gespräch mit denen nicht ablehnen, die Ängste oder Vorbehalte gegenüber einer Impfung haben, sagt Steffen Mau. © picture alliance / dpa / Silas Stein
"Es gibt eine politische Überhöhung der Impffrage"
10:28 Minuten

Klare Abgrenzung gegen Rechtsradikale, aber Dialog mit denen, die Ängste oder Vorbehalte gegenüber einer Impfung haben: In der Corona-Impfdebatte plädiert der Soziologe Steffen Mau für eine Aufweichung der verhärteten Fronten.
Das Grundgesetz als Zeitungsanzeige: Mit dieser Aktion wollte der Unternehmer Hermann Butting auf eine seiner Ansicht nach gravierende Einschränkung der Grundrechte in der Corona-Pandemie aufmerksam machen – obwohl er selbst kein Impfgegner sei, wie er im
Interview mit Deutschlandfunk Kultur
sagt.
Ein Gesprächsangebot habe er mit der Aktion machen wollen, so Butting. Doch wer Derartiges in der gegenwärtigen Situation tut, gerät schnell unter Verdacht, ein radikaler Querdenker zu sein – oder zumindest ein Egoist, der ohne Rücksicht auf die Gesundheit anderer seine Position durchsetzen will. Ist also gar kein Gespräch mehr möglich?
"Wir sollten das Gespräch nicht ablehnen"
Der Soziologe Steffen Mau plädiert für eine Aufweichung der verhärteten Fronten:
„Ich glaube, man kann Herrn Butting und vielleicht auch einigen derjenigen, die ihm geschrieben haben, sicher erst mal nicht absprechen, dass sie sich auch durchaus um das Gemeinwohl bemühen.“
Zwar müsse man sich klar von Rechtsradikalen und militanten Querdenkern abgrenzen, sagt Mau. „Aber mit Menschen, die aus den unterschiedlichsten Gründen Ängste oder Vorbehalte gegen eine Impfung haben, sollten wir das Gespräch nicht ablehnen.“
Es geht nicht um eine Gesinnungsfrage
Warum dieses Gespräch dennoch oft so schwer fällt, liegt dem Soziologen zufolge auch an einer politischen Überhöhung der Impffrage: Wenn man zum Beispiel nach Sachsen oder Thüringen schaue, sei das Impfen oder Nicht-Impfen dort kein infektiologisches oder medizinisches Thema, sondern eine Frage der politischen Haltung.
Umgekehrt dürfe man die Impffrage aber auch nicht zu einer Gesinnungsfrage von „gut oder falsch, vernünftig oder unvernünftig“ stilisieren, mahnt Mau. „Vielleicht gibt es andere Leute, die sich in anderen Kontexten unvernünftig verhalten", sagt er.
Ein deutscher Sonderweg in der Impfdebatte
Diese politische Überhöhung des Impfens ist offenbar ein deutsches Phänomen. „Das wird ja in anderen Ländern ganz anders behandelt", sagt Mau. "In vielen Ländern gibt es Impfpflichten oder wenn Sie zur Schule gehen wollen, dann müssen Sie eine ganze Latte von Impfungen vorweisen. In den USA beispielsweise.“
"No politics" als Königsweg
Oder in Portugal: „Ich habe neulich ein Interview gelesen mit dem Chef der portugiesischen Impfkampagne. Der wurde da gefragt, warum sich da über 90 Prozent haben impfen lassen, und er hat gesagt: no politics! Er hat gesagt, wenn das eine rein medizinische Frage wäre oder ist und behandelt wird und sich die Politik nicht zu stark einmischt, dann würden sich viel mehr Menschen impfen lassen“, sagt Mau.
„Manchmal kann eine Entpolitisierung durchaus auch etwas Positives sein, weil man mit der Impfung dann nicht die Haltung zum politischen System ausdrückt, sondern etwas, wo man sich um seine Gesundheit und die Gesundheit derjenigen, mit denen man täglich zu tun hat, kümmert.“
(uko)