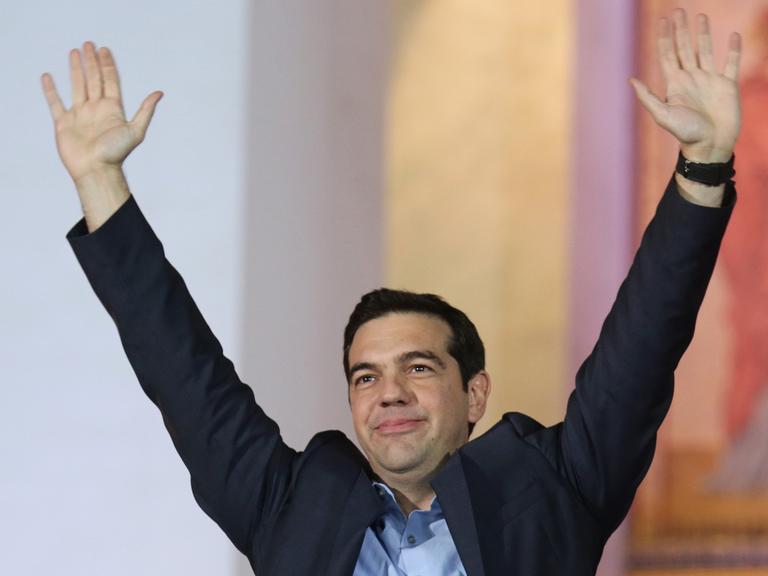"Wir brauchen ein Insolvenzrecht für Staaten"
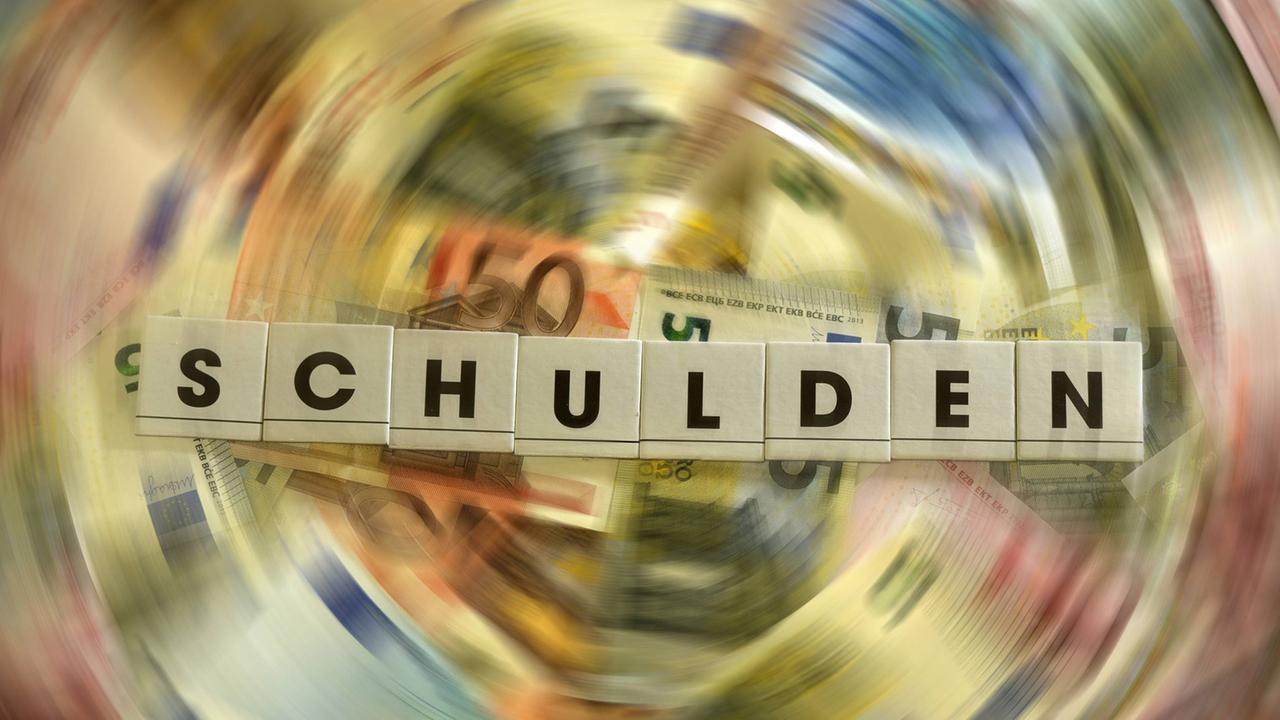
Griechenlands Schulden seien nicht das größte Problem, sagt der Makroökonom Daniel Stelter und verweist auf rund drei Billionen Euro "faule" Schulden in der Eurozone. Helfen könnte ein Schuldenschnitt ähnlich wie bei einer Unternehmensinsolvenz.
Im Deutschlandradio Kultur sagte Stelter vor dem Hintergrund der aktuellen Verhandlungen über Griechenlands Schulden, man müsse sich eingestehen, dass das, "was eigentlich in Brüssel passiert und was in Griechenland passiert, nur so ein kleines Schauspiel, ein kleines Unterhaltungsstück auf der Brüsseler Bühne ist."
Euro-Zone braucht konsequente Schuldenpolitik
Stelter forderte die Euro-Länder zum harten Kassensturz auf und sagte weiter, verschiedene Wege seien möglich und notwendig, um die Schuldenkrise zu bewältigen: Ein Weg sei eine zentralisierte Budgethoheit über die Haushalte der Euroländer, ein weiterer die Rückkehr zu den ursprünglichen Maastricht-Regeln, wonach ein Land selbst die Verantwortung für seine Schulden tragen müsse – ohne Hilfe durch die anderen. "Wenn man an beides nicht glaubt, dann muss man die Euro-Zone als Ganzes in Frage stellen." Zudem brauche die EU ein Insolvenzrecht für Staaten.
Keine Lösung sei es hingegen, Deutschland als "Buhmann darzustellen, der an allem Schuld ist" und letztlich für alle die Schulden zahlen müsse.
Party auf Pump
Abgesehen davon sei Griechenland nicht das wirkliche Problem, denn in allen Ländern lägen die Schulden heute deutlich höher als vor fünf, sechs Jahren. Überall, speziell in Ländern wie Spanien, Portugal und Irland, sei "eine große Party auf Pump" gefeiert worden. Unter anderem durch immense Privatschulden hätten sich etwa drei Billionen Euro "faule Schulden" angehäuft.
Das Interview im Wortlaut:
Liane von Billerbeck: Heute treffen sich in Brüssel die europäischen Finanzminister, nachdem in der Nacht das griechische Parlament der Regierungserklärung von Alexis Tsipras zugestimmt hat. Schluss mit Sparen also. Was tun? Zur Kenntnis nehmen, dass man das Geld sowieso nicht mehr bekommen wird und die Schulden als Chance zum Neuanfang nehmen? Das sagt der Makroökonom Daniel Stelter, und wie er sich das vorstellt, darüber rede ich in Kürze mit ihm.
Der oberste deutsche Sparkommissar Wolfgang Schäuble war das. Nun haben die Griechen aber beschlossen, nicht mehr sparen zu wollen. Die Schulden, sie sind auch so hoch, dass man sich auch fragen muss, ob sie jemals zu schultern sind. Wäre es da nicht besser, einen Schlussstrich unter die Sparpolitik zu ziehen und die Schulden als Chance zu begreifen für einen Neuanfang? Jedenfalls das hat der Makroökonom, Strategieberater und Buchautor Daniel Stelter vorgeschlagen. Kostenlos, weiß man, ist nichts, nicht mal der Tod – guten Morgen, Herr Stelter!
Daniel Stelter: Guten Morgen!
von Billerbeck: Da haben wir alle gespart und die anderen Länder dazu angehalten, auch zu sparen, bis es quietscht, um mal einen ehemaligen Berliner Bürgermeister zu zitieren. Nur, gebracht hat es nix – warum denn nicht?
Stelter: Ja, zum einen muss man sagen, dass die Schlagseite des Sparens oft mit der Realität nicht zusammenpasst. In Griechenland, in der Tat, wurde gespart, aber es wurde nicht intelligent gespart. Wenn Sie einfach die Ausgaben runterfahren, dann haben Sie nichts anderes als eine tiefe Rezession oder eine Depression wie in Griechenland. Und wenn die Wirtschaft schneller schrumpft als die Schuldenlast (...) gezahlt werden können, dann wird natürlich in alle Richtungen gehen, die Schulden werden immer untragbarer. Also man muss ganz klar sagen, wenn man pleite ist, aus einer Pleite heraus, kann man sich nicht heraussparen.
Ein Leben auf einem Schuldenberg
von Billerbeck: Aber die Politik könnte sich doch nun Sachverstand holen von Beratern wie Ihnen. Sie haben ja auch einen Plan, einen Plan, der, wenn ich mich richtig erinnere, auch der Sachverständigenrat der Bundesregierung so ähnlich schon mal unterbreitet hat. Was muss denn nun geschehen?
Stelter: Zum einen müssen wir uns eingestehen, dass eigentlich, was heute in Brüssel passiert und was in Griechenland passiert, dass das eigentlich so ein kleines Schauspiel nur ist, so ein kleines Unterhaltungsstück aus der Brüsseler Bühne, weil Griechenland ist nicht das größte Problem. Ich hab es angesprochen, wir reden von Sparen, tun es faktisch aber nicht. In allen Ländern der Eurozone liegen die Schulden heute höher als vor fünf oder sechs Jahren. Die wachsen nach wie vor schneller als die Wirtschaft. Und ganz wichtig dabei ist auch, wir schauen immer auf die Staatsschulden, aber es in Wahrheit in vielen Ländern auch ein Privatschuldenproblem. Ich denke an Portugal, an Irland, an Spanien, wo wirklich die Privatschulden so untragbar hoch sind, dass sie nicht mehr ordentlich bezahlt werden können. Und der Fehler, den wir gemacht haben, den Fehler haben wir gemacht in den Jahren seit 2000, mit der Einführung des Euros, da wurde halt in diesen Ländern auf Pump eine große Party gefeiert, und jetzt sind die Schulden einfach untragbar.
Was wir machen müssen, ist im ersten Schritt, uns eingestehen, dass wir es mit einer Überschuldung zu tun haben, und müssen dann darüber diskutieren, wie werden wir die Schulden geordnet los. Wie in einer ganz normalen Unternehmensinsolvenz müssen sich dann Schuldner und Gläubiger zusammensetzen und müssen einen Schnitt vornehmen. Und um hier eine Zahl zu nennen, ich persönlich schätze, dass mindestens 3.000 Milliarden Euro, also drei Billionen Euro in der Eurozone faule Schulden sind, die wir bereinigen müssen, und das können wir nur gemeinsam.
von Billerbeck: Sie haben in einem Text in der "SZ" darüber geschrieben, die Überschrift lautete "Ohne Verluste geht es nicht". Heißt das, Deutschland wird die Schulden der anderen zahlen müssen, wir können nur wählen zwischen einem Ende mit Schrecken oder dem Schrecken ohne Ende, zahlen müssen wir aber auf jeden Fall?
Stelter: Wir müssen nicht alle Schulden der anderen zahlen, aber wir sind einfach der Hauptgläubiger in der Eurozone. Sie müssen es sich so vorstellen: Wenn wir uns über unsere Handelsüberschüsse freuen, wie gerade auch vor ein paar Tagen wieder, dann bedeutet das nichts anderes, als dass wir mehr Waren exportieren als importieren, aber auch, dass wir mehr Geld exportieren als wir importieren. Das heißt, wir geben Kredit. Und wenn wir unsere Autos auf Kredit verkaufen und dann Forderungen haben und derjenige, der das Auto gekauft hat, nicht mehr zahlen kann, dann müssen wir uns eben zusammensetzen und sagen, okay, was können wir schieben. Das heißt, als Hauptgläubiger müssen wir natürlich eine Hauptlast tragen, aber wir sind nicht alleine.
Das Wohlwollen der Partner
Nur für uns ist halt, oder aus meiner Sicht ist entscheidend, erstens, wenn wir nicht das uns eingestehen, dann wachsen die Anteile, wächst der Anteil der faulen Schulden immer weiter an, also der Schaden wächst immer größer an, und zum anderen erfolgen dann andere Wege, wo wir zahlen müssten, weil wenn die EZB, wie ja zuletzt beschlossen, im großen Stil Staatsanleihen aufkauft, dann macht sie im Prinzip genau dasselbe, sie führt auch dazu, dass wir in letzter Konsequenz diese Schulden zahlen müssen, aber ohne uns vorher gefragt zu haben und ohne, dass wir darauf Einfluss nehmen können, was wir als Gegenleistung bekommen. Und sei es auch nur, dass wir als Gegenleistung bekommen, dass wir zumindest Wohlwollen unserer Partner zu bekommen, statt wie heute der Buhmann in Europa zu sein, der angeblich an allem schuld ist.
von Billerbeck: Herr Stelter, Sie haben ja da so ein Modell erdacht, und am Ende dieses Modells, denn schließlich hängt in Europa ja alles mit allem zusammen, da steht die Abgabe der nationalen Budgethoheit. Das heißt, die nationalen Finanzminister und Parlamente haben dann nichts mehr zu sagen. Meinen Sie wirklich, so was lässt sich durchsetzen?
Stelter: Ich muss dazu sagen, ich habe zwei Wege aufgezeigt, drei Schritte. Erstens sage ich, lass uns die Historie aufräumen, gemeinsam. Das Zweite ist natürlich dann, wie geht es weiter? Und da haben wir zwei Optionen: Entweder wir führen wirklich eine völlige Zentralisierung herbei mit Aufgabe der Budgethoheit oder aber wir gehen zurück zu echten Maastricht-Regeln, wo wir gesagt haben, wenn ein Land nicht zahlen kann, dann ist es selber daran schuld. Es gibt no bailout, also keine Hilfe der anderen. Nur eins von beiden gilt. Ich glaube persönlich, wenn man an beides nicht glaubt, dann muss man die Eurozone als Ganzes in Frage stellen, das kann man auch gerne machen. Aber wenn man sagt, nein, wir möchten am Euro festhalten, dann muss man entweder eine völlige Integration herstellen oder aber die No-bailout-Klausel wirklich implementieren, und da ist eben gerade so ein gemeinsames (...) ein guter Ansatzpunkt. Weil, wenn wir nämlich uns hinsetzen und das tun, dann können wir in solchen Verhandlungen auch dafür eine Lösung finden. Und: Wir brauchen ein Insolvenzrecht für Staaten.
Gefahr einer Inflation?
von Billerbeck: Hierzulande sieht man dann ja immer sofort die Waschkörbe voller Geld, mit denen man während der großen Inflation in der Weimarer Zeit ein Brot einkaufen ging. Wie wollen Sie denn verhindern, dass es dann so eine Inflation gibt.
Stelter: Gut, ich meine, das ist eine Frage eben, was passiert. Ich glaube, wenn wir Angst vor der Inflation haben, wenn Sie Angst davor haben, als Sparer enteignet zu werden, dann müssen Sie gegen die heutige Politik sein. Weil die EZB letztlich eingestiegen ist in ein ausdrücklich unbegrenztes Programm des Aufkaufs von Staatsanleihen. Das heißt, wenn Sie in diese Richtung Sorgen haben, dann ist das die Sorge. Deshalb ist es besser zu sagen, ich mache das in einer einmaligen Aktion, da kann die EZB auch beteiligt sein, und dann muss es nicht zu diesem Waschkörbe-Phänomen kommen. Dazu kommt es ja zurzeit auch deshalb nicht, weil die Schulden schon so hoch sind, und weil wir noch alle Vertrauen in Geld haben. Nur die jetzige Politik kann in der Tat darauf hinauslaufen – nicht morgen, nicht übermorgen – aber kann darauf hinauslaufen, dass wir das Vertrauen in Geld verlieren. Und das wäre ein solches Szenario auch denkbar. Ich persönlich denke, es wäre besser, die Schulden offen anzugehen, zu restrukturieren. Dann verhindern wir auch so ein Szenario.
von Billerbeck: Zahlen müssen wir also, jetzt oder später. Der Makroökonom Daniel Stelter war das. Danke Ihnen!
Stelter: Ich danke Ihnen!
Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Deutschlandradio Kultur macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.