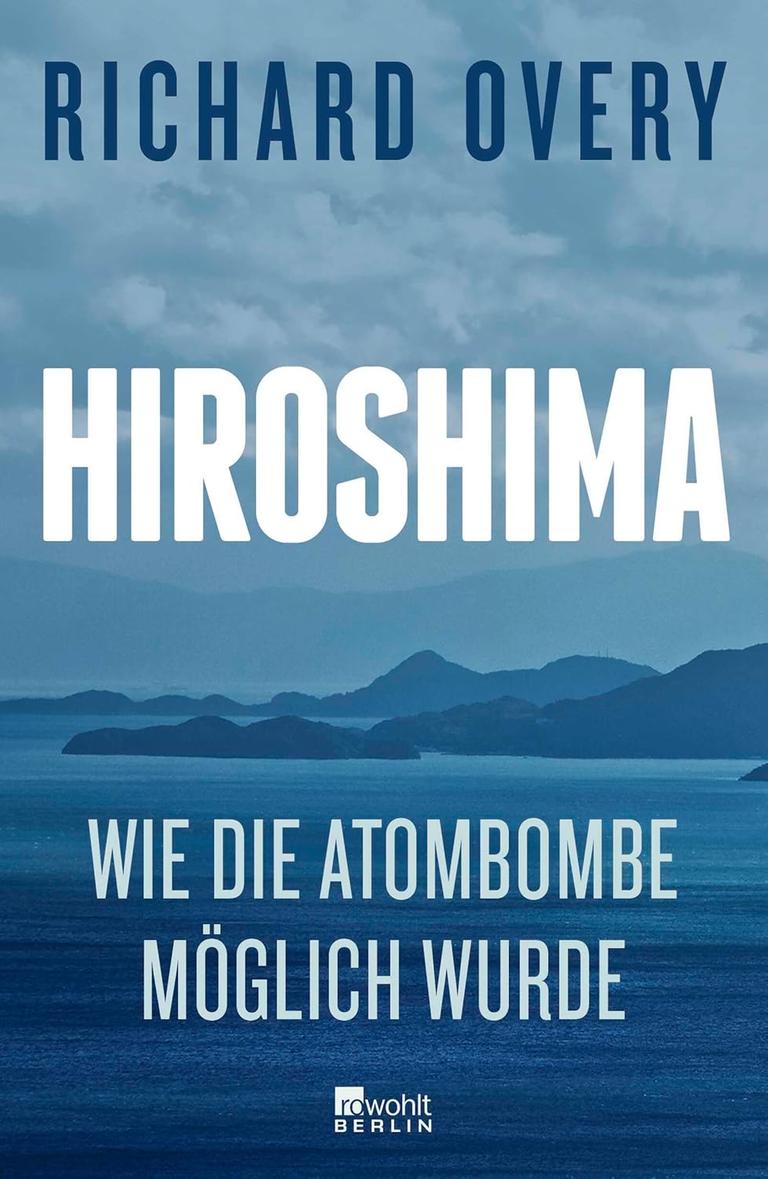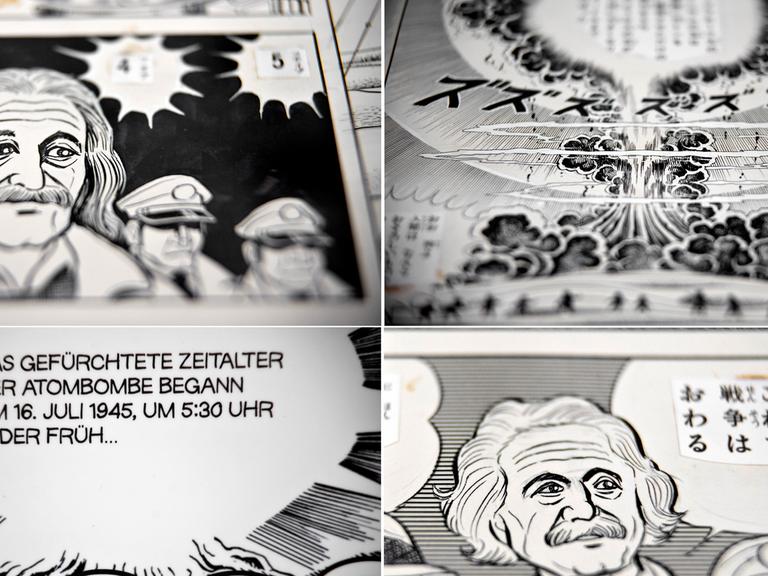Mit dem klassischen Handwerkszeug des Historikers untersucht Overy die Motive der handelnden Politiker, Wissenschaftler und Militärs. Er will, wie er schreibt, kein Urteil über die Vergangenheit fällen, sondern es geht ihm darum, „die Vorgänge aus sich heraus zu verstehen“. Der Historiker befragt nicht allein amerikanische und britische, sondern auch japanische Quellen in englischer Übersetzung, darunter auch Berichte von Menschen, die die Angriffe auf Hiroshima und Nagasaki überlebten. So die dreizehnjährige Schülerin Nakamura Setsuko. Am 6. August 1945 schloss sie sich einer Gruppe an, die nach dem Bombenangriff aus Hiroshima in die Berge flüchtete:
„Alle bluteten, hatten Brandwunden und schwarze Flecken und waren aufgeschwollen. Ihnen fehlten Körperteile; Fleisch und Haut hingen von den Knochen herab. Einigen hingen die Augenäpfel in den Händen; manchen waren die Bäuche aufgerissen und die Eingeweide hingen heraus.“
Auf 118.000 schätzte das Statistikamt der Stadt Hiroshima die Zahl der zivilen Toten. In Nagasaki starben mehr als 73.000 Menschen durch die Atombombe.
Wie konnte es zu diesem grauenhaften Kriegsgeschehen kommen? Richard Overys Antwort rekapituliert nicht die gesamte, aggressiv imperialistische Politik des mit Hitlerdeutschland verbündeten Japan, sondern blickt zunächst auf die Strategiediskussionen des US-Militärs vor und nach dem Angriff auf Pearl Harbor 1941. Heer und Marine benutzten die Luftstreitkräfte zunächst nur zur Unterstützung bei der Rückeroberung der Philippinen und dem Vormarsch im Pazifik von Insel zu Insel. Die Army Air Forces wollten aber als Waffengattung von eigener strategischer Bedeutung anerkannt werden. Aus diesem Grund legten die Führungsstäbe Zielverzeichnisse für japanische Städte an, lange bevor 1943 mit der B 29, der „Superfortress“, ein Langstreckenbomber mit genügender Reichweite zur Verfügung stand.
Angriffe mit Brandbomben sollten die in Wohnvierteln dezentralisiert angesiedelten Werkstätten der japanischen Rüstungsindustrie treffen und – nach dem Muster der Luftangriffe der Royal Air Force auf deutsche Städte - durch Feuersbrünste die Arbeiterschaft demoralisieren. Nach den erbitterten Kämpfen um die Pazifikinseln wurde diese Art des Luftkriegs durch den Wunsch motiviert, die eigenen Verluste niedrig zu halten. Hinzu kamen Rachegedanken und rassistische Vorstellungen von der Bestialität des Gegners.
Mit Hochdruck arbeiten an der Nuklearwaffe
Parallel zum Luftkrieg mit konventionellen Spreng- und Brandbomben arbeitete seit 1942 das Manhattan-Projekt unter der Leitung des Physikers J. Robert Oppenheimer mit Hochdruck an der Entwicklung der Nuklearwaffe. Stellvertretender Leiter des Laborkomplexes in Los Alamos war der Marineoffizier William Parsons, der mit seinem Team den Zündmechanismus der Bombe herstellte.
„Dass sie zum Einsatz kommen würde, wenn sie rechtzeitig fertig würde, war im Zeitplan des Projekts stets implizit enthalten. (...) Oppenheimer wie Parsons favorisierten als Ziel der Bombe eine Stadt, denn dort wären die Zerstörungseffekte einer Bombe bei einer Abwurfhöhe von 9000 Metern am höchsten.“
Radikalisierung politischer und militärischer Entscheidungen
Nach der Eroberung Okinawas im Juni 1945 wollte die US-Regierung eine verlustreiche Invasion auf den japanischen Hauptinseln vermeiden. Auf der Potsdamer Konferenz verlangten die USA, Großbritannien und China am 28. Juli 1945 die bedingungslose Kapitulation Japans. Andernfalls habe das Land die „sofortige und völlige Vernichtung“ zu erwarten. Die japanische Regierung ignorierte die Aufforderung, obwohl Kaiser Hirohito auf Beendigung des Krieges drängte.
„Die Notwendigkeit, den Krieg zu einem raschen Ende zu bringen und die Wahrnehmung der Weigerung Japans zu kapitulieren, sind eigentlich Erklärung genug für das weitere Geschehen.“
Die These, die Atombomben in Hiroshima und Nagasaki seien eingesetzt worden, um die Ambitionen der Sowjetunion in Osteuropa zu begrenzen, weist der Historiker zurück. Laut Overys Darstellung hat die Forschung bisher den Verfassungsprozeduren und der politischen Kultur Japans zu wenig Beachtung gewidmet. Begriffe wie „Niederlage“ oder „Kapitulation“ existierten in der Vorstellungswelt der japanischen Eliten nicht. So bedurfte die Einstellung der Kämpfe eines sogenannten „heiligen Beschlusses“ des Kaisers, der erst nach längeren Auseinandersetzungen mit den militärischen Hardlinern durchgesetzt werden konnte. Auch die Furcht vor einer revolutionären Gesellschaftskrise und einer Invasion der Sowjets spielten eine Rolle.
„Die Atombombe auf Hiroshima war nur ein Faktor unter den vielen verschiedenen Zwängen, denen sich die japanische Führung gegenübersah. [...] Die Gleichsetzung von Atombombenabwurf und Kapitulation ist zu eng.“
Overys Darstellung ist ein präzises Lehrstück über die fortschreitende Radikalisierung militärischer und politischer Entscheidungen. In den Augen des Historikers beginnt der eigentliche Sündenfall bei der Dehumanisierung des Gegners und den zweifelhaften moralischen Relativierungen totaler Kriegsführung gegen die Zivilbevölkerung. Daraus, so schließt Overy seinen gut dokumentierten Befund, könne man lernen für die Zukunft.