Alle, die sie einst peinigten und quälten, waren bloßgestellt. Der Schuldspruch von der Hand des Pierre Cauchon wurde im Jubelsturm des Volks zerrissen. Und Jungfrau Jeanne sprach man dann heilig. Das Böse brachte einen Menschen um sein Leben. Das Gute überwand dennoch das Böse. Das Gute siegt.
Viktor Martinowitsch: „Das Gute siegt“
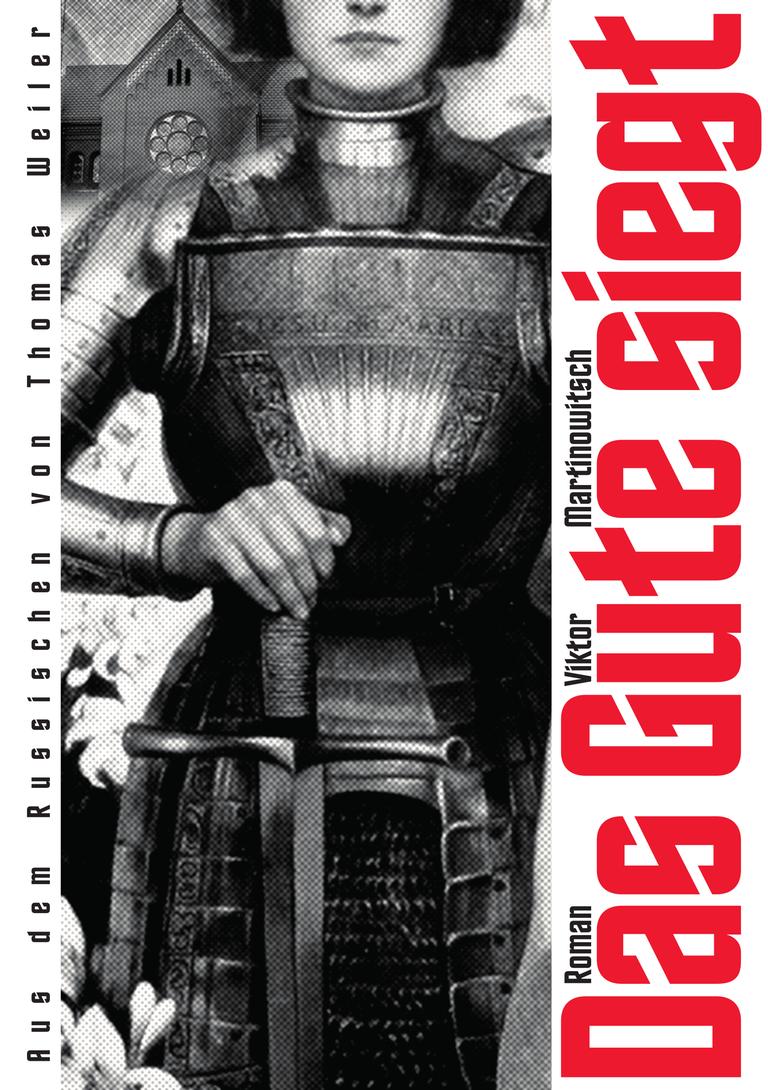
© Voland & Quist
Revolution und Katzenjammer
07:02 Minuten
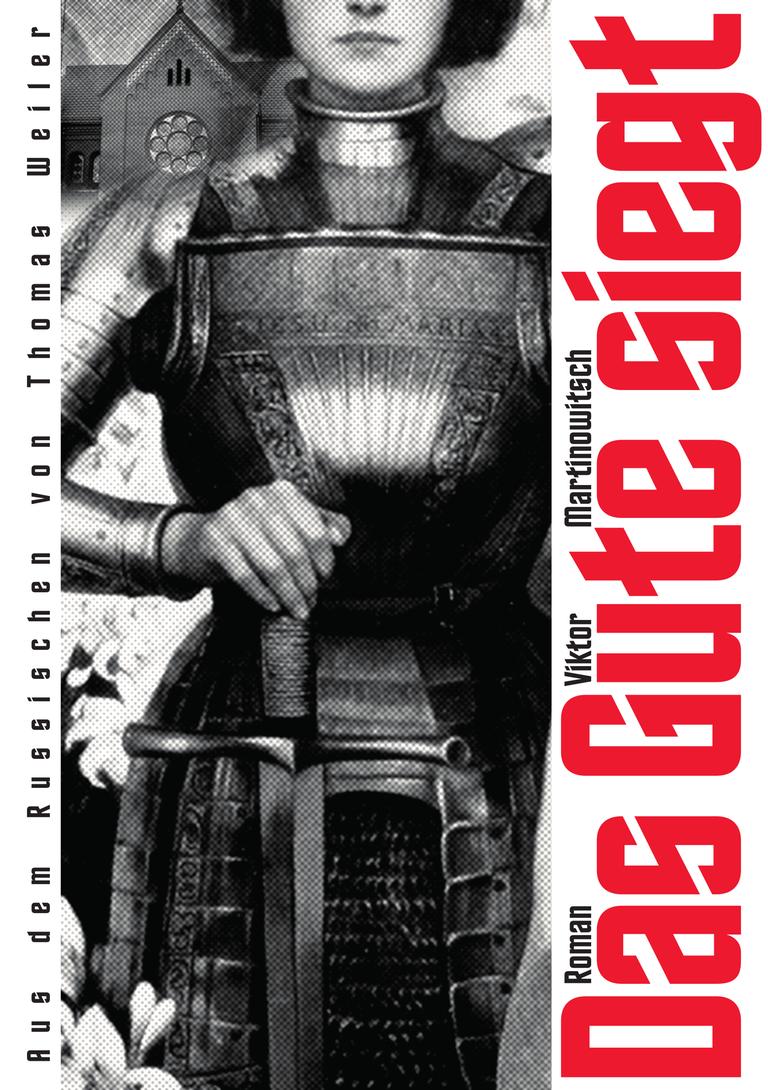
Viktor Martinowitsch
Übersetzt von Thomas Weiler
Das Gute siegtVoland & Quist, Berlin 2025368 Seiten
26,00 Euro
Minsk 2020: Oppositionelle protestieren, Regimegegner werden willkürlich verhaftet und verurteilt. Mitten im Geschehen steht der Schauspieler Matwej – den Viktor Martinowitsch in seinem Roman "Das Gute siegt" in den Strudel der Ereignisse zieht.
Swjatlana Zichanouskaja gehört zu den Protestikonen der belarussischen Oppositionsbewegung. Sie setzte die politische Arbeit ihres 2020 von der Präsidentschaftskandidatur ausgeschlossenen, verhafteten Mannes fort und geriet damit selbst ins Visier der Staatsmacht. 2023 reiste sie nach Litauen aus. In Abwesenheit wurde sie von einem Gericht zu 15 Jahren Haft verurteilt. Die heimische Presse verlieh Zichanouskaja schon 2020 den Namen „Jeanne d’Arc von Belarus“.
Der neue Roman von Viktor Martinowitsch, hervorragend zu lesen in der deutschen Übersetzung von Thomas Weiler, spielt im Jahr 2020. Während der damaligen Aufstände in Minsk wird am Nationalen Akademischen Künstlertheater ein Stück aufgeführt, dessen Hauptfigur wohl nicht zufällig die historische Jeanne d’Arc ist. Das Schauspiel schließt mit den folgenden Worten:
Um der Zensur zu entgehen, will der Regisseur das Drama als Liebesschmonzette inszenieren, in Wahrheit geht es darin um den Inquisitions-Prozess, der gerade einem ganzen Volk gemacht wird.
Martinowitsch, einer der produktiven und experimentierfreudigen jüngeren Autoren aus Belarus, hat nicht nur einen Roman über die Proteste 2020 geschrieben, sondern über die Wirkweisen des Bösen, über Macht und Ohnmacht. „Das Gute siegt“ ist natürlich bitter-ironisch gemeint.
Wenn wir seinem Helden Matwej durch die revolutionären Monate folgen, ahnt man, was mit dem Titel gemeint ist: Martinowitsch erzählt die Geschichte eines Moralisten, der in den Mahlstrom der Geschichte gerät. Von Zynismus umgeben, ist Matwej ein Ausbund an Aufrichtigkeit. Blind und naiv ist er jedoch nicht.
Der Philosoph im Kater
Martinowitsch findet für diesen hochaktuellen Roman einen Ton, der die Absurdität, die kleinen Lichtblicke, vor allem aber die Aussichtslosigkeit jener Wochen genau einfängt: eine Mischung aus Direktheit und Melancholie, aus Scharfsinn und Witz.
Das geht schon damit los, dass er seinen Helden Matwej auf eine geradezu halsbrecherische Mission schickt: Der auf Nebenrollen abonnierte Theaterschauspieler rettet nämlich den Kater seiner verhafteten Lehrerin, einer Professorin für Kulturphilosophie. In deren Wohnung fand kurz zuvor noch eine Razzia statt – er macht sich trotzdem auf, um den hungernden Kater aus seiner misslichen Lage zu befreien. Das Tier trägt den Namen Heidegger. Sein Murren nämlich hört sich an wie eine existentialistische Klage:
‘Dasein?‘, fragte Heidegger beinahe höflich durch die Tür. Beinahe menschlich fragte er. ‚Dasein, Dasein‘, antwortete ich beruhigend.
Einer der Scharfmacher des Regimes, der in den Sozialen Medien das einfache Volk gegen die Protestierer aufzuhetzen versucht, ist ein Stalinist aus Frankreich und trägt den Namen Hubert Joseph Henry – so hieß im Übrigen jener Hauptmann, der am Ende des 19. Jahrhunderts mit einer grotesken Fälschung die Verurteilung des jüdischen Artillerie-Hauptmanns Alfred Dreyfus vorantrieb. Martinowitsch legt ihm zynischerweise die Worte in den Mund, mit denen Émile Zola die antisemitische Verschwörung öffentlich machte.
Matwejs Leben spielt sich zwischen Probebühne, oppositionellen Telegram-Chat-Gruppen, einer Liebesaffäre und der Straße ab, wo finstere Gestalten in blauen Vans willkürlich Passanten und Demonstranten aufgreifen. Es ist eine abenteuerliche, intensive Zeit. Die Rasanz von Martinowitschs Erzählen, gespeist von Anspielungen und Verweisen auf zeitgeschichtliche Ereignisse, macht das deutlich. Seine Sprache ist so angespannt und aufgeladen wie die Stimmung jenes Spätsommers 2020 in Minsk.
Totalitäres Schmierentheater
Auf seinem Weg durch die Stadt verguckt er sich in eine dichtende Anarchistin, die sich Lady Di nennt, in der U-Bahn eine Performance hinlegt und irgendwie ungreifbar scheint. Er selbst landet im Gefängnis, weil er nachts zur falschen Zeit am falschen Ort ist.
Minsk um das Jahr 2020 gleicht mehr und mehr einem totalitären Schmierentheater, das sich am großen Bruder Russland orientiert. Die geplante Inszenierung von „Jeanne d’Arc“ kann gar nicht so weltfremd ausfallen, dass die offiziellen Stellen sie laufen lassen würden. Das Theater muss seinen Betrieb einstellen. Ein Teil der Truppe emigriert nach Litauen. Der andere Teil bleibt zurück. Alle aber verlieren das Zentrum ihres Lebens, und alle schlagen sich mehr schlecht als recht durch die Misere ihres Landes.
Martinowitsch stellt immer wieder geschickt und durchaus sinnfällig Analogien zwischen Belarus und dem nach-revolutionären Frankreich her:
Im Paris nach Haussmann, der mit den breiten Boulevards schon die Idee einer Revolution im Keim ersticken sollte, gab es den Aufstand der Kommunarden und das Jahr 1968. In unserer Stadt fallen die Boulevards so breit aus, dass alles schon vorbei ist, ehe es begonnen hat.
Ein Held von der traurigen Gestalt
„Das Gute siegt“ ist ein wilder Roman, romantisch und frei – denn die Sprache lässt sich von den Machthabern nicht kontrollieren. Selten wurde so anarchisch, poetisch und beißend, entlarvend und desillusioniert über die Zustände in Belarus geschrieben wie hier. Zwischen den Zeilen jedoch lauert so etwas wie Zuversicht. Vielleicht siegt das Gute nicht gleich, aber die Literatur bewahrt den Funken Hoffnung, der irgendwann vielleicht doch überspringen und den Apparat in Flammen aufgehen lassen kann.











