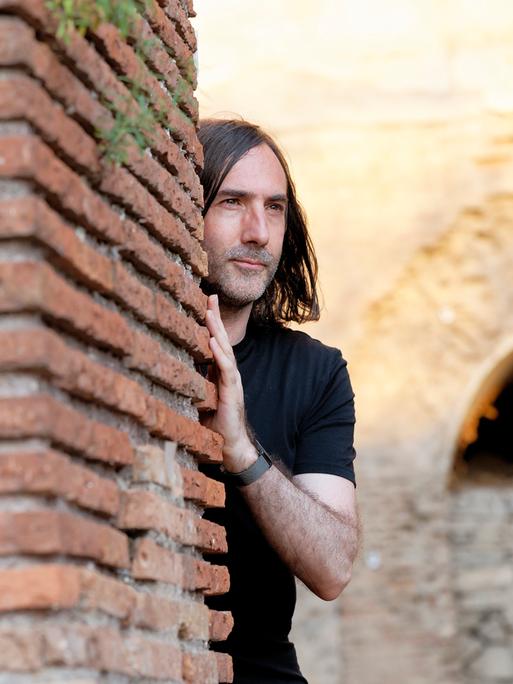„Von Nordost kommt Sturm auf. Die Meldung ist raus. Sieh dir doch den Strand an. Die meisten Boote sind rausgezogen. Die übrigen kommen gerade rein.“
Paul Lynch: „Jenseits der See“
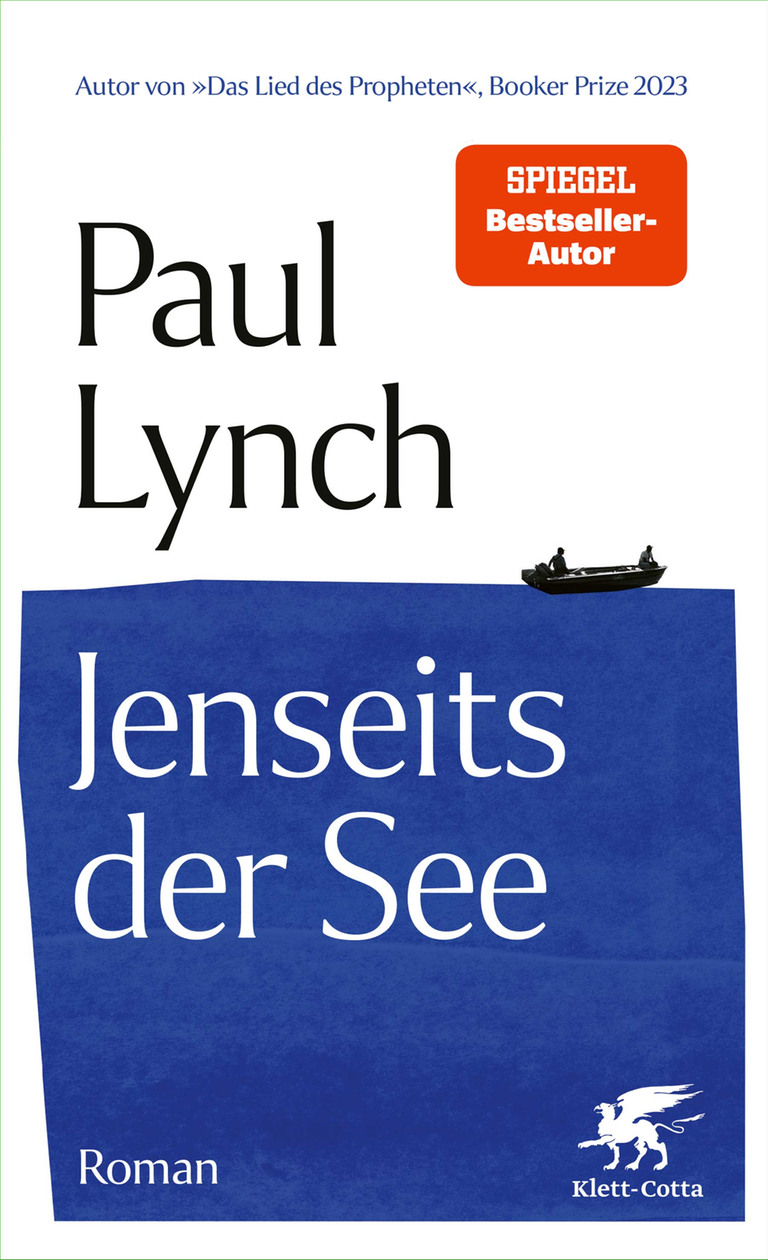
© Klett Cotta
Im Herz der Finsternis
19:43 Minuten
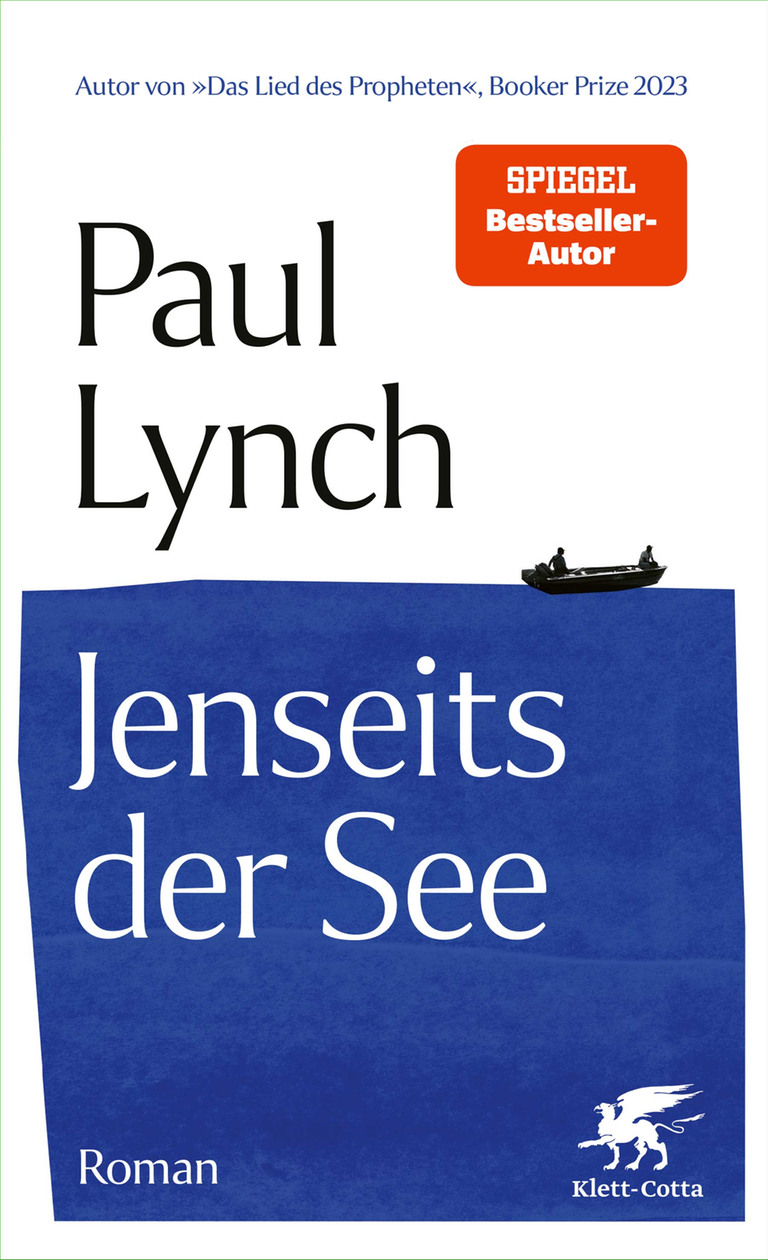
Paul Lynch
Eike Schönfeld
Jenseits der SeeKlett-Cotta, Stuttgart 2025192 Seiten
22,00 Euro
Der irische Booker-Preisträger Paul Lynch hat sich hierzulande spät durchgesetzt. In „Jenseits der See“ erzählt er von dem existenzialistischen Überlebenskampf zweier Fischer, die in hoch technisierten Zeiten den Naturelementen ausgesetzt sind.
„Wer weiß schon, ob das Leben Tod ist, oder der Tod das Leben?“, rätselte der antike griechische Dichter Euripides vor zweieinhalbtausend Jahren. Mit dem Satz über die Austauschmöglichkeiten von Tod und Leben eröffnet Paul Lynch seine Novelle. Und deutet an, dass „Jenseits der See“ mehr erzählen wird als den Überlebenskampf zweier Fischer, die vor der Küste Mexikos in einen Sturm geraten und so konfrontiert werden mit der nackten menschlichen Existenz angesichts jener Katastrophe, die sich in einer der ersten Szenen ankündigt:
Konfrontiert mit der Sinnlosigkeit allen Seins
Obwohl die Warnung abgesetzt wurde, werden sich an diesem Tag zwei Menschen in äußerste Gefahr begeben – und dabei mit der Sinnlosigkeit allen Seins konfrontiert werden. Die Konstellation und ihre symbolische Ausdeutung sind keinesfalls neu. Hans Blumenberg hat bereits das Motiv des Schiffbruchs von der Antike bis in die Gegenwart untersucht und als philosophische Leitmetapher erkannt.
Lynchs Buch beginnt überaus harmlos und stellt einen Helden vor, der in der Mitte seines Lebens steht, wie der Reisende in Dantes „Göttlicher Komödie“ oder der Seemann Charlie Marlow in Joseph Conrads „Herz der Finsternis“. Lynch charakterisiert seinen Helden Bolivar als geistesträge Figur, als einen Mann, der ambitionslos in den Tag hineinlebt, der Spelunken besucht und leidenschaftlich raucht, seinen Job als Fischer immer mal wieder vernachlässigt und weiblichen Verlockungen eher lose ergeben ist, weshalb ihm auch bescheinigt wird: „Du glaubst an nichts. Du kümmerst dich um nichts, nur um dich selbst.“
Totenkopf als Menetekel
Bolivar will sich ein gutes Geschäft nicht entgehen lassen und sticht trotz des dräuenden Unwetters in See – und versucht zuvor, den unerfahrenen Hector anheuern, einen scheuen Jungen, der sich keineswegs vom üppigen Lohn anlocken lässt, sondern Bolivar einen Verrückten nennt. Auch dies ist ein Topos verschiedener Abenteuerstorys: die Warnung des Sehers vor der Gefahr – eine Warnung, die stets in den Wind geschlagen wird. Bolivar lässt sich nicht beirren. Er stimmt den Jungen um, verspricht ihm die Hälfte des gemeinsamen Fangs, umsäuselt ihn auf manipulative Weise.
„Sag mir, Hector, was ist ein Sturm? Ein bisschen Wind, mehr nicht. Das Meer wird ein bisschen kabbelig. Echte Fischer sind so was gewöhnt. Mir ist noch kein Sturm begegnet, der mich unterkriegt. Wir fahren einfach raus und kommen einfach wieder rein. Kein Stress.“
Dass auf Hectors Pullover wie als Menetekel ein Totenkopf gedruckt ist, wird Bolivar erst später erkennen. Da sind die beiden bereits auf hoher See. Sie fahren weiter als die anderen Schiffer dorthin, wo Bolivar glaubt, besonders fette Beute zu machen.
Dann erfasst der Sturm die Fischer. Das Funkgerät fällt aus. Der Motor versagt. Damit ist klar, dass sie aus eigener Kraft nicht mehr an Land zurückkommen können. Bolivar und Hector sind nun auf hoher See in Gottes Hand. Sie können lediglich abwarten, in banger Hoffnung. Ausschau halten nach einem Flugzeug, nach Rettungsbooten.
Die Reise als Parabel
Bolivar bleibt verführbar von fantastischen Welten, in die er sich so lang verkrochen hat, offen für Visionen und Rettungsfantasien. Sein tiefgläubiger Begleiter begegnet der ernsten Lage dagegen offenen Auges – und zeigt sich standhaft wie der ebenfalls Hektor genannte Heerführer Trojas in der „Ilias“ von Homer. Auf hoher See wird Paul Lynchs Novelle zum Kammerspiel über zwei Menschen auf engstem Raum, die derselben Extremsituation ausgesetzt sind, aber auf je verschiedene Weise der drohenden Vernichtung begegnen.
Deutlich wird, dass diese Reise als mehrdeutige Parabel angelegt ist, als Sinnbild des Lebenswegs, als Versuch über die Absurdität unserer Existenz, als Gewissensprüfung und als Meditation über das Gemeinwesen an sich: Wie wichtig – so eine im Hintergrund immer mitlaufende Frage – sind stabile Bindungen?
Weder Himmel noch Hölle - sondern eine Strafe
Schuld ist das große Thema dieser Novelle, die sich deutlich unterscheidet von den zuvor auf Deutsch erschienenen Romanen „Grace“ und „Das Lied des Propheten“, die sprachlich unkonzentriert waren, während diese Geschichte ihre literarische Spannkraft behält, nicht ausfranst, sondern mit Bedacht ganz nah an seine Figuren rückt. Wie bei einer teilnehmenden Beobachtung folgt der Text forschenden Blicks den Wandlungen dieser Lebensreise, weitet aber jederzeit den Horizont über das real Gegebene hinaus, sodass dieses kleine Boot ebenso als Charons Barke erscheint, die zwei verlorene Seelen zur anderen Seite des Hades übersetzt: ins „Jenseits“ der See.
„Weißt du, Bolivar, das ist weder Himmel noch Hölle. Das ist unsere Strafe. Wir sind ausgestoßen. Wir haben Gott aus den Augen verloren. Jetzt lernen wir, was es in Wahrheit bedeutet, ihn nicht zu sehen. Nicht sehen. Nie sehen. Nie sehen werden. Vielleicht immer nicht. Das ist die wahre Abwesenheit. Sie muss als Leid erfahren werden.“
Ihre Reise verzettelt sich, wird strukturlos wie der Text, der auf sprachlicher Ebene zwischen Gedankenströmen und tagebuchartigen Beobachtungen schwankt, die Zeit ins schier Endlose dehnt, bis plötzlich ein einzelnes Wort auf der fast leeren Seite hervorsticht: „Sturm“.
Während Bolivar den Realitätsgrund unter sich irgendwann doch wieder spürt, aus seinem Traum zu erwachen scheint, schwächelt der Jüngere. Hector gewahrt, dass er seine Kraft und Standfestigkeit, dass er seinen Glauben und somit den eigenen Verstand verliert.
Dieser Schiffbruch hat tatsächlich stattgefunden. Am 17. November 2012 stachen Salvador Alvarenga und der 20-jährige Ezequiel Córdoba vom mexikanischen Fischerdorf Costa Azul aus in den Pazifischen Ozean. Auch sie gerieten in stärkstes Unwetter. Ihr Boot trieb 438 Tage auf dem Meer und legte eine Strecke von 10.000 Kilometern zurück. Die totgeglaubten Seemänner ernährten sich wie im Buch von rohem Fisch, von Vogelblut und Quallen. Nur Salvador Alvara sollte nach über 14 Monaten auf den Marshallinseln stranden. Sein Begleiter war angeblich verhungert – und der so wundersam Gerettete sollte noch lang verdächtigt werden, er habe Ezequiel Córdoba schlichtweg aufgegessen.
Bezüge zu Joseph Conrad und Apocalypse Now
Doch hat der irische Schriftsteller diesen Schiffbruch und seine Hintergründe ausreichend verfremdet. Wie Joseph Conrad, der seine Erfahrungen als Handelsschiffsoffizier im belgisch kolonisierten Kongo mythologisch überhöhte in „Herz der Finsternis“ - dieser unheimlichen Erzählung, die eindreiviertel Jahrhundert später die Vorlage bilden sollte für Francis Ford Coppolas Vietnamkriegsfilm „Apocalypse Now“. Auf das Buch und den Blockbuster bezieht sich Lynch nicht nur im Aufbau, sondern auch in Details seiner Geschichte.
Ob das Leben nun Tod oder der Tod das Leben ist, beantwortet Paul Lynchs „Jenseits der See“ nicht. Das müssen die Leserinnen und Leser für sich selbst entscheiden, so wie Bolivar, der selbst nach anderthalbjährigem Radikalexil an seiner ursprünglichen Identität festhalten wird. Er bekennt mit letzter Kraft: „Ich bin bloß ein Fischer.“
Mehr nicht – aber auch keinesfalls weniger.