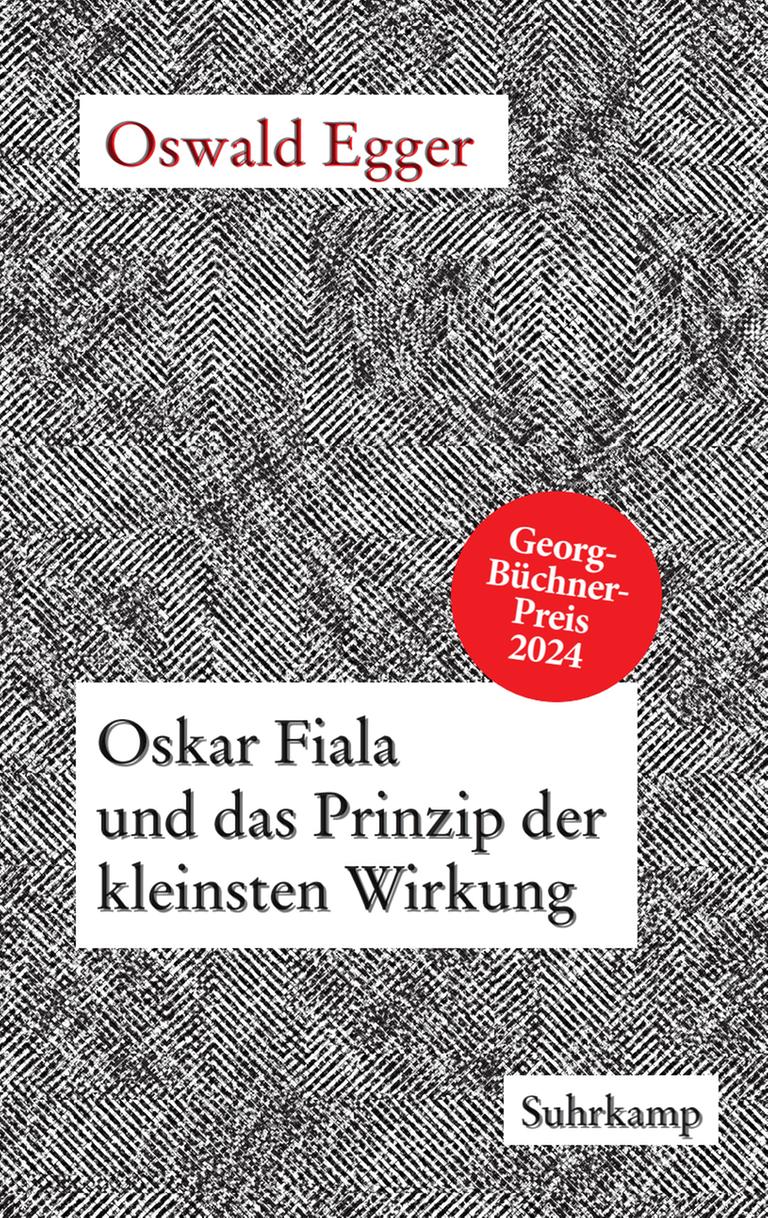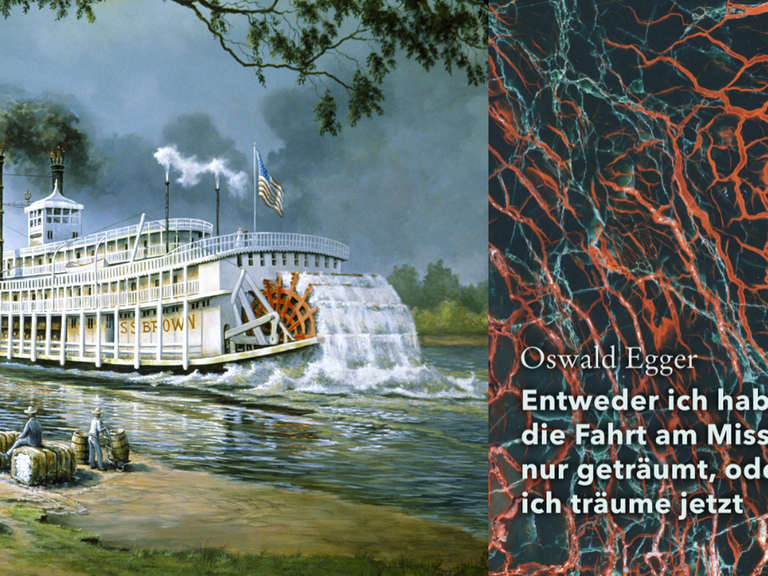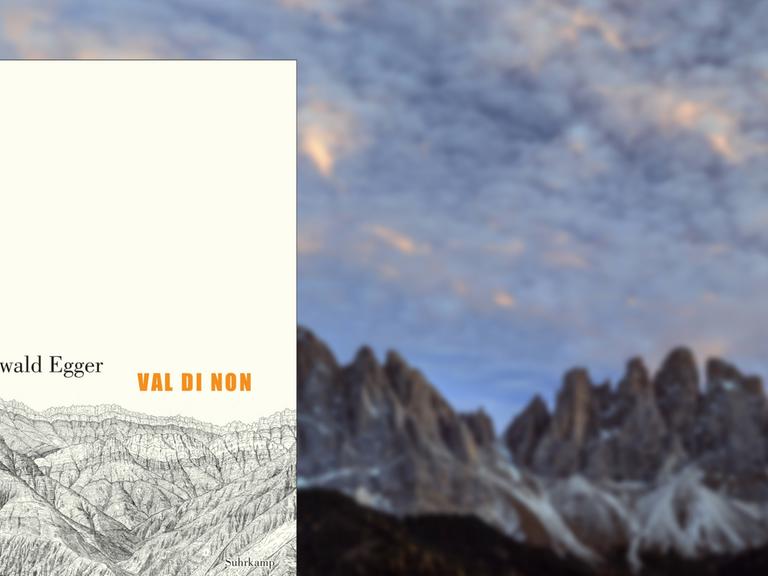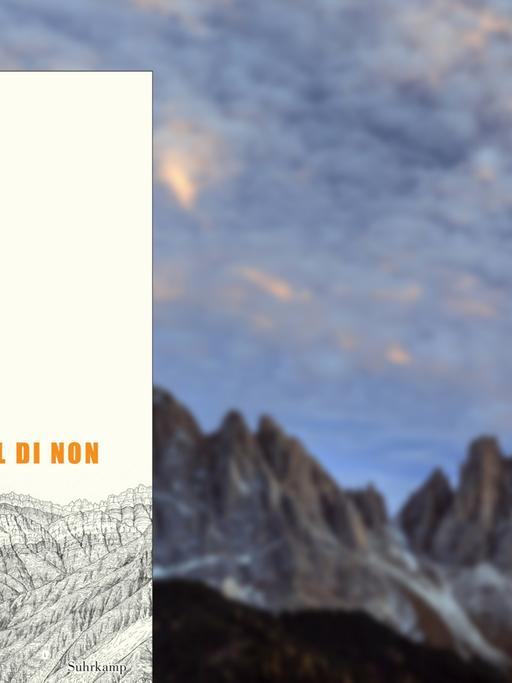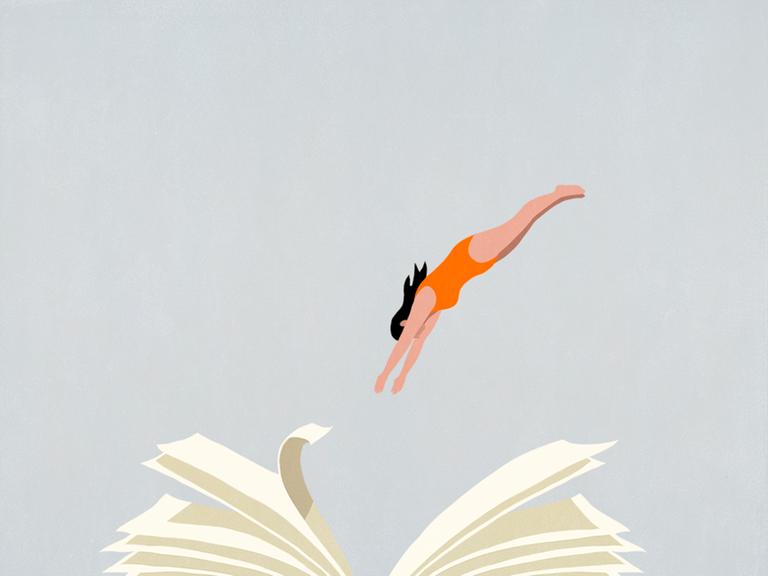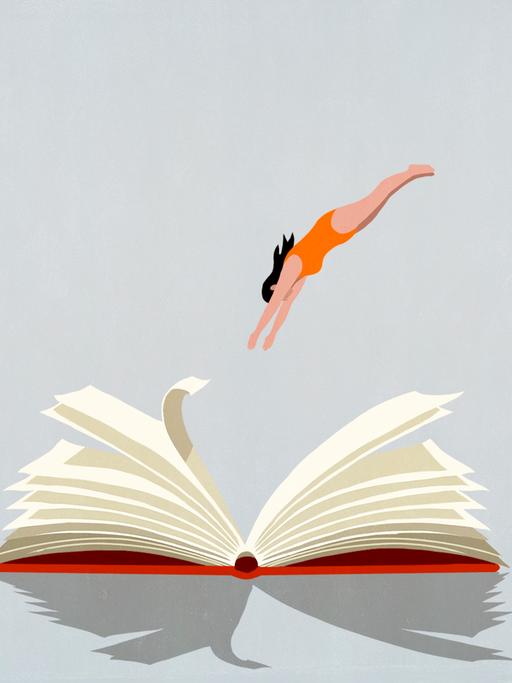Wenn eine Erzählfigur Stimmen hört, denkt man schnell an prophetische Geschichten, in denen sich eine gottgleiche Instanz zu Wort meldet. Oder man vermutet eine Psychopathologie des Wahnsinns als Hintergrund, wie sie etwa Stephen King in seinem Roman „Shining“ ausgefaltet hat. Bei Oswald Egger indes lässt sich, genau genommen, noch nicht einmal von einer „Erzählfigur“ sprechen, eher ist es eine Art hochsensible Membran, durch die feinste Wahrnehmungs- und Sprachpartikel gleichsam diffundieren. Und „Stimmen hören“ – das klingt bei Egger so:
Zig Stimmen kamen aus den Ecken der Zimmer und Dielen, aus der Erde in den Gärten, sie kamen aus Kellern, den Winden, sie kamen aus dem Fluss, den Füßen und Flügeln der Vieher, sie kommen aus dem Wasserschlauchrauschen, aus den Fallen und den Füßen der Menschen, und aus den Wänden. Abklappernde, fast gefitzte Schnabelrad- und Hohlklopfkreisel; trombenartige, dumpfe, untönendere Unumstimmungen und Übereinstimmungen.
Auffallend an diesem assoziationsreichen Sprachschlauchrauschen ist nicht nur die Dichte der Eindrücke, es ist auch der raffinierte Bau der Formationen. Über die i-Laute der „Zig Stimmen“, „Zimmer“ und „Winde“ geht es zu den f- und u-Lauten von „Fluss“, „Füßen“ und „Flügeln“ hin zu den dumpfen o’s der „Hohlklopfkreisel“, bis sich der Klangstrom aus Anziehungs- und Abstoßungskräften in Wörtern wie „Unumstimmungen“ und „Übereinstimmungen“ selbst reflektiert. Kein Wunder, dass es nur eine halbe Seite später heißt:
Ich habe von Anfang an die Stimmen laut gehört und stets ganze Sätze.
Stimmen aus dem Wasserschlauchrauschen
Als Oswald Egger im letzten Jahr den Georg-Büchner-Preis erhielt, beendete er seine Dankesrede mit ein paar Andeutungen über einen unbekannten Dichter, der im August 1912 in verwahrlostem Zustand von der Polizei aufgegriffen und in die Straßburger Nervenklinik gebracht wurde, weil er versucht habe, in die Ill zu springen, den dortigen Fluss, den er für den Mississippi hielt. Nun hat Egger die rätselhaft anmutenden Sätze quasi auf- und eingelöst und ein ganzes Buch zu diesem Oskar Fiala geschrieben, zu dem er damals knapp notierte:
Der Fall Oskar Fiala (geboren 1893 in Leipzig) erweckte bei den Ärzten sowohl hinsichtlich des Verlaufs als auch hinsichtlich der Symptomatologie ein großes Interesse und wurde wegen seiner klinischen Eigenartigkeit und Ungewöhnlichkeit auf der 42. Versammlung der südwestdeutschen Irrenärzte zu Straßburg vorgestellt.
„Fugue“ nennt die psychologische Forschung jene geistigen Phasen, in denen die eigene Identität einer Amnesie unterliegt. Eine „dissoziative Störung“, so im Fachjargon weiter, bei der Betroffene zeitweise jede Erinnerung an die eigene Person verlieren und neue Identitäten bilden.
Anstoßungs- und Abstoßungskräfte
Oswald Egger allerdings interessiert sich weniger für die Beschreibungen der Psychologie als für die andersartigen Wahrnehmungen und Sätze, die im Kopf und vor allem im Körper jenes Menschen entstehen, der den Namen Oskar Fiala trägt, sich aber ebenso William Harriman oder Sterad Stedvirag nennt. Fiala hört nicht nur Stimmen. Auch sein Sehen ist verschoben:
Ich habe vergessen, was das Sehen ist. Und ich bin so müde davon, die Augen fielen auch vor Müdigkeit ein, es ist zu laut (und licht) ununtereinander.
Stattdessen entdeckt er zum Beispiel „Farbverkettungen“, „Abstufungen“ und die „Lichtoffenheit der Koloration“. Und erst recht ist seine Kognition verändert. Etwas zu denken, als bewusster Akt – für Fiala unvorstellbar. Mal sind ihm die Gedanken flottierende Fetzen, mal kreidebleiche Wesen „mit glühend geschwollenen Augen“:
Ich kann die Gedanken sogar laut und spürbar sehen, als ob Blitze nach allen Seiten hin ausspießen. Fast immer sind diese Gedanken gemacht, eingejagt, zugegeben, abgezogen – nur, zu welchem Ende, und wie?
Poetische Elementarkunde
Das Ich wiederum, die hehre Instanz aus Philosophie und Soziologie, wird ironisiert als „Ich-Ich“, als „nachschnabelndes, krauses, strotzendes Selbstgeflecht“:
Es ist ein Schwinden der eigenen Menschlichkeit, des eigenen Seins, des eigenen Ichs, ein wildes Chaos in den tiefsten psychischen Regionen.
Oswald Egger geht es gerade nicht um jene Pathologisierung, auf die die damalige Psychologie abzielte, er macht vielmehr die ganz und gar eigene Art von Fialas Erfahrungen stark. Und er reflektiert diese Zusammenhänge zugleich. So zeigt er gewissermaßen ex negativo die Kategorien und Konzepte, die „Zurichtungen“ auch, mit denen man sich als Mensch alltäglich durch die Welt bewegt: kausale und aussagenlogische Verknüpfungen etwa oder Dualismen wie „oben und unten“ oder „hinten und vorne“. Wohingegen das Ausgeliefertsein an jede einzelne Erscheinung wie bei Fiala eine völlig andere Form von „Welterleben“ hervorbringt.
Eis- und Feuermetaphorik
Ein Welterleben, das Egger konsequent für seine eigentümliche poetische Durchdringung der Welt nutzt. Sein Buch hat er in drei große Kapitel unterteilt, die sich dem Bewusstsein Fialas bzw. seiner beiden Alter Egos William Harriman und Sterad Stedvirag widmen und, die, so schreibt Egger, teils mit Originaltexten Fialas arbeiten. Dazu gibt es ein kurzes Nachwort zur historischen Figur Oskar Fiala, das aber seinerseits von Fiktionen und poetischen Fügungen lebt.
Wie schon in seinem Buch „Euer Lenz“ von 2013 und in seinem zuletzt erschienenen Mississippi-Band spielt Oswald Egger mit Paradoxien und Negationen alltäglicher Begriffe. Er hantiert mit Eis- genauso wie mit Feuermetaphorik, streut Zeichnungen ein, nimmt Redewendungen wörtlich und betrachtet Wörter immer wieder als Dinge. Oder er wiederholt ganze Passagen derart geschickt, dass man es oft erst beim zweiten oder dritten Lesen bemerkt.
So gelingt es ihm auf faszinierende Art und Weise, seiner poetischen Elementarkunde ein weiteres Kapitel hinzuzufügen. Ein Buch, in dem die Gedanken tatsächlich „zur Stirn hinaus“ fliegen können. Auf dass der „alte Hexer“, der einmal erwähnt wird, recht behalten soll:
Sowie ich schaue, verwandelt sich ja alles.