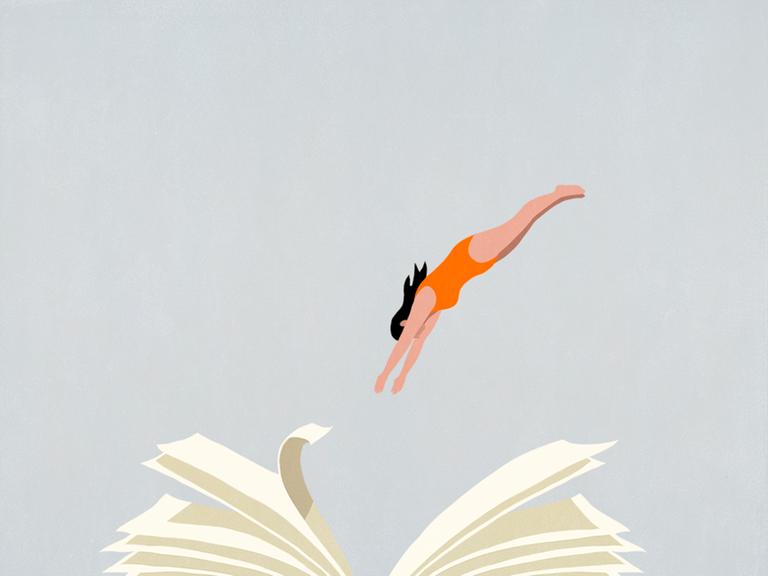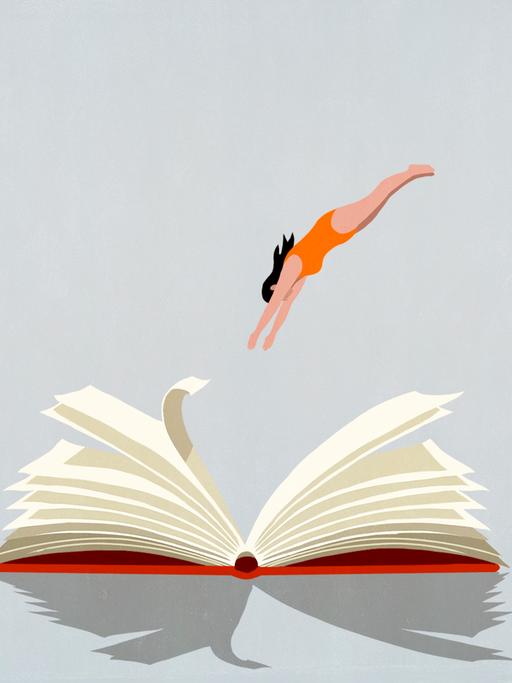,Es muss sich um einen Irrtum handeln‘, sagte Sara.
‚Oh nein, das ist kein Irrtum.‘
‚Aber ich würde niemals –‘
‚Der Algorithmus weiß, was Sie vorhaben, bevor es Ihnen selbst klar ist. Das ist wissenschaftlich erwiesen. Die gesetzlich bestimmte Einbehaltung erfolgt zu Ihrem eigenen Besten. Sie verhindert, dass Sie impulsiv handeln.‘
Laila Lalami: "Das Dream Hotel"
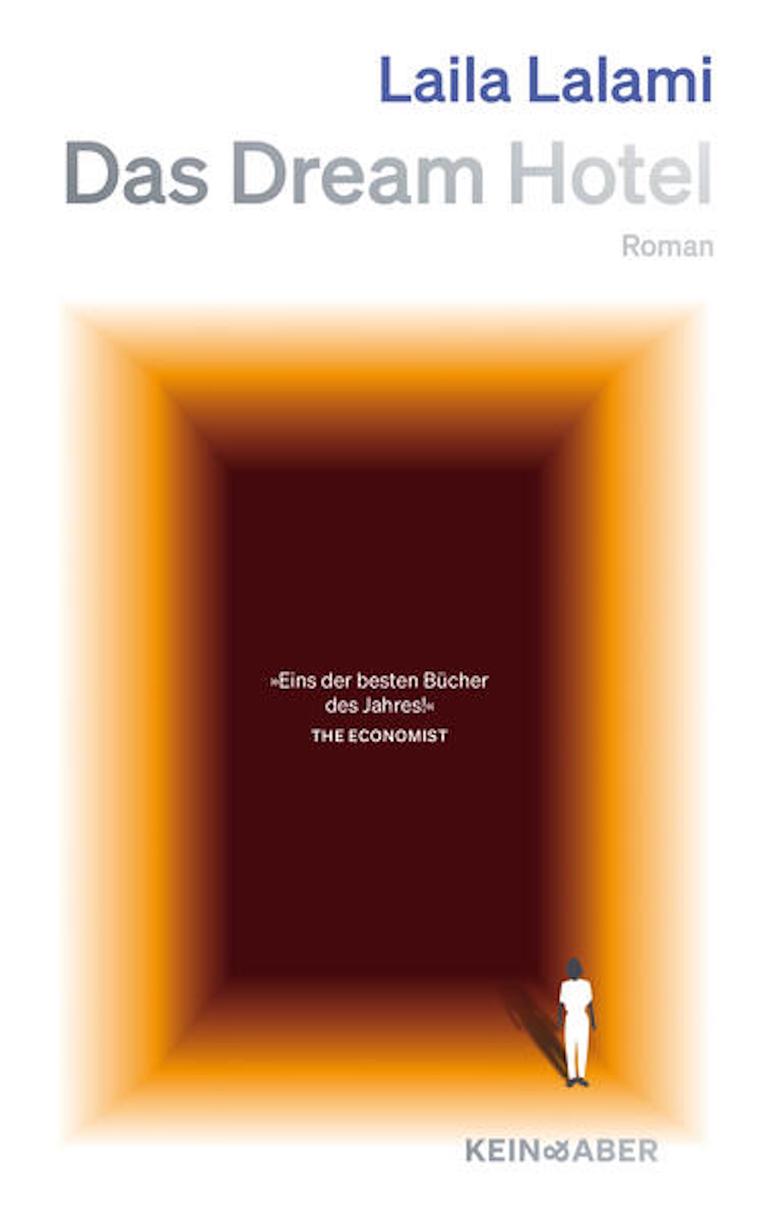
© Kein & Aber Verlag
Beängstigend aktuelle Überwachungsdystopie
06:25 Minuten
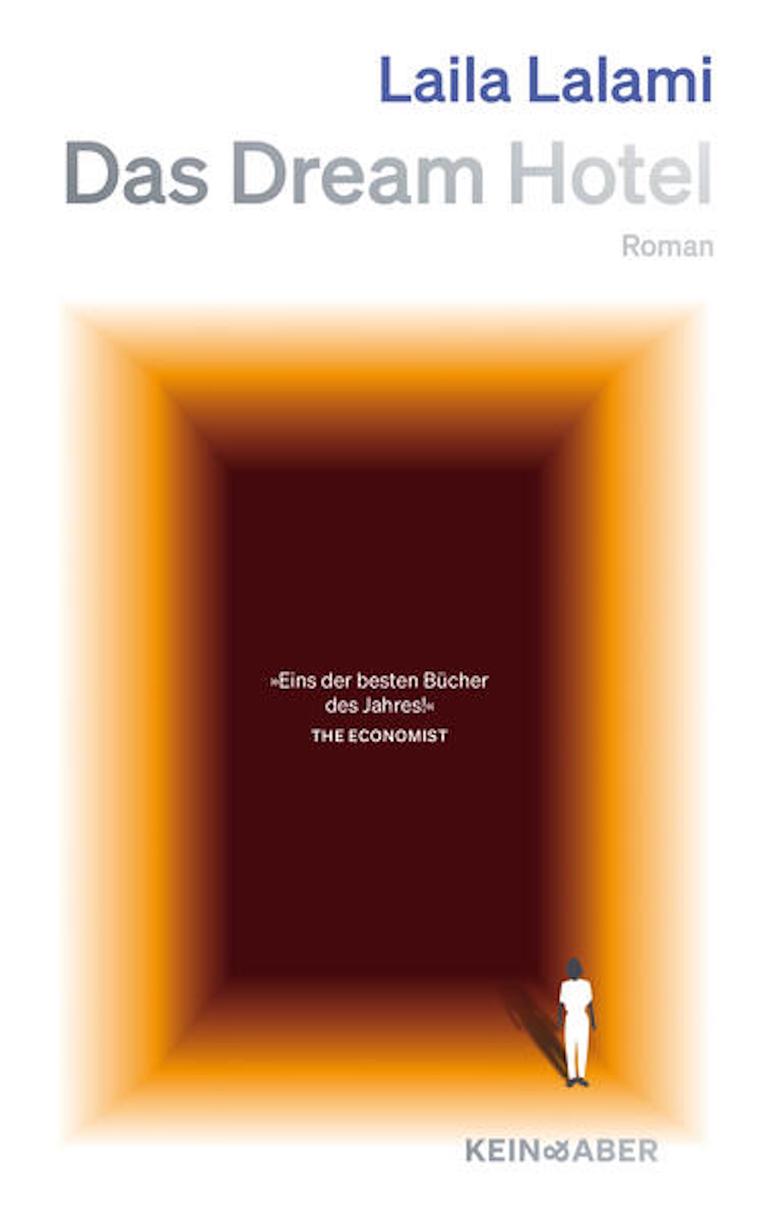
Laila Lalami, aus dem Amerikanischen übersetzt von Michaela Grabinger
"Das Dream Hotel" Kein & Aber, Zürich 2025496 Seiten
26,00 Euro
Eine junge Frau wird von einem Algorithmus als "Sicherheitsrisiko" eingestuft - und verliert ihre Freiheit: Laila Lalami entwirft das Bild einer Gesellschaft, die im Namen der Sicherheit alles opfert. Beängstigend realistisch, beklemmend nah.
Jemand musste Sara H. verleumdet haben. Denn ohne dass die junge Mutter etwas Böses getan hätte, wird die Hauptfigur von Laila Lalamis neuem Roman eines Morgens verhaftet. Und zwar nach der Rückkehr der Archivarin von einer Konferenz in London, am Flughafen von Los Angeles, wo ihr Mann mit den Kindern auf sie wartet. Eine Beamtin überprüft ihre Daten und winkt Sara aus der Reihe. Es folgt eine kafkaeske Befragung mit dem Ergebnis: Saras „Risikowert“ ist zu hoch, sie stelle eine Gefahr dar, vor allem für ihren Mann. Weshalb man sie einbehalten müsse, für 21 Tage, bis der Risikowert wieder im grünen Bereich sei.
Jeden Hinweis auf Anderssein verbergen
291 Tage später wartet Sara noch immer auf ihre Entlassung, in einer Einrichtung namens Madison, in der sie und andere Frauen lückenlos überwacht werden. Wer es wagt, das Madison als „Gefängnis“ zu bezeichnen, riskiert eine Verlängerung seines Aufenthalts. Wobei dazu zur Not auch schon die falsche Frisur reicht. Denn die Regeln im Madison sind darauf angelegt, dass es zu immer neuen Verstößen kommt. Schließlich will man die „Einbehaltenen“, wie sie offiziell genannt werden, hier möglichst lange als billige Klickarbeiterinnen ausbeuten. Anpassung und Gehorsam scheinen der einzige Weg zurück in die Freiheit zu sein, woran Sara auch ständig erinnert wird, von ihrem Mann ebenso wie von ihrem Vater und ihrem Anwalt.
Wenn sie im Madison etwas gelernt hat, dann, dass Wohlverhalten im Körper beginnt. Der Trick besteht darin, jedes Aufflackern von Persönlichkeit, jeden Hinweis auf Anderssein zu verbergen. Aus weißen Kuppeln an der Decke sehen die Kameras zu.
Die Überwachungsdystopie spielt in einem Amerika der nahen Zukunft, das dem heutigen aber gespenstisch ähnelt, ob man nun an die Verhaftungsorgien durch Trumps Einwanderungsbehörde denkt oder an Palantir, den Hersteller von Überwachungssoftware. Die literarischen Vorbilder liegen auf der Hand: Neben Kafka, Dave Eggers’ „The Circle“ oder Jessamine Chans „Institut für gute Mütter“ ist es vor allem Philip K. Dicks Erzählung „Minority Report“, in der Täter verhaftet werden, noch ehe sie ihre Verbrechen begangen haben. In dieser von Steven Spielberg verfilmten Erzählung dominierte die Sicht der Behörden – Lalamis „Das Dream Hotel“ wird dagegen fast ausschließlich aus der klaustrophobischen Perspektive der Hauptfigur erzählt.
Träume werden aufgezeichnet und überwacht
Und Lalamis Protagonistin lässt die Frage, warum der Algorithmus sie für eine Gefahr hält, nicht mehr los. Alle möglichen Parameter scheinen dabei eine Rolle zu spielen: zum Beispiel ein belangloser Streit mit einem Störenfried auf Facebook. Oder die Erfahrung sexueller Gewalt in ihrer Jugend. Oder ein vorbestrafter Cousin. Alles Daten, die das Gewaltpotenzial der jungen Mutter angeblich erhöhen sollen, jedenfalls statistisch gesehen.
Nicht zuletzt sind es aber Saras Träume, die das „Amt für Risikobewertung“ alarmieren. Aufgezeichnet wurden sie von ihrer „Neuroprothese“, die Sara zur Verbesserung ihrer Schlafqualität implantieren ließ. Dass das Gerät auch ihre Träume weiterleitet, ist übrigens völlig legal; es stand ausdrücklich in den Geschäftsbedingungen.
Die Darstellung von Saras wachsender Verunsicherung gehört zu den Stärken von Lalamis Roman. Bald schon führt sie im Madison ein Traumtagebuch zur Selbstvergewisserung, grübelt über ihre Ehe oder Erlebnisse in ihrer Kindheit. Doch was ist mit ihrem Mann, glaubt er überhaupt noch an ihre Unschuld? Und wie enttäuscht muss ihr aus Marokko eingewanderter Vater sein, der sie im Umgang mit den Behörden doch stets zu einer „migrantischen Vorsicht“ ermahnt hatte?
KI und Algorithmen bestimmen die Welt
Sara erweitert ihre Froschperspektive durch Recherchen im Internet und ihr Nachdenken über gesellschaftliche Entwicklungen. Dazu streut Laila Lalami weitere Dokumente zwischen die Kapitel ein, zum Beispiel Protokolle des Wachpersonals oder Arztberichte. Und dann gibt es noch recht genau in der Mitte des Romans ein Kapitel aus der Sicht einer Programmiererin des Sicherheitsunternehmens. Doch so viele Erwartungen zum weiteren Handlungsverlauf gerade dieses Kapitel weckt, es führt ebenso ins Nichts wie Saras Recherchen über eine Jugendfreundin, die sich schon früh für ein Offline-Leben entschieden hatte.
Schade, dass Laila Lalamis 500-Seiten-Roman, den Michaela Grabinger in ein flüssig zu lesendes Deutsch übersetzt hat, an einigen erzählerischen Schwächen leidet: vom narrativen Leerlauf gerade in der ersten Hälfte bis zu besagten losen Handlungsfäden. Denn davon abgesehen ist „Das Dream Hotel“ ein ebenso erschreckender wie hellsichtiger Kommentar zu einer Gegenwart, die im Hintergrund längst von undurchsichtigen Algorithmen und KIs bestimmt wird. Und in der am Ende womöglich alles darauf ankommt, ob wir die Geschäftsbedingungen auch wirklich gelesen haben.