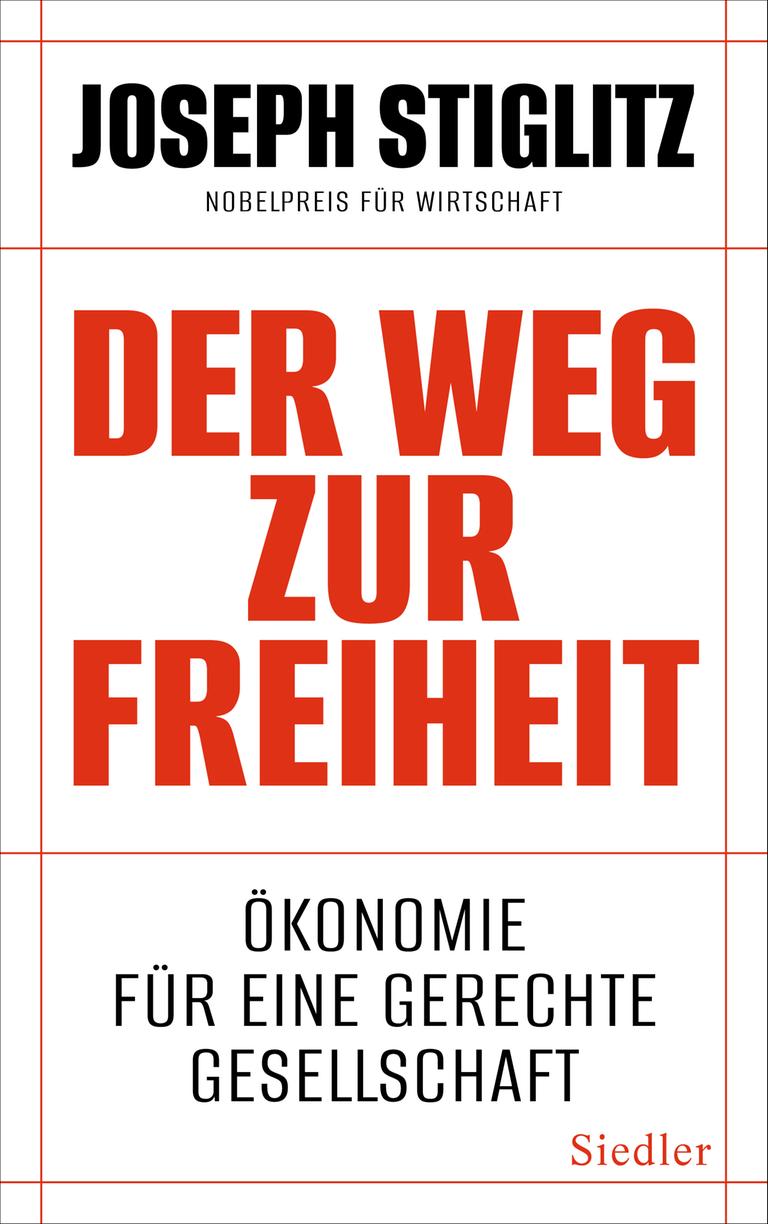Der Weg, den dieses Buch beschreitet, ist kein utopischer. Denn Joseph Stiglitz will nicht etwa den Kapitalismus überwinden. Stattdessen möchte er durch Kritik am neoliberalen Denken aufzeigen, warum man sich von diesem abwenden muss, um eine humane Gesellschaft zu ermöglichen. Am Neoliberalismus, der seinen Siegeszug Anfang der 80er-Jahre antrat, kritisiert er vor allem den eingeschränkten Freiheitsbegriff. Denn hier gehe es primär um die Freiheit sich selbst regulierender Märkte und um die individuelle Freiheit miteinander konkurrierender Wirtschaftsubjekte. Dem setzt Stiglitz folgendes entgegen:
„Eine Grundannahme dieses Buches lautet, dass die Freiheit einer Person oft gleichbedeutend ist mit der Unfreiheit einer anderen Person beziehungsweise, anders formuliert, dass die Stärkung der Freiheit des einen oftmals auf Kosten der Freiheit des anderen geht. Nur durch kollektives Handeln, durch eine Regierung, können wir ein Gleichgewicht der Freiheiten erreichen.“
Freiheit als sozialer Begriff
Stiglitz denkt Freiheit als ein widerspruchsvolles soziales Beziehungsgeschehen. Es sei eng mit Gerechtigkeit, Gleichheit und kollektivem Wohlergehen verbunden und daher zu regulieren. Zur Begründung diskutiert er verschiedene Freiheits-, Vertrags-und Gerechtigkeitskonzepte. Vor diesem Hintergrund attackiert er dann neoliberale Vordenker wie Friedrich A. Hayek und Milton Friedman und schließt sich dem vernichtenden Urteil maßgeblicher Kritiker an. Diese sagten vorher:
„dass ungezügelte Märkte ineffizient, instabil und ausbeuterisch seien und ohne geeignete staatliche Eingriffe von Unternehmen mit großer Marktmacht beherrscht werden würden, was erhebliche Ungleichheiten mit sich brächte. Sie wären kurzsichtig und würden Risiken nicht gut absichern. Sie würden die Umwelt verschmutzen. Und die Maximierung des Börsenwertes von Unternehmen würde, anders als von Friedman behauptet, nicht zur Maximierung des gesellschaftlichen Wohlergehens führen. Diese Vorhersagen seitens der Kritiker unregulierter Märkte haben sich bestätigt.“
Eine Bestandsaufnahme neoliberaler Probleme
Diese Kritik ist allerdings, wie Stiglitz ja selbst schreibt, wohl bekannt. Der Wert des Buches besteht denn auch weniger darin, Neues zu sagen, als darin, die Probleme rigiden neoliberalen Marktdenkens noch einmal breit vor Augen zu führen. Dem Autor gelingt das verständlich.
Er schreibt engagiert, bisweilen auch polemisch und bringt eigene Erfahrungen als Politikberater und Chefökonom der Weltbank ein. So kann man ausführlich nachlesen, warum Märkte nicht von ihrer sozialen, politischen und ökologischen Umwelt isolierbar sind. Oder wie sie Informationsungleichgewichte und undemokratische Medienmacht erzeugen.
Anregend ist das Buch besonders dann, wenn Stiglitz neoliberale Argumente direkt mit seinem Freiheitskonzept konfrontiert. Etwa das Argument, Staatsschulden würden folgende Generationen einschränken. Stiglitz widerspricht, weil es erstens eine Gesellschaft ärmer mache, wenn Austeritätspolitik Infrastruktur und Umwelt gefährde.
„Zweitens sind Schulden eine Finanzverbindlichkeit, keine reale Verbindlichkeit. Dagegen sind Umweltschäden eine reale Belastung für künftige Generationen. Die Folgen lassen sich nur dadurch begrenzen, dass man künftige Generationen dazu zwingt, Geld auszugeben, um die Schäden zu beheben. Dadurch, dass wir Umweltzerstörung zulassen, geben wir den heutigen Verschmutzern mehr und künftigen Generationen weniger Freiheit. Dies ist die wirkliche transgenerationale Freiheitsabwägung.“
Das Buch bezieht sich hauptsächlich auf die USA, macht aber auch deutlich, dass die neoliberale Wirtschaftsordnung neokolonialen Charakter besitzt. Eindrücklich belegt Stiglitz, wie internationale Vereinbarungen und Organisationen den freien Kapitalfluss westlicher Länder garantiert haben, aber die Freiheit der Entwicklungs-und Schwellenländer einschränkten.
Sein Gegenkonzept einer humanen Gesellschaft nennt der Autor „progressiven Kapitalismus“ oder „erneuerten Sozialdemokratismus“. Dieser beruhe auf einer verstärkten Kontrolle der Märkte und einem dynamischen Mix aus privaten, öffentlichen, gemeinnützigen und genossenschaftlichen Unternehmensformen. Oft lesen sich Stiglitz‘ Vorschläge dabei wie die genaue Kehrseite neoliberaler Realitäten.
Gegenkonzept bleibt allgemein und skizzenhaft
„So sollten zum Beispiel Investitionsabkommen nicht das Recht eines Landes beeinträchtigen, im Interesse seiner Bürger zu regulieren oder zu besteuern. Wir brauchen einen internationalen Rechtsrahmen für die Lösung von Überschuldungskrisen, vergleichbar mit innerstaatlichen Insolvenzverfahren, bei denen das Wohl des Schuldners und umfassendere gesellschaftliche Interessen berücksichtigt werden. Wir brauchen ein internationales Finanzregulierungssystem, das die Arten von Krisen, die wir immer wieder sehen, unwahrscheinlicher und, wenn sie auftreten, weniger tief macht.“
Stiglitz Absicht, eine breite und sehr grundsätzliche Kritik des Neoliberalismus vorzulegen, geht leider zu Lasten seines Gegenkonzepts, das allgemein und skizzenhaft bleibt. Das Buch enthält das Vermächtnis eines linkskeynesianischen Kritikers des Neoliberalismus der letzten Jahrzehnte. Diesen Text hat er vor der zweiten Präsidentschaft von Donald Trump geschrieben und markiert darin bereits die Anzeichen einer neuen, aggressiven Phase eines merkantilistisch angereicherten Neoliberalismus. Er warnt davor, hält kämpferisch an der Hoffnung auf einen anderen Gang der Geschichte fest und hilft dabei, die Wurzeln der aktuellen Entwicklung zu verstehen.