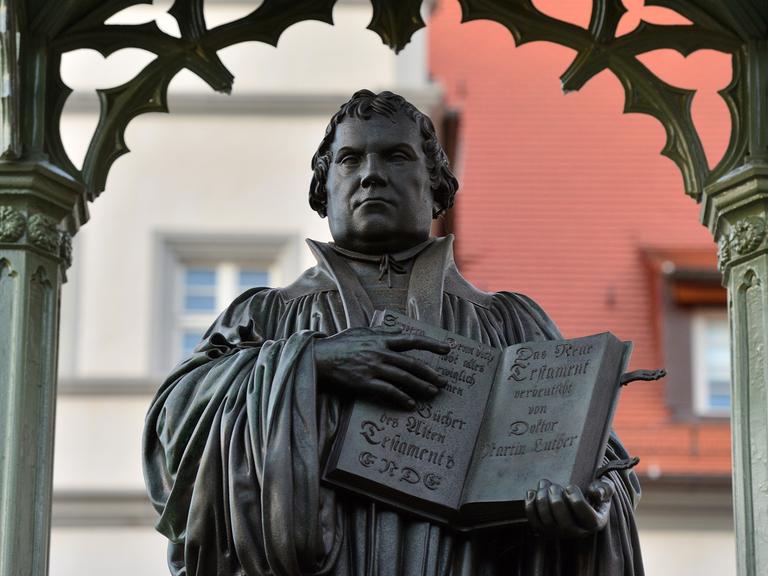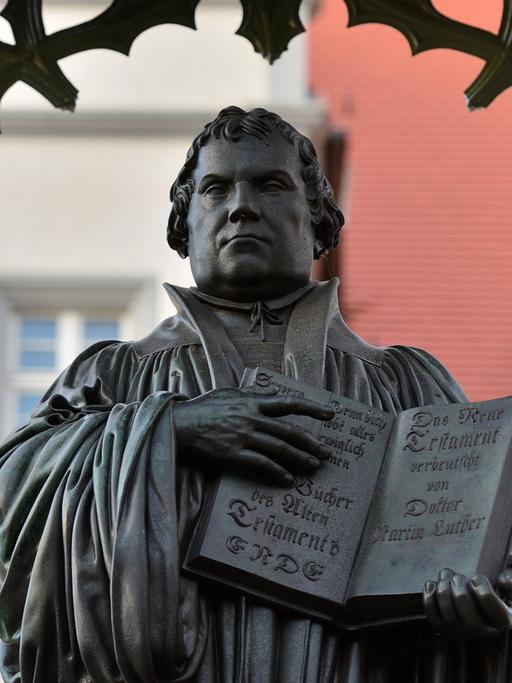"Der Kontakt mit der Kultur scheint mir verloren"
Die Kirchen haben sich von der säkularen Kultur entfernt, meint der Theologieprofessor Hans-Martin Barth. Er fordert eine "Inkulturation" des Evangeliums in die weltliche Musikszene, die Bildenden Kunst und die Literatur. Beide Seiten müssten neue Initiativen entwickeln, damit das Christentum wieder die europäische Kultur mitgestalten könne.
Gabi Wuttke: Die Adventszeit, der Heilige Abend, ein allumspannendes Ritual in der christlichen Welt. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen! In Deutschland gibt es immer weniger Protestanten und Katholiken, die an die Botschaft aus Betlehem glauben, obwohl die Sehnsucht nach Harmonie und Glück groß ist. Welche Konsequenz sollten die christlichen Kirchen daraus ziehen? Der evangelisch-lutherische Theologe Professor Hans-Martin Barth plädiert dafür, diese Entwicklung als Chance zu begreifen. Einen schönen guten Morgen, Herr Barth!
Hans-Martin Barth: Guten Morgen, Frau Wuttke!
Wuttke: Warum kann es für die Kirchen fruchtbar sein, dass immer weniger Menschen keiner Konfession angehören?
Barth: Also, dass diese Tatsache als solche für die Menschen fruchtbar ist, das glaube ich weniger. Vielleicht kriegen die Kirchen, wenn sie kleiner werden, ein klareres Profil. Vielleicht lösen sie dann auch weniger Missverständnisse aus. Gut tut ihnen, wenn sie sich von den Konfessionslosen infrage stellen lassen, wenn sie sich herausfordern lassen, wenn sie sich darüber klarer werden mindestens, wieso so viele Menschen mit der Botschaft des Evangeliums nichts mehr anfangen können. Wenn sie vielleicht übergeistesgeschichtliche Bewegungen in den Blick bekommen, die heute einfach unsere Welt bestimmen.
Wuttke: Was genau meinen Sie damit, sich herausfordern zu lassen? Wie, an welchen Punkten bereichern sich denn im Hier und Jetzt nicht religiöse und religiöse Menschen, was hat die Institution Kirche, die ja alle Hebel in Bewegung hat, die verbliebenen Schäfchen beisammenzuhalten, bislang nicht genügend zur Kenntnis genommen?
Barth: Ich vermute, dass die Kirchen sich noch nicht darüber im Klaren geworden sind, wie weit sie sich von der säkularen Kultur entfernt haben. Und der Kontakt zur Kultur erscheint mir weitgehend verloren. Wenn Sie an das denken, was sich heute in der Musikszene tut oder auch im Bereich der bildenden Kunst – Gerhard Richter oder an wen auch immer Sie denken, in der Literatur ist es ebenso. Insgesamt, scheint mir, ist eine neue Inkulturation des Evangeliums in Europa nötig. Wenn man an Asien oder Afrika denkt, dann spricht man natürlich von Inkulturation, aber dass wir auch hier eine neue Einpflanzung sozusagen des Evangeliums in unsere säkulare Kultur brauchen, das haben, glaube ich, die Kirchen auch noch nicht genügend zur Kenntnis genommen. Ich meine, das Christentum hat einmal die Kultur Europas bestimmt. Jetzt haben wir eine Kulturbeauftragte der Kirche, das ist irgendwo eine groteske Entwicklung. Und ich denke, es muss einfach zunächst einmal wieder zu einem Dialog kommen zwischen den Kulturschaffenden und denen, die sich in der Kirche engagieren. Da treten diese beiden Welten immer mehr auseinander. Wenn man sich nicht mehr kennt, dann hat man sich natürlich auch nichts mehr zu sagen. Die Kirche versteht sich immer noch als eine öffentliche Größe und die Gottesdienste sind öffentlich, aber faktisch werden sie besucht wie Sektenveranstaltungen. Es gibt kein richtiges Forum sozusagen, auf dem diese beiden Welten sich begegnen könnten. Und hier müsste - von beiden Seiten her, müssten neue Initiativen gefunden werden.
Wuttke: Helfen Sie uns und übersetzen Sie bitte, was Sie unter religionstranszendentem Christensein verstehen!
Barth: Ich verstehe darunter ein Christsein, das sich mit Religion nicht abspeisen lässt, das nicht mit Weihnachtsstimmung und Kerzen und Geschenken sich zufrieden gibt. Ich verstehe auf der anderen Seite darunter ein Christsein, das sich durch Religion nicht abschrecken lässt, das durch die herkömmlichen Gottesdienstformen oder das herkömmliche Erscheinungsbild der Kirche sich nicht sozusagen aus der Kirche vertreiben lässt. Sondern es müsste ein Christsein sein, das irgendwie als authentisch rüberkommt, das nahe ist bei dem Jesus der Evangelien, bei dem erwachsenen Jesus, der in sein eigenes Engagement für andere Menschen einen hineinzieht, oder, wenn Sie es mit einer Wendung der früheren amerikanischen Tod-Gottes-Theologen sagen wollen, dass Jesus ein Platz ist, an dem man sein kann, von dem aus dann man auch etwas bewegen kann.
Wuttke: Wenn die christlichen Kirchen sich Ihres Vorschlags annehmen würden, herr Barth, welche Tragweite hätte das denn wiederum für die Religionsgeschichte?
Barth: Ja, wie das mit der Religionsgeschichte weitergeht, das ist ja ohnehin eine eigene Frage. Ich habe ja die These vertreten, dass die Religionsgeschichte weitergeht, nicht nur in dem Sinne, dass neue Religionen sich bilden, sondern dass künftig auch ein Teil der Menschheit sich ins Areligiöse hinein entwickeln könnte, dass es also gleichsam so eine Gabelung in der Religionsgeschichte gibt, in einen religiösen und in einen areligiösen Zweig, nachdem die Zahl der Areligiösen und religiös Desinteressierten nun doch so stark nicht nur bei uns in Mitteleuropa zugenommen hat. Aber welche Tragweite hätte es für die Kirche, könnte man natürlich weiterfragen. Ich denke, die Kirchen müssten versuchen, barrierefrei zu werden und eine Atmosphäre in ihren Räumen zu schaffen, die einfach ansprechend ist und die zeigt, dass hier ein freier, lebendiger Geist herrscht, der zum Leben beiträgt und zur Lebensfreude beiträgt. Und das könnte natürlich auch Konsequenzen für die Gesellschaft haben, die dann hier einen anderen Lebensstil wahrnehmen würde, der einerseits im Protest gegenüber unserer Konsum- und Kapitalismusgesellschaft bestehen würde, der aber auch vielleicht die Kirchen als konstruktive Partner auf der Suche nach neuen Zielen, nach einem neuen Wirtschaftssystem, nach neuen Zielen für Europa suchen ließe.
Wuttke: Der Theologiewissenschaftler Hans-martin Barth am Morgen vor Heiligabend. herr Barth, besten Dank und ruhige und gute Feiertage!
Barth: Vielen Dank, Frau Wuttke!
Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Deutschlandradio macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.