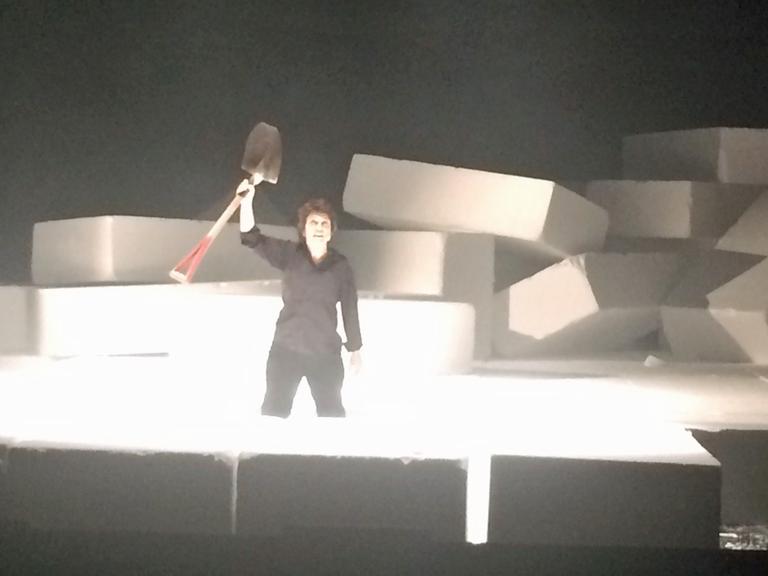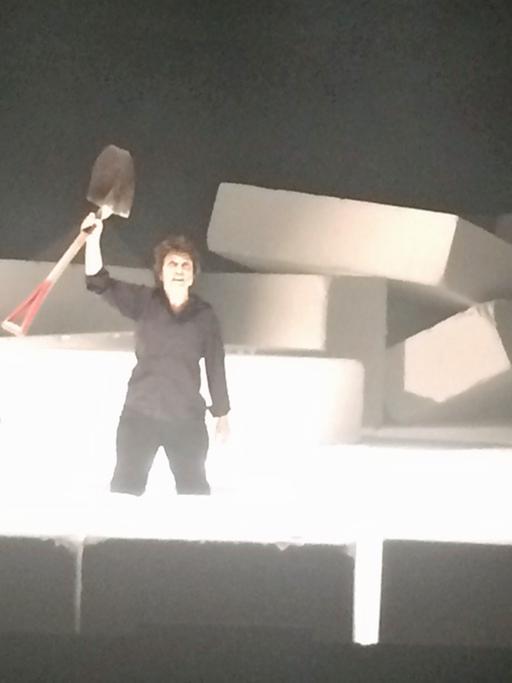Von den produktiven Freiheiten an deutschen Bühnen

Christiane Jatahy war ein Geheimtipp – bis sie gleich zwei Stücke am Thalia Theater inszenierte. In ihrer Heimat Brasilien kam die religiös grundierte Zensur wieder auf, in Deutschland kann sie frei inszenieren. Und es gibt noch weitere Unterschiede. Ein Gespräch.
Zunächst waren da mal diese Zwangsferien, also die deutsche Theatersommerpause – die gibt’s so nicht im brasilianischen Sommer, von Dezember bis Carnaval also; im Gegenteil – gerade der Beginn des Jahres ist eine gute Zeit für Premieren.
Aber über diese erste Irritation hinaus: Fundamental wichtig für die Fremde in Deutschland ist das Gefühl gewesen, auf Dauer gestützt und unterstützt zu werden vom "Betrieb"; das sei nun wirklich völlig anders als daheim.
Schon die Planung des Projekts, die forschende "pesquisa", die Recherche, ist willkommen und abgesichert; das fest angestellte Ensemble lässt sich vorurteilslos ein auf neue Regie-Handschriften – und die fertige Vorstellung bleibt auf Dauer im Repertoire, sie ist nicht tot nach ein par Aufführungen!
Und erst der feste Spiel-Raum! In Brasilien suchte sie einen Proben-Ort und war später mit der Aufführung ständig unterwegs, auf verschiedensten Bühnen – hier ist alles unter einem Dach.
Für das ständige Hin und Her zahle jeder und jede im Kunstbetrieb daheim einen hohen Preis; gleichzeitig aber, das sei nicht vergessen, fördert die Dauerkrise im Alltag perfiderweise ja auch Phantasie und Erfindungsgeist. Wenn Formen und Methoden scheitern, müssen eben neue her.
Europas Problem mit den Geflüchteten
Zudem wird Christiane Jatahy in Deutschland nicht eingeladen, um irgendetwas zu inszenieren, was sich der Gastgeber ausgedacht hat – sie kann frei agieren mit den eigenen Mitteln und Methoden:
Beim "Theater der Welt" etwa nahm sie Strukturen einer früheren Arbeit in Rio wieder auf – in Recherche-Gesprächen unter Geflüchteten und mit der Video-Wirkung der Live-Kamera. Und auch in Bearbeitungen, etwa "Julia" nach Strindbergs "Fräulein Julie", Tschechows moskausüchtigen "Drei Schwestern", der Geschichte vom 'wandernden Wald' nach Macbeth und jetzt beim Hamburger Koltés, ist Jatahy immer auch die Autorin; "Überschreibung" heißt das Mode-Wort dafür.
Gerade mit der jüngsten Thalia-Arbeit wird natürlich auch Europas Problem mit den Geflüchteten zum zentralen Thema. Christiane Jatahys Heimat war immer Vorbild: als Land der Einwanderung, des Ankommens. Angst vor dem Anderen und Mauern, real oder im Kopf, sind immer falsch.
Deutschland könne jetzt ein Beispiel sein, wenn es nur will – für das Entstehen von nichts weniger als einer "neuen Nation". Die alte Apartheid jedenfalls habe auf Dauer keine Chance.
In Brasilien meldet sich die Zensur wieder
Daheim in Brasilien allerdings geschieht gerade das Gegenteil – hier meldet sich die religiös und vielleicht demnächst politisch grundierte Zensur wieder zu Wort.
Das Jahr seit dem Putsch gegen die legitime Präsidentin Dilma sei geprägt von politischer Perversion, sagt Jatahy. Das Ende der Demokratie sei wieder denkbar geworden. Auch ein offen faschistisch und rassistisch argumentierender Kandidat wolle Präsident werden …
Auch deshalb ist Europa so wichtig für Christiane Jatahy. Und aus den verschiedenen Sprachen, ihrer und denen von Ensemble und Publikum, wachse gerade hier eine neue: die Produktionssprache des Theaters.
Nichts verstehen, jedenfalls nicht Wort für Wort, aber alles begreifen – das ist der Internationalismus des Theaters.