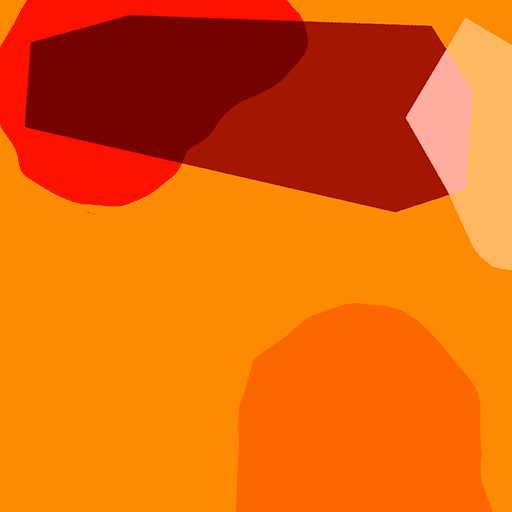Carolin Emcke: "Ja heißt ja und…"
Verlag S. Fischer 2019
112 Seiten 15 Euro
Wie guter Journalismus heute gelingen kann
111:16 Minuten

Was können die Medien, was können wir tun, um der Vertrauenskrise des Journalismus zu begegnen? Darüber haben wir mit der Publizistin Carolin Emcke gesprochen. Sie rät Reportern zu zwei Dingen: Demut und Verantwortungsgefühl.
Caroline Emcke hat als Reporterin und als Philosophin gearbeitet. Heute ist sie Publizistin mit unterschiedlichen Formaten und Tonlagen, Autorin mehrerer Bücher, ausgezeichnet unter anderem mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. Immer wieder kommentiert sie auch den Zustand von Journalismus und Öffentlichkeit in der gegenwärtigen Demokratie.
Im Gespräch mit Deutschlandfunk Kultur denkt sie über Themen nach wie die journalistische Gattung Reportage nach den Fälschungsfällen etwa beim "Spiegel", die Schwierigkeiten und Vorzüge Sozialer Medien wie Twitter und die Fehlbarkeit von Journalismus überhaupt.
Die ethische Last der Reportage
Bei der Arbeit als Reporterin haben ihr vor allem Recherchen und Reisen Freude bereitet, erzählt sie – die Begegnung mit Menschen in den Ländern und Krisenregionen, aus denen sie berichtete. Das Schreiben hingegen sei eine Qual gewesen – "weil mich die ethische Last der Frage, ob ich mich irre, umtreibt". Die Arbeit an einem persönlichen Meinungsstück wie der regelmäßigen Kolumne, die sie für die "Süddeutsche Zeitung" schreibt, sei völlig anders: "Da kann ich einen schlechten Gedanken haben oder nicht". "Bei der Reportage bleibe ich sehr lang unsicher, ob das stimmt, ob mein Eindruck richtig ist. Aber auch natürlich die Frage: Ist das, was ich erlebe und wahrnehme und dann in einem Text thematisiere, wirklich repräsentativ?"
Mit Blick auf die Fälschungen in Reportagen des ehemaligen "Spiegel"-Redakteurs Claas Relotius, die Ende vergangenen Jahres aufgedeckt wurden, sagt Emcke: "Man muss schon ein gewisses Desinteresse an der Wirklichkeit haben, wenn man glaubt, man kann auf Recherche verzichten oder auf Begegnungen oder auf das Reisen. Das ist ja der ganze Witz einer Reportage!"
Wenn es darum gehe, jenseits des konkreten Falls Relotius daraus zu lernen, dann, so ihre Hoffnung, könnte aus dem Fall eine größere Akzeptanz auch für Geschichten folgen, "die etwas gebrochener daher kommen, die etwas mehr Luft lassen auch für Verunsicherungen von Wahrnehmungen".
Emcke zählt zwei Voraussetzungen zu den grundlegenden beim Schreiben von Reportagen: Demut und Verantwortung. "Es gehört Demut dazu einfach im Wissen darum, dass man dauernd und die ganze Zeit Fehler macht." Und zum anderen Verantwortung für die "potenzielle Macht", die Reportagen insbesondere aus Krisenregionen im politischen Diskurs entfalten können.
Schließlich beobachtet Carolin Emcke zunehmend Angriffe auf den Journalismus, nicht zuletzt vonseiten der politischen Rechten. Und sie bekennt sich zur Orientierung an der Kritischen Theorie in einer Form, die auf unterschiedliche Weise für eine "emanzipative, an Menschen- und Bürgerrechten orientierte, offene, demokratische Politik" wirbt. "Ich denke natürlich darüber nach, wie man in einer Öffentlichkeit Räume öffnen kann, so dass sie inklusiver ist."
"Eine steile Lernkurve"
Zu Carolin Emckes Medienkonsum gehören Radionachrichten, digitale Zeitschriften- und Zeitungs-Abos – und der lustvolle Gang zum Kiosk. Ihre Überlegungen, wie die Sozialen Medien die gegenwärtige Öffentlichkeit prägen, nehmen vor allem die Plattform Twitter als Ausgangspunkt. Das Beispiel Donald Trumps zeige, wie gefährlich die Kombination von politischer Macht qua Amt und direkter Kommunikation mit einer 60 Millionen Accounts umfassenden Gefolgschaft sei.
Umberto Eco habe einmal verdeutlicht, dass zum Faschismus nicht zuletzt gehöre, Lärm zu produzieren – mit dem Effekt, dass sich das Publikum nicht so sehr mit der eigentlichen Politik befasse. Und Emcke erzählt von ihrer eigenen Erfahrung, auf Twitter massenhaft kritisiert zu werden.
Emckes Rückblick auf zwei gesellschaftliche Debatten, die ihren Ausgang auf Twitter nahmen, #metoo über Seximus und #metwo über Rassismus, fällt so aus: "Man konnte bei beiden Hashtags und bei dem, was dort beschrieben wurde, feststellen: Das ist in dieser Form vorher so nicht abgebildet worden. Es ist nicht repräsentiert worden in all dem, was wir glauben, was Qualitätsmedien doch abbilden würden. Es war in einer Wucht und in einer Stärke klar: Hier gibt es Menschen, die werden so stark marginalisiert, dass nicht einmal mehr wahrgenommen wird, dass es Marginalisierung gibt." Und: "Ich fand es auch als Publizistin eine steile Lernkurve."
So formuliert Emcke die Hoffnung, dass Erfahrungen wie diese zu Selbstreflexion auch innerhalb von Redaktionen der traditionellen Medien führt. "Dass sie sich selber befragen: Wie kann es sein, dass das bei uns nicht ausreichend abgebildet wird?"
Während in Sozialen Medien oft – so zitiert sie die Literaturwissenschaftler Ethel Matala de Mazza und Joseph Vogl – "politischer Unwille" artikuliert wird, erlebt sie politische Willensbildungsprozesse in ganz anderen öffentlichen Räumen. "Für mich sind Kirchen möglicherweise ein solcher Ort, Clubs möglicherweise ein solcher Ort, Buchhandlungen möglicherweise ein solcher Ort, aber eben Theater auch. Ich nehme Theater wahr als Orte, an denen Menschen miteinander sprechen, mit einer großen Geduld, mit einer großen Neugierde, mit großer Aufmerksamkeit."