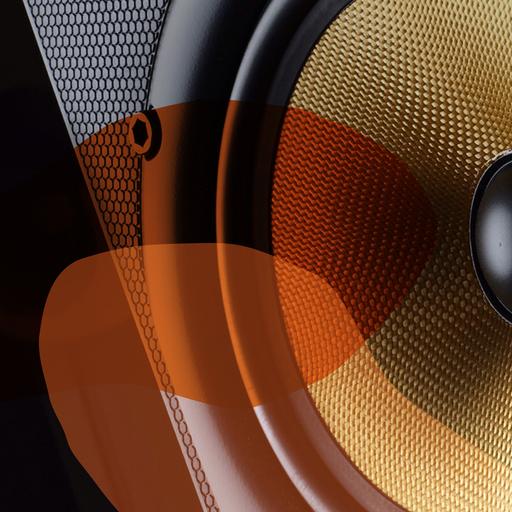Hans von Trotha, geboren 1965, hat in Heidelberg und Berlin Literatur, Geschichte und Philosophie studiert. Nach ersten publizistischen Arbeiten leitete er zehn Jahre lang den Nicolai Verlag. Trotha gilt als Spezialist für die Landschaftsgärten des 18. Jahrhunderts. Er arbeitet als freier Publizist und als Berater im Kulturbereich. Von ihm erschien u.a.: "Der Englische Garten. Eine Reise durch seine Geschichte", Verlag Klaus Wagenbach.
Warum sie oft zu negativ sind
03:45 Minuten

Kommt eine zweite Welle der Pandemie? Haben wir alles richtig gemacht? Das sind zurzeit die 100 Millionen-Dollar-Fragen. Manche versuchen es mit Antworten und liegen mit ihren Prognosen oft falsch. Den Publizisten Hans von Trotha wundert das nicht.
Wir neigen dazu, in drei Zeiten auf einmal zu leben: in der Gegenwart, in der Vergangenheit und in der Zukunft – mit unterschiedlicher Gewichtung. Das liegt einerseits am Menschentyp – es gibt einfach jene, die eher am Gestern hängen, solche, die ganz im Heute aufgehen, und die Sehnsuchtsvollen, denen nicht schnell genug Morgen sein kann. Die Gewichtung hängt aber, andererseits, auch von der Lage ab, der individuellen wie der allgemeinen. Insbesondere in Krisen versuchen wir, die Zukunft zu erahnen.
Wissenschaft wird durch Krisenzeiten aufgewertet
Gleichzeitig neigen wir dazu, in schwierigen Zeiten mehr als sonst auf die Wissenschaft zu hören – schließlich erwarten wir von irgendwoher Klarheit. Die Kombination aus dem Ohr an der Wissenschaft von heute und dem Herz in einer gedachten Zukunft gebiert eine Grauzone, die sich als literarisches Genre etabliert hat: Science-Fiction.
Im 18. Jahrhundert, der Zeit der Aufklärung, brachte dieses Genre vorwiegend Utopien hervor, also eine fröhliche Vision der Zukunft. Als im Verlauf des 19. Jahrhunderts mit dem zunehmenden Glauben an Wissenschaft und Technik auch die Angst vor beiden wuchs, schlug das, zumindest in der Tendenz, um: Science-Fiction neigt seither von Frankenstein bis Blade Runner dazu, in der Dystopie zu enden, das ist das Gegenteil einer Utopie. So gesehen, ist es eher kontraproduktiv, sich an eine imaginierte Wissenschaft der Zukunft zu klammern.
Im 18. Jahrhundert, der Zeit der Aufklärung, brachte dieses Genre vorwiegend Utopien hervor, also eine fröhliche Vision der Zukunft. Als im Verlauf des 19. Jahrhunderts mit dem zunehmenden Glauben an Wissenschaft und Technik auch die Angst vor beiden wuchs, schlug das, zumindest in der Tendenz, um: Science-Fiction neigt seither von Frankenstein bis Blade Runner dazu, in der Dystopie zu enden, das ist das Gegenteil einer Utopie. So gesehen, ist es eher kontraproduktiv, sich an eine imaginierte Wissenschaft der Zukunft zu klammern.
Fantasie wissenschaftlichen Fortschritts meistens falsch
Und: Science-Fiction hat ein strukturelles Problem: Die Vorwegnahme der Wissenschaft in der Fiktion geht meistens schief – was im Film oder im Roman nicht nur kein Makel ist, sondern vielmehr Teil des ästhetischen Reizes und des genre-immanenten Amusements. Das Emblem dieser Spannung zwischen erlebtem Heute und spielerisch gedachter Zukunft ist das Rowenta-Bügeleisen, das die Ausstatter 1966 in den Maschinenraum des von Dietmar Schönherr befehligten "schnellen Raumkreuzers Orion" in der Serie Raumpatrouille geschraubt haben.
Unser lineares Denken bedingt düstere Zukunftsvisionen
Der Grund, warum Science-Fiction ihren Anspruch, die Zukunft, wie sie sein wird, zu zeigen, nicht einlösen kann, hat eine einfach Ursache: nämlich, dass wir, wenn wir mit unsren Ideen in die Zukunft greifen, immer linear das weiterdenken, was wir kennen. Dieses schlichte wenn – dann entspricht aber nicht der Realität. Geschichte vollzieht sich nicht linear, sondern exponentiell und dann auch noch, dank uns heute noch unbekannter, unvorhersehbarer Ereignisse, in chaotischen Schüben. Die Zukunft birgt einfach viele Überraschungen, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können.
Unvorhergesehene Ereignisse können auch positiv sein
Und genau da liegt das Befreiende und Ermutigende dieses Gedankens. Unsere Unfähigkeit, gerade aus Krisenzeiten heraus wirklich sinnvoll Science-Fiction zu betreiben, weil wir eben immer nur die Krise weiterdenken, während Ereignisse auf uns warten, die der Entwicklung eine andere Wendung, eine andere Dynamik, eine andere Bedeutung geben können, von denen wir jetzt nichts wissen. Diese Unfähigkeit schafft den Raum, sich vorzustellen, dass die unvorhergesehenen Ereignisse, anders als vielleicht gedacht, auch erfreulicher Natur sein können: angenehme Überraschungen, Wendungen zu einem Guten, das wir genauso wenig kennen wie die nächste Herausforderung, der wir uns werden stellen müssen.
Ein Blick in die Vergangenheit könnte durchaus dafür sprechen – auch wenn wir dazu neigen, historische Glücksfälle ebenso wie errungene Fortschritte schnell wieder zu verspielen. Aber das steht auf einem anderen Blatt. Wären wir noch im 18. Jahrhundert, würde ich sagen, das lernen wir auch noch.