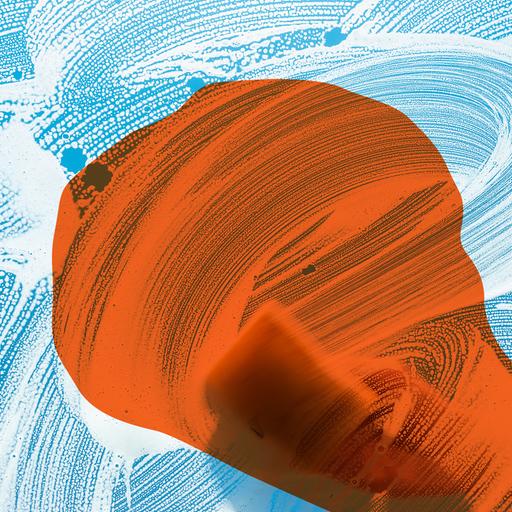Die Vernunft und das Göttliche

In seinem Buch "Der Sinn des Sinns" stellt sich der Philosoph Volker Gerhardt die Frage, wie man Glaube und Vernunft verbinden kann. Ein Gespräch über den Zusammenhang von Wissen, Erkenntnis und Religiosität.
Wie kann man Gott vernünftig denken? Wie kann man den Glauben aus dem rationalen Weltzugang erschließen? – Das sind die Grundfragen, die den Berliner Philosophen Volker Gerhardt in seinem gerade veröffentlichten Buch "Der Sinn des Sinns" antreiben. Im Gespräch erklärt er, warum er der Meinung ist das Denken und Erkennen ohne einen umfassenden Glauben unmöglich sind.
In ihrem Kommentar fragt Stephanie Rohde, ob es philosophische Gründe für deutsche Waffenlieferungen in den Irak zur Unterstützung des Kampfs gegen die Terrormilizen des "Islamischen Staats" geben kann. Wie Philosophie und Kunst zusammenhängen, das untersucht Jochen Stöckmann anhand der neuen Ausstellung "Höhere Gewalt" des weltbekannten Schweizer Künstlers Thomas Hirschhorn.
Kinder haben wir in dieser Sendung gefragt, ob Tiere glücklich sein können und der Schriftsteller Martin Walser antwortet auf die Fragen, was wir wissen können, was wir tun sollen und worüber es sich lohnt zu streiten.
Die Themen im Einzelnen:
Gott denken! – Gespräch mit Volker Gerhardt
Wenn ein systematischer Denker wie der Berliner Philosoph Volker Gerhardt ein Buch über das Göttliche ankündigt, dann fragt man sich beinahe unweigerlich: Na, wird da jemand, der über die Öffentlichkeit und das Politische umfassende Bücher geschrieben hat, fromm? Gibt er – dem es bislang doch ganz wesentlich um die rationale Durchdringung von gesellschaftlichen Grundbedingungen ging – sich nun plötzlich dem "Anderen der Vernunft" hin, der vermeintlichen Irrationalität des Glaubens? Keineswegs, meint Volker Gerhardt. Ohne eine Glaubensorientierung gibt es für ihn kein Wissen und letztlich keine Erkenntnis.
Im Gespräch erklärt er, wie Denken und Glauben zusammenhängen, wie daraus eine Vorstellung des Göttlichen entstehen kann und wie das Gewaltpotential, das Religionen in der modernen Welt immer noch und verstärkt entfalten, durch eine rationale Perspektive auf den Glauben, eine rationale Theologie, überwunden werden kann.
Außerdem:
Dass auch Kinder bei der Frage, ob Tiere glücklich sein können, ins Philosophieren geraten, das zeigt sich in unserer Reihe Kleine Leute – große Fragen.
Sechs Soldaten hat die Bundeswehr in der vergangenen Woche in den Irak geschickt. Sie sollen Schutzwesten verteilen und deutsche Waffenlieferungen in den Irak vorbereiten, um den Kampf der Kurden gegen die Terrormilizen der Organisation "Islamischer Staat" zu unterstützen. Waffen in ein kaum zu kontrollierendes Krisengebiet zu liefern ist ein überaus heikles Unterfangen für einen demokratischen Rechtsstaat, wie auch die öffentliche Diskussion der letzten Wochen gezeigt hat. Am 1. September berät der Bundestag über die Waffenlieferungen. Stephanie Rhode betrachtet die Debatte aus philosophischer Perspektive.
Wenn Philosophie anschaulich wird – Mit Titeln wie "Bataille-Monument", "Gramsci-Monument", "Spinoza-Monument", "Deleuze-Monument" oder auch "24h Foucault" für seine tatsächlich monumentalen und raumgreifenden Installationen gräbt sich der mittlerweile weltbekannte Schweizer Künstler Thomas Hirschhorn durch die Philosophiegeschichte. Ob er tatsächlich philosophische Orte im öffentlichen Raum schafft und wie womöglich Philosophie zur Kunst wird, untersucht Jochen Stöckmann anlässlich der jüngsten Installation von Thomas Hirschhorn unter dem Titel "Höhere Gewalt" im Berliner Schinkel Pavillon.
Unsere Drei Fragen – Was können wir wissen? Was sollen wir tun? Worüber sollen wir streiten? – beantwortet in dieser Woche der Schriftsteller Martin Walser, indem erst einmal die Verbindung von Wissen und Glauben hervorhebt und zugibt, gar nicht so gerne zu streiten.