Paragraf 166 oder der Friede der Religionen
Bis vor 40 Jahren war Gotteslästerung hierzulande strafbar. Der Paragraf 166 des Strafgesetzbuchs belegte die öffentliche sogenannte Beschimpfung Gottes oder der Kirchen mit drastischen Strafen. Künstler und Schriftsteller, Theaterleute und Publizisten standen mit einem Bein im Gefängnis, wenn sie kirchlich-religiöse Themen auf besonders kritische oder satirische Weise behandelten.
Dieser sogenannte Gotteslästerungs-Paragraf – ein Relikt aus dem Strafgesetzbuch des Deutschen Reichs – wurde 1969 von der sozialliberalen Regierung Willy Brandt geändert, weil er unvereinbar war mit Artikel 5 des Grundgesetzes, der die freie Meinungsäußerung und die Freiheit der Kunst garantiert. Seit der Neufassung ist nun nicht mehr die Beschimpfung von Gott, Kirchen oder religiösen Inhalten als solche strafbar. Nur wenn die Beschimpfung "geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören", so das Gesetz, wird sie mit Geldstrafe oder Gefängnis bis zu drei Jahren geahndet.
Der reformierte Paragraf 166 ist nun seit einiger Zeit in die Schusslinie von klerikalen und politisch konservativen Kreisen geraten. Ihrer Meinung nach darf eine Bestrafung der Religionsbeschimpfung nicht davon abhängen, ob sie geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören.
Nein, allein schon die Herabwürdigung des Glaubens müsse als ausreichender Straftatbestand gelten. Beispiel: der Fernsehsender MTV, der in der Comic-Reihe "Popetown" einen durchgeknallten Papst über den Bildschirm hüpfen ließ. Eine alberne Zeichentrickserie, die nach Meinung von Bischöfen und Unions-Politikern die religiösen Gefühle gläubiger Menschen beleidigte und deshalb hätte verboten werden müssen.
Auch Frösche und Schweine am Kreuz, die Lächerlichmachung der Jungfrau Maria und ähnlich Provozierendes im deutschen Kulturbetrieb fand man verbots- und strafwürdig. Gesetzesinitiativen von CDU und CSU zielten deshalb darauf ab, den Paragraf 166 zu verschärfen, bisher allerdings erfolglos.
Auch Atheisten und Freigeister aller Art kritisieren zunehmend den Paragraf 166 – freilich mit entgegengesetzter Stoßrichtung; sie treten für seine ersatzlose Streichung ein. Denn ihrer Auffassung nach stellt er einen Anachronismus in unserer modernen Welt dar, eine Gefahr für die grundgesetzlich garantierte Meinungs- und Kunstfreiheit, wie eine Reihe von Verbots- und Strafurteilen in den letzten Jahren zeige – auch gegen Autoren und Künstler. Die Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen trat deshalb für die Abschaffung des Religionsbeschimpfungs-Paragrafen ein, fand dafür aber ebenso wenig eine parlamentarische Mehrheit wie die CDU/CSU-Fraktion bei ihren Bemühungen um eine Verschärfung.
Wie auch immer die Diskussion um den Paragraf 166 weiter geht – Christen, Moslems und andere religiöse Gruppen sollten lernen, mit provozierenden Äußerungsformen in der Kultur unserer freiheitlich-pluralistischen Gesellschaft gelassener umzugehen. In modernen westlichen Staaten wie Frankreich oder Großbritannien gibt es keine Strafgesetze zur Blasphemie oder Religionsbeschimpfung mehr – und die Kirchen und Religionsgemeinschaften dort sind deshalb keineswegs untergegangen. Vielleicht stärkt es sogar die geistige Wehrhaftigkeit der Religionen, wenn ihnen in der kulturellen Auseinandersetzung mit ihren Verächtern nicht die Staatsmacht zu Hilfe kommt.
Sicher ist jedenfalls: Der moderne säkulare Staat hat nicht die Aufgabe, religiöse Gefühle durch das Strafrecht zu schützen. Wer eine Verschärfung des Paragraf 166 fordert, stellt den säkularen Staat in Frage – und damit eine wegweisende Errungenschaft westlicher Aufklärung und Moderne.
Nikolaus German, Autor und freier Journalist, M. A., geb. 1950, Studium der Politikwissenschaft, Soziologie, Geschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Lebt als Autor und freier Journalist in München, schreibt v. a. für "Süddeutsche Zeitung", "Rheinischer Merkur", "Das Parlament"; zahlreiche Beiträge für Rundfunk und Fernsehen sowie mehrere Dokumentarfilme, darunter "Botschafter der Hoffnung - Sergiu Celibidache in Rumänien", "München unterm Hakenkreuz - Hitlers Hauptstadt der Bewegung", "Max Mannheimer - ein Überlebender aus Dachau".
Der reformierte Paragraf 166 ist nun seit einiger Zeit in die Schusslinie von klerikalen und politisch konservativen Kreisen geraten. Ihrer Meinung nach darf eine Bestrafung der Religionsbeschimpfung nicht davon abhängen, ob sie geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören.
Nein, allein schon die Herabwürdigung des Glaubens müsse als ausreichender Straftatbestand gelten. Beispiel: der Fernsehsender MTV, der in der Comic-Reihe "Popetown" einen durchgeknallten Papst über den Bildschirm hüpfen ließ. Eine alberne Zeichentrickserie, die nach Meinung von Bischöfen und Unions-Politikern die religiösen Gefühle gläubiger Menschen beleidigte und deshalb hätte verboten werden müssen.
Auch Frösche und Schweine am Kreuz, die Lächerlichmachung der Jungfrau Maria und ähnlich Provozierendes im deutschen Kulturbetrieb fand man verbots- und strafwürdig. Gesetzesinitiativen von CDU und CSU zielten deshalb darauf ab, den Paragraf 166 zu verschärfen, bisher allerdings erfolglos.
Auch Atheisten und Freigeister aller Art kritisieren zunehmend den Paragraf 166 – freilich mit entgegengesetzter Stoßrichtung; sie treten für seine ersatzlose Streichung ein. Denn ihrer Auffassung nach stellt er einen Anachronismus in unserer modernen Welt dar, eine Gefahr für die grundgesetzlich garantierte Meinungs- und Kunstfreiheit, wie eine Reihe von Verbots- und Strafurteilen in den letzten Jahren zeige – auch gegen Autoren und Künstler. Die Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen trat deshalb für die Abschaffung des Religionsbeschimpfungs-Paragrafen ein, fand dafür aber ebenso wenig eine parlamentarische Mehrheit wie die CDU/CSU-Fraktion bei ihren Bemühungen um eine Verschärfung.
Wie auch immer die Diskussion um den Paragraf 166 weiter geht – Christen, Moslems und andere religiöse Gruppen sollten lernen, mit provozierenden Äußerungsformen in der Kultur unserer freiheitlich-pluralistischen Gesellschaft gelassener umzugehen. In modernen westlichen Staaten wie Frankreich oder Großbritannien gibt es keine Strafgesetze zur Blasphemie oder Religionsbeschimpfung mehr – und die Kirchen und Religionsgemeinschaften dort sind deshalb keineswegs untergegangen. Vielleicht stärkt es sogar die geistige Wehrhaftigkeit der Religionen, wenn ihnen in der kulturellen Auseinandersetzung mit ihren Verächtern nicht die Staatsmacht zu Hilfe kommt.
Sicher ist jedenfalls: Der moderne säkulare Staat hat nicht die Aufgabe, religiöse Gefühle durch das Strafrecht zu schützen. Wer eine Verschärfung des Paragraf 166 fordert, stellt den säkularen Staat in Frage – und damit eine wegweisende Errungenschaft westlicher Aufklärung und Moderne.
Nikolaus German, Autor und freier Journalist, M. A., geb. 1950, Studium der Politikwissenschaft, Soziologie, Geschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Lebt als Autor und freier Journalist in München, schreibt v. a. für "Süddeutsche Zeitung", "Rheinischer Merkur", "Das Parlament"; zahlreiche Beiträge für Rundfunk und Fernsehen sowie mehrere Dokumentarfilme, darunter "Botschafter der Hoffnung - Sergiu Celibidache in Rumänien", "München unterm Hakenkreuz - Hitlers Hauptstadt der Bewegung", "Max Mannheimer - ein Überlebender aus Dachau".
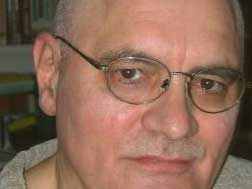
Nikolaus German© Privat