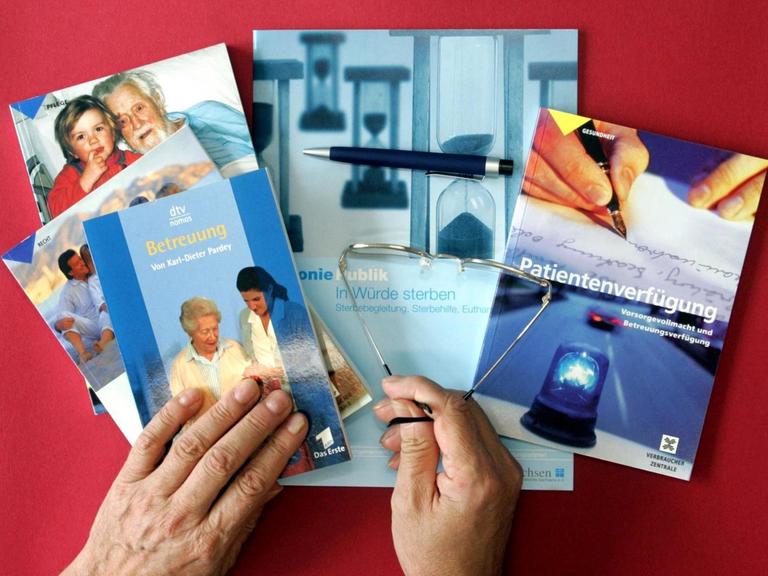"Zu Hause sterben wäre mir am liebsten"
06:53 Minuten

Seit 2008 gibt es ein gesetzliches Recht auf ein "Sterben zu Hause". Auf dem Land bleibt dieses Recht mangels Versorgungsstrukturen aber meist Theorie. Eine Ausnahme: die Mecklenburgische Seenplatte.
In Ruhe zu Hause ihre letzten Tage erleben, das wünscht sich diese ältere Dame aus Rostock: "Ich bin jetzt mit meinem Leben wirklich schon reichlich beschenkt worden. Jetzt ist es Zeit, dass ich sozusagen in den Himmel komme. Weil das so langsam wirklich beschwerlich wird."
Ob ihr Wunsch aber in Erfüllung geht, hängt entscheidend davon ab, ob in ihrer ländlichen Region eine qualifizierte palliativmedizinische Versorgung gewährleistet ist.
Eine andere Einstellung zum Sterben
Damit sieht es außerhalb der Ballungsgebiete schlecht aus. In zwei Dritteln der dünn besiedelten Landkreise gibt es immer noch keine palliativmedizinischen Versorgungsteams. Zu diesem Schluss kam 2015 die Studie "Strukturen und regionale Unterschiede in der Hospiz- und Palliativversorgung" der Bertelsmann Stiftung.
Die Region Mecklenburgische Seenplatte ist eine der wenigen Ausnahmen. Die Hausärztin Katrin Schützler-Zeitz aus Waren an der Müritz ist Teil des lokalen Palliativteams:
"Ich denke schon, dass es bei uns im ländlichen Bereich eine andere Einstellung zum Sterben gibt. Wer sein Leben lang auf einem Bauernhof verbracht hat und am Ende seines Lebens in ein Krankenhaus muss, dem fällt das natürlich besonders schwer. Der möchte in seiner gewohnten Umgebung verbleiben."
Verwandte stützen das Pflegepersonal
Damit in dieser Situation das "Sterben zu Hause" nicht zu einem unkalkulierbaren Abenteuer wird, muss einiges gewährleistet sein: "dass dauerhaft Pflegepersonen oder Angehörige da sind, dass regelmäßig der Pflegedienst reinschaut, dass regelmäßig die palliativmedizinischen Dienste reinschauen. Dass man zum Beispiel Morphin verabreicht, es gibt ja auch viele verschiedene Formen von modernen Morphinpräparaten."
Auf dem Land sind die Anfahrtswege lang. Ärzte und Pflegekräfte können nicht sofort reagieren, wenn Probleme auftreten. Dann sind die Angehörigen gefordert, erklärt Katrin Schützler-Zeitz.
"Das ist mit den meisten Angehörigen auch gut zu machen. Dass sie immer wissen, welches Medikament sie verabreichen können, wenn zum Beispiel Unruhe auftaucht. Und wenn sie dann nicht weiterkommen, haben sie die Rufnummer, die sie rund um die Uhr anrufen können."
Oft hapert es an den Versorgungsstrukturen
Seit 2008 gibt es ein gesetzliches Recht auf ein "Sterben zu Hause", palliativmedizinisch betreut. Natürlich auch in ländlichen Regionen. Soweit die Theorie. In der Praxis scheitert dieser Wunsch allzu oft an den fehlenden Versorgungsstrukturen. Denn Landkreise und Gemeinden sind nicht verpflichtet, die palliativmedizinische Versorgung sicherzustellen.
Aber warum klappt es ausgerechnet in dieser so dünn besiedelten Region rund um Waren an der Müritz?
Andrea Morgenstern vom Deutschen Roten Kreuz ist beim Kreisverband Mecklenburgische Seenplatte als Leiterin und Koordinatorin der ambulanten Hospiz- und Palliativarbeit tätig. Zusammen mit ihrem DRK-Team hat sie es geschafft, die dünn besiedelte Region um Waren an der Müritz palliativmedizinisch auf Großstadtniveau zu bringen. Sie hätten noch nie eine Anfrage ablehnen müssen, sagt sie.
Mitmenschliches Engagement ist gefragt
Dass es hier so gut klappt, liegt vor allem daran, dass das Deutsche Rote Kreuz auf viele freiwillige Mitarbeiter zurückgreifen kann. Über 50 dieser Hospizbegleiter ergänzen das professionelle Palliativteam, erklärt Andrea Morgenstern:
"Wir haben Begleitungen in der Häuslichkeit, wo wir jeden Tag sind, wenn es ganz konkret an das Sterben geht. Das ist durchaus möglich, dass der ehrenamtliche Hospizbegleiter tatsächlich mehrere Stunden bis zum letzten Atemzug da ist."
"Sterben zu Hause" ist in dieser Region zu einer Selbstverständlichkeit geworden. Fast 200 Menschen begleitet das DRK-Team pro Jahr in der häuslichen Umgebung. Der Schlüssel des Erfolgs liegt in der Mobilisierung des mitmenschlichen Engagements, erklärt Andrea Morgenstern:
"Menschen beschäftigen sich schon damit: Was mache ich in meiner Zeit? Was möchte ich Sinnvolles machen? Ein Ehrenamt kann ich überall übernehmen. Im Hospiz-Ehrenamt zu arbeiten, das ist was Besonderes. Und die meisten Menschen haben ihre persönliche Erfahrung gemacht."
"Man begreift eher, dass die Mutter gegangen ist"
Roy Dodeck ist einer der ehrenamtlichen Hospizbegleiter des DRK-Teams. Der Tod seiner Mutter war für ihn das Schlüsselerlebnis:
"Meine Mutter hat den Wunsch eben geäußert, dass sie zu Hause sterben will. Sie hat ihr Zuhause geliebt. Sie wollte ihre Mitmenschen um sich haben, ihre Kinder. Jetzt kam natürlich die Frage: Wie machen wir das? Was kommt da auf und zu? Daraufhin bin ich zur Hausärztin gegangen und ihr gesagt, dass ich da Hilfe brauche. Ich schaffe das nicht allein, dieses häusliche Sterben."
Das palliativmedizinische Team des Deutschen Roten Kreuzes hat seine Familie durch diese schwere Phase begleitet. Eine bleibende Erfahrung, die er gerne weitergibt:
"Man begreift es doch eher, dass die Mutter gegangen ist, wenn man dabei ist. Man kann besser abschließen damit."
Manchmal kommt es zu depressiven Störungen
Doch leider heilt die Zeit nicht immer alle Wunden. Bei einer Sterbebegleitung kommt es, statistisch gesehen bei über der Hälfte der Angehörigen, zumindest zeitweise, zu schweren depressiven Störungen. Da wäre fachlicher Beistand geboten, gibt die Hausärztin Katrin Schützler-Zeitz zu bedenken.
"Was in unserer Region ein bisschen schlecht ist, ist die psychologische Betreuung. Wir haben neuerdings zwar viele Psychologen, aber die sind alle mit Terminen ausgebucht. Da finden wir keinen, den wir mit ins Boot holen können, der zum Beispiel zum Hausbesuch mitkommt."
"Zeit, in den Himmel zu kommen"
Trotzdem: Allein in einer Klinik versterben, das will hier niemand mehr, erklärt auch die ältere Dame aus Rostock:
"Also wirklich, in meinem Alter - ich würde mich jetzt nicht noch mal auf den OP-Tisch legen. Das geht einfach von mir aus, dass ich mir sage: Als so alte Tante, es ist jetzt wirklich Zeit da, in den Himmel zu kommen."